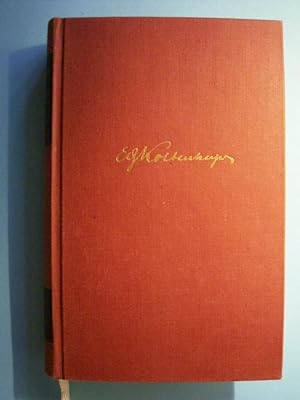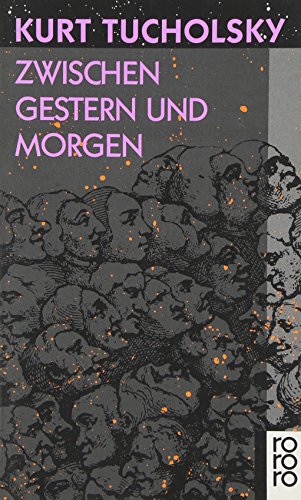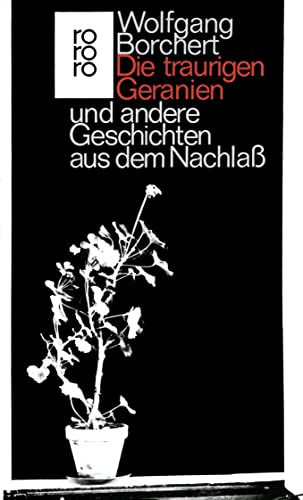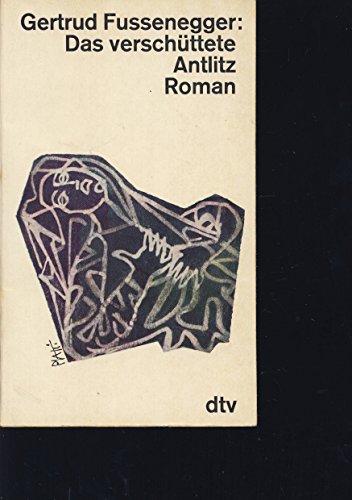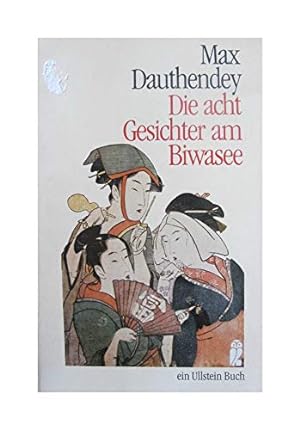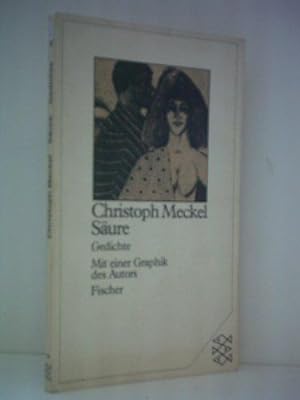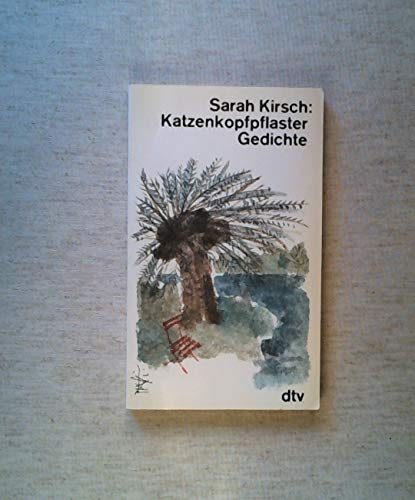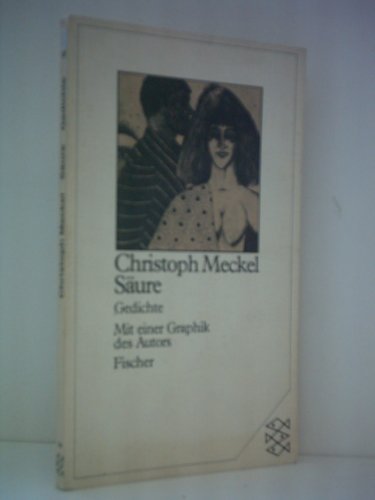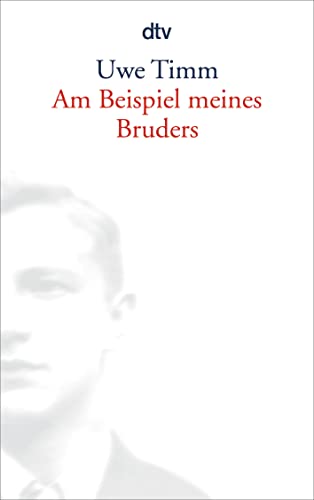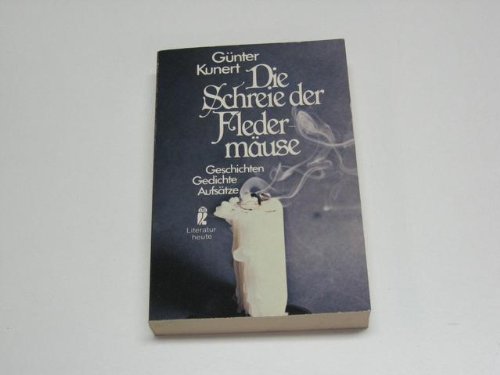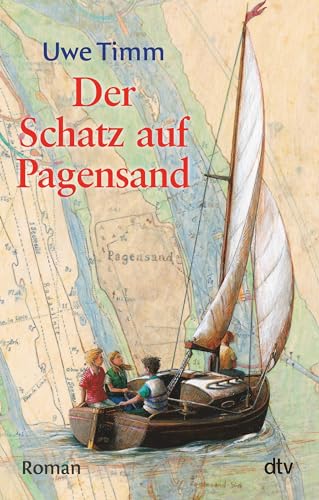gedichte nationalsozialismus (Mehr als 1.000 Ergebnisse)
Suchfilter
Produktart
- Alle Product Types
- Bücher (994)
- Magazine & Zeitschriften (11)
- Comics (1)
- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Kunst, Grafik & Poster (1)
- Fotografien (1)
- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Manuskripte & Papierantiquitäten (54)
Zustand Mehr dazu
Weitere Eigenschaften
Sprache (5)
Gratisversand
- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
Land des Verkäufers
Verkäuferbewertung
-
Gruss nach vorn. Eine Auswahl aus seinen Schriften und Gedichten. Herausgegeben von Erich Kästner.,
Verlag: Berlin/Stuttgart/Hamburg/Baden-Baden, Rowohlt Verlag, 3. Auflage, 1948.,, 1948
Anbieter: Versandantiquariat Harald Gross, Hofheim, Deutschland
Zustand: Gut. 263 S., 8°, gebunden, Halbleinen. Befriedigender Zustand, Einband mit Gebrauchsspuren, Ex Libris auf Deckelinnenseite, Papierbräunung, hinteres Gelenk gebrochen, Bindung intakt, textsauber, farbiger Kopfschnitt. - Sehr oft sei er ihm nicht begegnet, schreibt Kästner in seinem Nachwort zu dieser außergewöhnlichen Sammlung, wahrgenommen und begleitet hat er ihn dafür umso intensiver. Ihn, den kleinen dicken Berliner, der mit der Schreibmaschine eine Katastrophe aufhalten wollte, den schärfsten Kritiker des Nationalsozialismus, den Satiriker der Weimarer Republik, der 1929 ins Exil ging und sich sechs Jahre später aus Verzweiflung den Tod gab. Kurt Tucholsky (* 9. Januar 1890 in Berlin; 21. Dezember 1935 in Göteborg) war ein deutscher Journalist und Schriftsteller. Er schrieb auch unter den Pseudonymen Kaspar Hauser, Peter Panter, Theobald Tiger und Ignaz Wrobel. Tucholsky zählte zu den bedeutendsten Publizisten der Weimarer Republik. Als politisch engagierter Journalist und zeitweiliger Mitherausgeber der Wochenzeitschrift Die Weltbühne erwies er sich als Gesellschaftskritiker in der Tradition Heinrich Heines. Zugleich war er Satiriker, Kabarettautor, Liedtexter, Romanautor, Lyriker und Kritiker (Literatur, Film, Musik). Er verstand sich selbst als linker Demokrat, Sozialist,Pazifist und Antimilitarist und warnte vor rechten Tendenzen vor allem in Politik, Militär und Justiz und vor der Bedrohung durch den Nationalsozialismus. Zustand: gebraucht; gut Sprache: de Gewicht in Gramm: 350.
-
Das Wilhelm von Scholz Buch. Eine Auswahl der Werke.
Verlag: Stuttgart, Walter Hädecke Verlag, 9. - 13. Tausend,, 1924
Anbieter: Versandantiquariat Harald Gross, Hofheim, Deutschland
Zustand: Gut. 300 S., Altersgemäß guter Zustand, Einband leicht lichtrandig, Namenseintrag auf dem Vorsatz, textsauber. Farbiger Kopfschnitt, Rückengoldprägung, Fraktur. Anhang mit einem Lebensabriß von R. K. Goldschmit, Faltblatt mit Handschrift und Stimmen über Wilhelm von Scholz. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 510 8°, gebundenes Exemplar, Halbleder.
-
Von des Glücks Barmherzigkeit. Gedichte.
Verlag: Berlin: Aufbau Verlag, 1946
Anbieter: Grammat Antiquariat, Oberbarnim, Deutschland
Erstausgabe
Olwd. leicht fleckig. 0. 8°. 77 S. Olwd. leicht fleckig. Erstausgabe Sprache: Deutsch 0.500 gr.
-
Romane II. Montsalvasch. Das Lächeln der Penaten. (Gesamtausgabe der Werke in zwei Abteilungen. Abt. 1; Band IV).,
Verlag: Darmstadt, Kolbenheyer-Gesellschaft,, 1962
Anbieter: Versandantiquariat Harald Gross, Hofheim, Deutschland
8°, Leinen. Zustand: Gut. 496 S., Sehr guter Zustand, Einband und Buchschnitt mit leichten Gebrauchsspuren, textsauber. Lesebändchen, Farbkopfschnitt, Titel- und Rückengoldprägung. -- Erwin Guido Kolbenheyer (* 30. Dezember 1878 in Budapest; 12. April 1962 in München) war ein österreichischer Romanautor, Dramatiker und Lyriker. Der Sohn des Architekten Franz Kolbenheyer und der Malerin Marianne Eitner besuchte das Gymnasium in Eger. Nach einem Philosophie-, Psychologie- und Zoologiestudium in Wien wurde er 1905 zum Dr. phil. promoviert. 1919 übersiedelte Kolbenheyer nach Tübingen, wo er bis 1932 als freier Schriftsteller lebte. In den Jahren 1917 bis 1926 schuf er sein Hauptwerk, die Romantrilogie Paracelsus. Seit 1926 war er Mitglied der Preußischen Dichterakademie. Kolbenheyer vertrat in seinen Werken eine Philosophie des Biologismus: Er glaubte, es gäbe fundamentale biologische Unterschiede zwischen den Völkern, und versuchte, spezifische Eigenarten z.B. der deutschen Dichtkunst auf angeblich biologische Grundlagen des deutschen Volkstums zurückzuführen. Er begründete eine Schule von Anhängern nach dem Vorbild der mittelalterlichen Bauhütten. In der Zeit von 1933 bis 1944 unterstützte er den Nationalsozialismus in zahlreichen Reden und Schriften, obwohl er erst 1940 in die NSDAP eintrat. Kolbenheyer wurde vielfach während der NS-Herrschaft ausgezeichnet. 1944, als sich bereits das Ende des Zweiten Weltkriegs abzeichnete, wurde er von Hitler auf die Sonderliste der Gottbegnadetenliste mit den sechs wichtigsten Schriftstellern gesetzt und genoss dadurch weitere Privilegien, wie die Freistellung von sämtlichem Kriegsdienst, auch an der Heimatfront. Nach 1945 erhielt Kolbenheyer wegen seiner aktiven Unterstützung des Nationalsozialismus ein fünfjähriges Schreibverbot. Er lebte in Schlederloh und zuletzt in Gartenberg (Stadtteil von Geretsried) bei Wolfratshausen. Er war Mitglied der rechtsextremistischen Gesellschaft für Freie Publizistik und deren Vorläufern. Werner Bergengruen wertete 1946 Kolbenheyers Wirken während der NS-Diktatur mit folgenden Worten: In seiner großen Eitelkeit war er der Meinung, das geistige Leben Deutschlands kulminiere in seiner Person". In der Sowjetischen Besatzungszone wurden mehrere Schriften von Kolbenheyer auf die Liste der auszusondernden Literatur gesetzt, in der Deutschen Demokratischen Republik folgte noch Das Kolbenheyer-Buch. Sprache: de Gewicht in Gramm: 550.
-
Tagebuch der Liebe: eine Begegnung in Gedichten, Briefen und Interviews. Vorwort von Hans Zehetmair. Hrsg. Von Dorothea Heiser. Mit einem Nachwort von August Everding. Aus dem Polnischen übersetzt von Nina Kozlowski
Verlag: Vechta: Geest-Verlag, 2005, 2005
Anbieter: Steven Wolfe Books, Newton Centre, MA, USA
Wygodzki, Stanislaw, 1907-1992. Tagebuch der Liebe: eine Begegnung in Gedichten, Briefen und Interviews. Vorwort von Hans Zehetmair. Hrsg. Von Dorothea Heiser. Mit einem Nachwort von August Everding. Aus dem Polnischen übersetzt von Nina Kozlowski. Vechta: Geest-Verlag, 2005, 160pp., PAPERBACK, very good. Der Holocaust ist das dunkelste Kapitel deutscher Ge-schichte. Die schrecklichen Ereignisse, die Unmensch-lichkeit, die Verbrechen und Greueltaten lassen uns auch heute noch erschaudern. Geschichtliche Dokumente aus der Zeit des National-sozialismus müssen gesammelt werden, um nachfolgen-den Generationen zugänglich zu sein und als Warnung zu dienen. Die Gedanken sind frei und können von keinem noch so grausamen Regime verboten werden. Dies belegt Stanis-law Wygodzki mit seinen Gedichten, die nun erstmals in deutscher Sprache erschienen sind. Die gesammelte Korrespondenz und das Zeitzeugen-Interview gewähren Einblick, wie sich der frühere KZ-Häftling seiner eigenen Vergangenheit annähert. Die schrecklichen Erlebnisse versucht er zu verarbeiten, in-dem er rund fünf Jahrzehnte später nach Deutschland zurückkehrt. Die Herausgeberin Dorothea Heiser verdient großes Lob für die Initiative zum Zustandekommen dieses Gedicht-bandes Tagebuch der Liebe. Der Leser sei gebeten, die Inhalte der Gedichte im Kon-text mit den unzähligen Opfern des Nationalsozialismus zu sehen, denen mit dieser Publikation in Würde und Respekt eine bleibende Erinnerung zuteil wird. 9783937844510 ISBN 3937844511.
-
Zwischen gestern und morgen. Eine Auswahl aus seinen Schriften und Gedichten. Herausgegeben von Mary Gerold-Tucholsky. - (=Rowohlts-Rotations-Romane, rororo 50).
Verlag: Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag 1995 (Januar)., 1995
ISBN 10: 3499100509 ISBN 13: 9783499100505
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Zustand: Gut. 877. - 881. Tausend. 251 (3) Seiten. 19 cm. Umschlaggestaltung: Barbara Hanke Sehr guter Zustand. Eine von Scherz, Satire und Ironie funkelnde Auswahl aus Prosa und Lyrik des berühmten Autors, dem alles Menschliche zwischen dem Stettiner Bahnhof und dem XX. Arrondissement vertraut war. - Tucholsky, Kurt (Pseud. Peter Panter, Theobald Tiger, Ignaz Wrobel, Kaspar Hauser), *9.1.1890 Berlin, 21.12.1935 Hindås (Schweden) (Freitod). T., Sohn eines Kaufmanns, studierte Jura in Berlin, Genf und Jena (Promotion 1914). Im 1.Weltkrieg war er 3 Jahre eingezogen. 1918-24 lebte er in Berlin, dann für 5 Jahre in Paris, ab 1929 in Schweden, von wo aus er bis 1934 noch ausgedehnte Reisen unternahm. Da er aber als Emigrant nur einen auf 6 Monate befristeten Ausländerpaß hatte, konnte der von den Nazis Ausgebürgerte ab 1934 seinen Wohnsitz kaum noch verlassen, materielle Probleme und eine chronische Siebbeinvereiterung machten ihn zunehmend depressiver, 1935 nahm er sich das Leben. Ab 1911 hat T. kontinuierlich kultur- und zeitkritische Glossen, satirische Gedichte und Theaterrezensionen veröffentlicht, zunächst vorwiegend im sozialdemokratischen "Vorwärts", dann häufig auch in der 1905 von S. Jacobsohn gegründeten "Schaubühne" (ab 1918 "Weltbühne"). Schon die ersten Artikel gegen Militarismus, Chauvinismus und reaktionäres Spießertum zeigen T.s Begabung für polemische Zuspitzung. Nach dem Ende des 1.Weltkriegs nimmt er in Berlin seine kulturkritische Tätigkeit wieder auf, in der "Weltbühne" erscheinen oft mehrere Artikel in einem Heft, weshalb er sich verschiedene Pseudonyme zulegt. Der Tenor seiner Beiträge wird zunehmend schärfer, er attackiert die rechtslastige Justiz der Weimarer Republik, polemisiert gegen die Dolchstoßlegende und verfaßt antimilitaristische Gedichte, z.B. das Gebet nach dem Schlachten. Auch als Literaturkritiker tritt er hervor; seine unorthodoxen, temperamentvollen Rezensionen zeichnen sich durch eigenwillige Subjektivität aus. Eine Weile tendiert er auf Grund seiner politischen Überzeugungen zur USPD. Aus Enttäuschung über das Versagen der "flauen Republik" verläßt er Deutschland und lebt ab 1924 in Paris. Auch hier setzt er seine publizistische Tätigkeit mit unverminderter Energie fort. Er publiziert in ungefähr 100 Zeitungen und Zeitschriften, bevorzugtes Forum bleibt die "Weltbühne". Nach dem Tod von Jacobsohn übernimmt T. für kurze Zeit die Leitung dieses wohl wichtigsten Kampfblattes der intellektuellen Linken und übergibt sie dann Carl v. Ossietzky (der später im KZ ermordet wurde). Sehr früh und voll von Pessimismus diagnostiziert er die Gefahren des Nationalsozialismus, dessen schärfster publizistischer Gegner T. wird. Daneben veröffentlicht er Agitationslyrik, die durchsetzt ist von sozialer Anklage, aber auch witzige Chansons, in denen er die Banalität des Spießbürgertums aufs Korn nimmt. T. wird damit zu einem der wichtigsten Autoren des kritischen Kabaretts der 20er Jahre. Geradezu glänzend sind seine Berichte über die z.T. aberwitzigen Urteile der Weimarer Justiz. - T. bedient sich häufig der Rollenprosa (oft im Berliner Jargon), um Militärs, Nationalisten und Kleinbürgermentalität zu entlarven. Die durch fingierten Immediatbericht erzielte Spontaneität seiner Glossen kontrastiert mit den ironisch zugespitzten Bonmots, die die Quintessenz aus diesen satirischen "Fallstudien" ziehen. T. hat als sensibler Wortkünstler, eleganter Stilist, virtuoser Polemiker so leicht keinen ebenbürtigen Konkurrenten im deutschen Sprachraum. - 1931 veröffentlicht er den heiter-verspielten Roman Schloß Gripsholm, der mit viel Charme, bisweilen aber auch mit forciertem Understatement eine ungewöhnliche Liebesaffäre beschreibt und nicht frei ist von Sentimentalitäten. - Ab 1932 veröffentlicht T. keine einzige Zeile mehr aus Verzweiflung über die politische Situation, seine Briefe unterzeichnet er mit "ein aufgehörter Deutscher" und "ein aufgehörter Schriftsteller". Die erst lange nach seinem Freitod aufgefundenen Briefe aus dem Schweigen und seine Q-Tagebücher geben indes zu erkennen, daß in den drei letzten Lebensjahren seine geistige Aktivität - trotz der quälenden Krankheit - nicht erlahmt war. Vor allem in den Q-Tagebüchern finden sich scharfsinnige politische Analysen und Prophetien, voll von Zorn und Degout, voll Empörung aber auch über die Appeasement-Politik der Westmächte. Witzsprühende Sentenzen wechseln ab mit flapsig-resignierten Klagen über "den großen Knacks" seines Lebens: die Einsicht in die Vergeblichkeit seiner politischen Aufklärungsarbeit und die seiner Mitstreiter. Diese beiden Nachlaßpublikationen gehören nicht nur als Zeitdokument, sondern auch als Dokument der Trauer eines enttäuschten Moralisten zu den wichtigsten Werken der deutschen Exilliteratur. Autorenlexikon/Systhema - 1950 führte der Rowohlt-Verlag mit der Reihe "rororo-Taschenbuch' das Taschenbuch im großen Stil in den deutschen Buchmarkt ein. Mit dieser Reihe sollten anspruchsvolle Schriftsteller, vor allem des amerikanischen und französischen Marktes in Kontakt mit den "leseunerfahrenen Massen' gebracht werden. Durch geringe Produktionskosten und moderne Vermarktungsmethoden, z. B. Zigarettenreklame im Text, war die Reihe konkurrenzlos günstig und es konnten auch unbekannte Autoren verlegt werden. - Kurt Tucholsky (* 9. Januar 1890 in Berlin; 21. Dezember 1935 in Göteborg) war ein deutscher Journalist und Schriftsteller. Er schrieb auch unter den Pseudonymen Kaspar Hauser, Peter Panter, Theobald Tiger und Ignaz Wrobel. Tucholsky zählte zu den bedeutendsten Publizisten der Weimarer Republik. Als politisch engagierter Journalist und zeitweiliger Mitherausgeber der Wochenzeitschrift Die Weltbühne erwies er sich als Gesellschaftskritiker in der Tradition Heinrich Heines. Zugleich war er Satiriker, Kabarettautor, Liedtexter, Romanautor, Lyriker und Kritiker (Literatur, Film, Musik[1]). Er verstand sich selbst als linker Demokrat, Sozialist,[2] Pazifist und Antimilitarist und warnte vor rechten Tendenzen vor allem in Politik, M.
-
Draußen vor der Tür und ausgewählte Erzählungen. Mit einem Nachwort von Heinrich Böll. - (=rororo 10170).
Verlag: Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag 2001 Februar., 2001
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Taschenbuch. Kartoniert. Zustand: Gut. 82. Auflage. 120 (8) Seiten. 19 cm. Umschlaggestaltung: Walter Hellmann. Cathrin Günther. Sehr guter Zustand. Besitzername auf dem Vorsatz. Mit 3 Anstreichungen. - Das einzige Drama des früh verstorbenen Dichters ist ein verzweifelter Protestschrei gegen die zerstörerische und verderbnisträchtige Macht des Krieges. Seine Erzählungen und Prosastücke berichten mit sicher akzentuierter Ausdruckskraft von den verheerenden Kriegsfolgen im einzelnen und im gemeinsamen Menschenleben. Drama und ausgewählte Erzählungen. - - Wolfgang Borchert (* 20. Mai 1921 in Hamburg; 20. November 1947 in Basel) war ein deutscher Schriftsteller. Sein schmales Werk von Kurzgeschichten, Gedichten und einem Theaterstück machte Borchert nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem der bekanntesten Autoren der so genannten Trümmerliteratur. Mit seinem Heimkehrerdrama Draußen vor der Tür konnten sich in der Nachkriegszeit weite Teile des deutschen Publikums identifizieren, Kurzgeschichten wie Das Brot, An diesem Dienstag oder Nachts schlafen die Ratten doch fanden als musterhafte Beispiele ihrer Gattung Aufnahme in den Schulkanon, seine pazifistische Mahnung Dann gibt es nur eins! wurde vielfach auf Friedenskundgebungen rezitiert. Wolfgang Borchert schrieb schon in seiner Jugend zahlreiche Gedichte, dennoch strebte er lange den Beruf eines Schauspielers an. Nach einer Schauspielausbildung und wenigen Monaten in einem Tourneetheater wurde Borchert 1941 zum Kriegsdienst in die Wehrmacht eingezogen und musste am Angriff auf die Sowjetunion teilnehmen. An der Front zog er sich schwere Verwundungen und Infektionen zu. Mehrfach wurde er wegen Kritik am Regime des Nationalsozialismus und sogenannter Wehrkraftzersetzung verurteilt und inhaftiert. Auch in der Nachkriegszeit litt Borchert stark unter den im Krieg zugezogenen Erkrankungen und einer Leberschädigung. Nach kurzen Versuchen, erneut als Schauspieler und Kabarettist aktiv zu werden, blieb er ans Krankenbett gefesselt. Dort entstanden zwischen Januar 1946 und September 1947 zahlreiche Kurzgeschichten und innerhalb eines Zeitraums von acht Tagen das Drama Draußen vor der Tür. Während eines Kuraufenthalts in der Schweiz starb er mit 26 Jahren an den Folgen seiner Lebererkrankung. Bereits zu Lebzeiten war Borchert durch die Radioausstrahlung seines Heimkehrerdramas im Januar 1947 bekannt geworden, doch sein Publikumserfolg setzte vor allem postum ein, beginnend mit der Theateruraufführung von Draußen vor der Tür am 21. November 1947, einen Tag nach seinem Tod. . Aus: wikipedia-Wolfgang_Borchert Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 140.
-
Die traurigen Geranien. Und andere Geschichten aus dem Nachlaß. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Peter Rühmkorf. - (=rororo 975).
Verlag: Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1986
ISBN 10: 3499109751 ISBN 13: 9783499109751
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Taschenbuch. Kartoniert. Zustand: Gut. 260. - 267. Tausend. 123 (3) Seiten. Einbandentwurf: Werner Rebhuhn. Guter Zustand. Seiten papierbedingt leicht gebräunt. 2 Seiten mit Einmerkungsknick. - Was macht man, wenn man als junger Mann entdeckt, dass die Nase der Frau, die man im Dämmerlicht ansprach, eine Ungeheuerlichkeit ist, wie angenäht? Man flieht, wischt sich den Schweiß von der Stirn und grinst. Die Geschichten des früh verstorbenen Wolfgang Borchert sind so subversiv wie komödiantisch. - - Wolfgang Borchert (* 20. Mai 1921 in Hamburg; 20. November 1947 in Basel) war ein deutscher Schriftsteller. Sein schmales Werk von Kurzgeschichten, Gedichten und einem Theaterstück machte Borchert nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem der bekanntesten Autoren der so genannten Trümmerliteratur. Mit seinem Heimkehrerdrama Draußen vor der Tür konnten sich in der Nachkriegszeit weite Teile des deutschen Publikums identifizieren, Kurzgeschichten wie Das Brot, An diesem Dienstag oder Nachts schlafen die Ratten doch fanden als musterhafte Beispiele ihrer Gattung Aufnahme in den Schulkanon, seine pazifistische Mahnung Dann gibt es nur eins! wurde vielfach auf Friedenskundgebungen rezitiert. Wolfgang Borchert schrieb schon in seiner Jugend zahlreiche Gedichte, dennoch strebte er lange den Beruf eines Schauspielers an. Nach einer Schauspielausbildung und wenigen Monaten in einem Tourneetheater wurde Borchert 1941 zum Kriegsdienst in die Wehrmacht eingezogen und musste am Angriff auf die Sowjetunion teilnehmen. An der Front zog er sich schwere Verwundungen und Infektionen zu. Mehrfach wurde er wegen Kritik am Regime des Nationalsozialismus und sogenannter Wehrkraftzersetzung verurteilt und inhaftiert. Auch in der Nachkriegszeit litt Borchert stark unter den im Krieg zugezogenen Erkrankungen und einer Leberschädigung. Nach kurzen Versuchen, erneut als Schauspieler und Kabarettist aktiv zu werden, blieb er ans Krankenbett gefesselt. Dort entstanden zwischen Januar 1946 und September 1947 zahlreiche Kurzgeschichten und innerhalb eines Zeitraums von acht Tagen das Drama Draußen vor der Tür. Während eines Kuraufenthalts in der Schweiz starb er mit 26 Jahren an den Folgen seiner Lebererkrankung. Bereits zu Lebzeiten war Borchert durch die Radioausstrahlung seines Heimkehrerdramas im Januar 1947 bekannt geworden, doch sein Publikumserfolg setzte vor allem postum ein, beginnend mit der Theateruraufführung von Draußen vor der Tür am 21. November 1947, einen Tag nach seinem Tod. . Aus: wikipedia-orgWolfgang_Borchert Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 110.
-
Draußen vor der Tür und ausgewählte Erzählungen. Mit einem Nachwort von Heinrich Böll. - (=rororo 10170).
Verlag: Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag 2002 April., 2002
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Taschenbuch. Kartoniert. Zustand: Sehr gut. 84. Auflage. 120 (8) Seiten. 19 cm. Umschlaggestaltung: Walter Hellmann. Cathrin Günther. Sehr guter Zustand. Besitzername auf dem Vorsatz. Mit 3 Anstreichungen. Das einzige Drama des früh verstorbenen Dichters ist ein verzweifelter Protestschrei gegen die zerstörerische und verderbnisträchtige Macht des Krieges. Seine Erzählungen und Prosastücke berichten mit sicher akzentuierter Ausdruckskraft von den verheerenden Kriegsfolgen im einzelnen und im gemeinsamen Menschenleben. Drama und ausgewählte Erzählungen. - Wolfgang Borchert (* 20. Mai 1921 in Hamburg; 20. November 1947 in Basel) war ein deutscher Schriftsteller. Sein schmales Werk von Kurzgeschichten, Gedichten und einem Theaterstück machte Borchert nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem der bekanntesten Autoren der so genannten Trümmerliteratur. Mit seinem Heimkehrerdrama Draußen vor der Tür konnten sich in der Nachkriegszeit weite Teile des deutschen Publikums identifizieren, Kurzgeschichten wie Das Brot, An diesem Dienstag oder Nachts schlafen die Ratten doch fanden als musterhafte Beispiele ihrer Gattung Aufnahme in den Schulkanon, seine pazifistische Mahnung Dann gibt es nur eins! wurde vielfach auf Friedenskundgebungen rezitiert. Wolfgang Borchert schrieb schon in seiner Jugend zahlreiche Gedichte, dennoch strebte er lange den Beruf eines Schauspielers an. Nach einer Schauspielausbildung und wenigen Monaten in einem Tourneetheater wurde Borchert 1941 zum Kriegsdienst in die Wehrmacht eingezogen und musste am Angriff auf die Sowjetunion teilnehmen. An der Front zog er sich schwere Verwundungen und Infektionen zu. Mehrfach wurde er wegen Kritik am Regime des Nationalsozialismus und sogenannter Wehrkraftzersetzung verurteilt und inhaftiert. Auch in der Nachkriegszeit litt Borchert stark unter den im Krieg zugezogenen Erkrankungen und einer Leberschädigung. Nach kurzen Versuchen, erneut als Schauspieler und Kabarettist aktiv zu werden, blieb er ans Krankenbett gefesselt. Dort entstanden zwischen Januar 1946 und September 1947 zahlreiche Kurzgeschichten und innerhalb eines Zeitraums von acht Tagen das Drama Draußen vor der Tür. Während eines Kuraufenthalts in der Schweiz starb er mit 26 Jahren an den Folgen seiner Lebererkrankung. Bereits zu Lebzeiten war Borchert durch die Radioausstrahlung seines Heimkehrerdramas im Januar 1947 bekannt geworden, doch sein Publikumserfolg setzte vor allem postum ein, beginnend mit der Theateruraufführung von Draußen vor der Tür am 21. November 1947, einen Tag nach seinem Tod. . . . Aus: wikipedia-Wolfgang_Borchert. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 140.
-
Gottfried Benn in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Mit Zeittafel, Zeugnisse, Bibliographie und Register. Den dokumentarischen und bibliographischen Anhang bearbeitete Paul Raabe. - (=Rowohlts Monographien, herausgegeben von Kurt Kusenberg, Band rm 71).
Verlag: Reinbek bei Hamburg, Rowohlt-Taschenbuch-Verlag, 1962
ISBN 10: 349950071X ISBN 13: 9783499500718
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Zustand: Gut. 16. - 20. Tausend. 2. Auflage. 179 (1) Seiten mit vielen Abbildungen. Einbandentwurf: Werner Rebhuhn. Guter Zustand. Die einschlägige Forschung hat über alle Zweifel hinaus nachgewiesen, welche Fülle von Genie und Hochbegabung in mehr als vier Jahrhunderten aus dem protestantischen Pfarrhaus hervorgegangen ist. Mit Recht war also Gottfried Benn auf diese Herkunft stolz und ist in seinem Werk verschiedentlich auf sie eingegangen, am ausführlichsten in den Jahren 1933/34, als er sich genötigt sah, gegen den Vorwurf "nichtarischer" Abstammung. - Gottfried Benn (* 2. Mai 1886 in Mansfeld, Brandenburg; 7. Juli 1956 in Berlin) war ein deutscher Arzt, Dichter und Essayist. . Gottfried Benn gilt als einer der bedeutendsten deutschen Dichter der literarischen Moderne. Ein erstes Mal betrat er die literarische Szene als Expressionist mit seinen Morgue-Gedichten, die mit herkömmlichen poetischen Traditionen radikal brachen und in denen vor allem Eindrücke aus seiner Tätigkeit als Arzt starken Niederschlag fanden. Sektionen und Krebs- und Geburtsstationen werden scheinbar emotionslos beschrieben, und romantische Titel wie Kleine Aster" wecken Erwartungen, die dann krass enttäuscht werden. Nach dem oben genannten Gedichtband erschienen in der Folgezeit nur noch wenige mit äußerst geringer Auflage; während der Nazizeit unterlag Benn einem Schreibverbot. Vom Nationalsozialismus, mit dem er zuerst sympathisiert hatte, wandte sich Benn wohl vor allem ab, weil er ihn schließlich als ähnlich antikulturell einschätzte wie den Kommunismus und Sozialismus. Nach Kriegsende wurde er zunächst wegen seiner anfänglichen Unterstützung des Hitlerregimes angefeindet, doch spätestens mit seinen Statischen Gedichten, die sich weit vom wild-zynischen Ton der Morgue-Gedichte entfernt hatten, fand er in der jungen Bundesrepublik ein neues, stetig wachsendes Publikum. So wurde der Autor zum Ende hin ein weitberühmter, mit dem Büchner-Preis ausgezeichneter und stilbildender Dichter. . Aus: wikipedia-Gottfried_Benn. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 142 19 cm. Taschenbuch. Kartoniert.
-
Aimée & Jaguar. Eine Liebesgeschichte, Berlin 1943.
Verlag: Köln Kiepenheuer & Witsch, 1994
Anbieter: Antiquariat Eule, Brühl, Deutschland
fester Einband. OPp m SU.; 8°; 295 Seiten Einband minimal berieben. Erica Fischer begegnet in Berlin der 80 jährigen Lilly Wust. Von ihr läßt sie sich die Geschichte ihrer Liebe zur 21jährigen Jüdin Felice Schragenheim erzählen, die mitten im Krieg begann und nur kurze Zeit bis zur Felices Deportation nach Theresienstadt und Groß-Rosen währte. Zurück blieben Gedichte, Briefe, Tagebücher und Photografien. Erica Fischer hat viele Spuren aufgenommem und mit ihrer Erzählung ein großartiges Zeugnis einer außergewöhnlichen Liebe in extremer Zeit geschaffen. Sprache: Deutschu 510 gr.
-
Draußen vor der Tür und ausgewählte Erzählungen. Mit einem Nachwort von Heinrich Böll. - (=Rowohlts-Rotations-Romane, rororo 170).
Verlag: Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1961
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Kartoniert mit Leinenrücken. Zustand: Gut. 339. - 363. Tausend. 15. Auflage. 137 (5) Seiten. 19 cm. Einbandentwurf: Karl Gröning und Gisela Pferdmenges. Guter Zustand. Seiten papierbedingt leicht gebräunt. Besitzername auf dem Vorsatz. Das einzige Drama des früh verstorbenen Dichters ist ein verzweifelter Protestschrei gegen die zerstörerische und verderbnisträchtige Macht des Krieges. Seine Erzählungen und Prosastücke berichten mit sicher akzentuierter Ausdruckskraft von den verheerenden Kriegsfolgen im einzelnen und im gemeinsamen Menschenleben. Drama und ausgewählte Erzählungen. - - Wolfgang Borchert (* 20. Mai 1921 in Hamburg; 20. November 1947 in Basel) war ein deutscher Schriftsteller. Sein schmales Werk von Kurzgeschichten, Gedichten und einem Theaterstück machte Borchert nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem der bekanntesten Autoren der so genannten Trümmerliteratur. Mit seinem Heimkehrerdrama Draußen vor der Tür konnten sich in der Nachkriegszeit weite Teile des deutschen Publikums identifizieren, Kurzgeschichten wie Das Brot, An diesem Dienstag oder Nachts schlafen die Ratten doch fanden als musterhafte Beispiele ihrer Gattung Aufnahme in den Schulkanon, seine pazifistische Mahnung Dann gibt es nur eins! wurde vielfach auf Friedenskundgebungen rezitiert. Wolfgang Borchert schrieb schon in seiner Jugend zahlreiche Gedichte, dennoch strebte er lange den Beruf eines Schauspielers an. Nach einer Schauspielausbildung und wenigen Monaten in einem Tourneetheater wurde Borchert 1941 zum Kriegsdienst in die Wehrmacht eingezogen und musste am Angriff auf die Sowjetunion teilnehmen. An der Front zog er sich schwere Verwundungen und Infektionen zu. Mehrfach wurde er wegen Kritik am Regime des Nationalsozialismus und sogenannter Wehrkraftzersetzung verurteilt und inhaftiert. Auch in der Nachkriegszeit litt Borchert stark unter den im Krieg zugezogenen Erkrankungen und einer Leberschädigung. Nach kurzen Versuchen, erneut als Schauspieler und Kabarettist aktiv zu werden, blieb er ans Krankenbett gefesselt. Dort entstanden zwischen Januar 1946 und September 1947 zahlreiche Kurzgeschichten und innerhalb eines Zeitraums von acht Tagen das Drama Draußen vor der Tür. Während eines Kuraufenthalts in der Schweiz starb er mit 26 Jahren an den Folgen seiner Lebererkrankung. Bereits zu Lebzeiten war Borchert durch die Radioausstrahlung seines Heimkehrerdramas im Januar 1947 bekannt geworden, doch sein Publikumserfolg setzte vor allem postum ein, beginnend mit der Theateruraufführung von Draußen vor der Tür am 21. November 1947, einen Tag nach seinem Tod. . Aus: wikipedia-Wolfgang_Borchert Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 114.
-
Blick durchs Fenster. Aus zehn Jahren Frankreich und England. - (=Rowohlts-Rotations-Romane, rororo 201).
Verlag: Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag 1956 (November)., 1956
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Erstausgabe
Zustand: Gut. 204 (18) Seiten. 19 cm. Einbandentwurf: Karl Gröning und Gisela Pferdmenges. Guter Zustand. Seiten papierbedingt leicht gebräunt. Besitzername auf dem Vorsatz. - 1950 führte der Rowohlt-Verlag mit der Reihe "rororo-Taschenbuch' das Taschenbuch im großen Stil in den deutschen Buchmarkt ein. Mit dieser Reihe sollten anspruchsvolle Schriftsteller, vor allem des amerikanischen und französischen Marktes in Kontakt mit den "leseunerfahrenen Massen' gebracht werden. Durch geringe Produktionskosten und moderne Vermarktungsmethoden, z. B. Zigarettenreklame im Text, war die Reihe konkurrenzlos günstig und es konnten auch unbekannte Autoren verlegt werden. - Friedrich Carl Maria Sieburg (* 18. Mai 1893 in Altena/Sauerland; 19. Juli 1964 in Gärtringen/Württemberg) war ein deutscher Journalist, Schriftsteller und Literaturkritiker. Leben - - Herkunft: Friedrich Sieburg stammte aus einer Kaufmannsfamilie. Er besuchte zunächst das Realgymnasium in Altena, danach ein humanistisches Gymnasium in Düsseldorf. Als 16-Jähriger veröffentlichte er erste Gedichte in den Düsseldorfer Nachrichten. Studium: 1912 begann er das Studium der Philosophie, Geschichte, Literatur und Nationalökonomie in Heidelberg. 1919 promovierte Sieburg in Münster in Literaturwissenschaft (Thema: Die Grade der lyrischen Formung. Beiträge zu einer Ästhetik des lyrischen Stils). Zu seinen Universitätslehrern zählten Max Weber und Friedrich Gundolf. Er hatte Verbindung zum George-Kreis. Im Ersten Weltkrieg war er zunächst als Infanterist, ab 1916 als Fliegeroffizier im Einsatz. Weimarer Republik: 1919 bis 1923 lebte Sieburg als freier Schriftsteller in Berlin, war Anhänger der Revolution und schrieb in dieser Zeit vor allem Filmkritiken. Von 1923 an war er, anfangs in loser Form, für die Frankfurter Zeitung in Kopenhagen tätig. Im Mai 1926 wurde er ihr Auslandskorrespondent in Paris. Dort entstand auch sein bekanntestes Buch Gott in Frankreich? (1929). 1930 bis 1932 war er Auslandskorrespondent in London, danach wieder in Paris. 1929 veröffentlichte Sieburg einen Artikel in der jungkonservativen Monatszeitschrift Die Tat, was man als Abkehr von der bürgerlich-liberalen Generallinie bewerten darf, die die Frankfurter Zeitung auszeichnete. 1932 veröffentlichte er auch einige Beiträge in der Täglichen Rundschau, die wie Die Tat von Hans Zehrer geleitet wurde, dessen Hinwirken auf ein Querfrontbündnis zwischen "linken" Nationalsozialisten um Gregor Strasser, Gewerkschaftern und Sozialdemokraten zur Verhinderung eines Reichskanzlers Adolf Hitler von Sieburg unterstützt wurde. In seinem Buch Es werde Deutschland, das er im November 1932 abschloss, das aber erst nach Hitlers Machtübernahme erscheinen konnte, bewegte er sich, wie sein Freund Carl Zuckmayer 1944 in seinem Geheimreport urteilte, auf einer "sehr gefährlichen und ganz verschwommenen Grenze - zwischen Nationalismus, Kritik des 'liberalen Denkens' und politischer Progressivität". Dazu gehörte allerdings auch die entschiedene Ablehnung des Antisemitismus, weshalb das Buch 1936 verboten wurde. Während der NS-Zeit: Zwar hatte sich Sieburg in der Kampfschrift Es werde Deutschland parteipolitisch noch nicht festgelegt, bekannte sich in der englischen Übersetzung, die nach der Machtergreifung erschien, aber zum Nationalsozialismus und warb tagespublizistisch im Ausland für das "neue Deutschland", wodurch er sich die Feindschaft der deutschen Emigrantenkreise zuzog. Auf der anderen Seite missbilligte er die Machtergreifung in Briefen an den Verleger Heinrich Simon, für dessen Frankfurter Zeitung er 1932-39 als Auslandskorrespondent in Paris tätig war. Für autoritäre Regime wie in Portugal und Japan fand er in den Büchern Neues Portugal (1937) und Die stählerne Blume (1939) anerkennende Worte. Die 1935 von ihm verfasste Biografie Robespierre kann nur mit Einschränkungen der Inneren Emigration zugerechnet werden. 1939 wurde Sieburg in den deutschen Auswärtigen Dienst berufen. Nach Longerich, der sich auf Max W. Clauss beruft, wurden etwa 2 Dutzend NS-nahe Journalisten im Sommer zu Ribbentrop nach Fuschl am See geholt und dort durch Friedrich Berber, der hier als Chef auftrat, ultimativ zum Auslandseinsatz als NS-Propagandisten aufgefordert. Clauss gibt an, sich verweigert zu haben, während Sieburg, Hans Georg von Studnitz und Karl Megerle sofort zusagten. Sieburg war ab Februar 1940 an der Deutschen Botschaft in Brüssel als "Sonderbeauftragter" des Auswärtigen Amtes tätig. Von 1940 bis 1942 hielt er sich im besetzten Frankreich auf und wurde 1940 Botschaftsrat in Paris. In einer später auch gedruckten Rede France d'hier et de demain vor der Groupe Collaboration im März 1941 erklärte Sieburg, er sei durch das Leben in Frankreich "'zum Kämpfer und zum Nationalsozialisten erzogen'" worden. Nach der NSDAP-Mitgliederkartei stellte er am 9. April 1941 bei der NSDAP-Auslandsorganisation einen Antrag auf Aufnahme in die NSDAP, der am 1. September 1941 bewilligt wurde. Im Fragebogen der französischen Militärregierung gab er nach dem Zweiten Weltkrieg an, nicht Mitglied der NSDAP gewesen zu sein. 1942 kehrte Sieburg nach Deutschland zurück und arbeitete wieder für die Frankfurter Zeitung bis zu ihrem Verbot 1943. Danach wechselte er zur Börsenzeitung und war Ehrenbegleiter von Marschall Henri Philippe Pétain. Nachkriegszeit: Nach Kriegsende, das er in Bebenhausen miterlebte, wurde Sieburg von der französischen Besatzungsmacht mit einem Publikationsverbot (1945-1948) belegt. Sieburgs Schriften Neues Portugal (1937) und Die rote Arktis (1932) wurden in der Sowjetischen Besatzungszone bzw. in der Deutschen Demokratischen Republik auf die Liste der auszusondernden Literatur gesetzt. 1948 wurde er Mitarbeiter, 1949 auch Mitherausgeber der Wochenzeitschrift Die Gegenwart. In seinen Büchern über Frankreich distanzierte er sich jetzt stark vom Nationalsozialismus, nahm Abstand von einem deutschen Sonderbewusstsein und pries die moderne französische Literatur. Seit 1956 für die Frankfurter Allgemeine Zeitung tä.
-
Nur für Leser. Jahre und Bücher. Mit Texten über Thomas Mann, Ernst Wiechert, Friedrich Nietzsche, Franz Kafka, Klaus Mann, Samuel Johnson, Guy de Maupassant, Montaigne, Sartre, Stefan Zweig u.v.a. Mit einem Register. - (=dtv, Band 3).
Verlag: München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1961
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Zustand: Gut. Taschenbucherstausgabe. 246 (10) Seiten. 18 cm. Austattung: Celestino Piatti. Guter Zustand. Besitzername auf dem Vorsatz. - Friedrich Carl Maria Sieburg (* 18. Mai 1893 in Altena/Sauerland; 19. Juli 1964 in Gärtringen/Württemberg) war ein deutscher Journalist, Schriftsteller und Literaturkritiker. Leben - Herkunft: Friedrich Sieburg stammte aus einer Kaufmannsfamilie. Er besuchte zunächst das Realgymnasium in Altena, danach ein humanistisches Gymnasium in Düsseldorf. Als 16-Jähriger veröffentlichte er erste Gedichte in den Düsseldorfer Nachrichten. Studium: 1912 begann er das Studium der Philosophie, Geschichte, Literatur und Nationalökonomie in Heidelberg. 1919 promovierte Sieburg in Münster in Literaturwissenschaft (Thema: Die Grade der lyrischen Formung. Beiträge zu einer Ästhetik des lyrischen Stils). Zu seinen Universitätslehrern zählten Max Weber und Friedrich Gundolf. Er hatte Verbindung zum George-Kreis. Im Ersten Weltkrieg war er zunächst als Infanterist, ab 1916 als Fliegeroffizier im Einsatz. Weimarer Republik: 1919 bis 1923 lebte Sieburg als freier Schriftsteller in Berlin, war Anhänger der Revolution und schrieb in dieser Zeit vor allem Filmkritiken. Von 1923 an war er, anfangs in loser Form, für die Frankfurter Zeitung in Kopenhagen tätig. Im Mai 1926 wurde er ihr Auslandskorrespondent in Paris. Dort entstand auch sein bekanntestes Buch Gott in Frankreich? (1929). 1930 bis 1932 war er Auslandskorrespondent in London, danach wieder in Paris. 1929 veröffentlichte Sieburg einen Artikel in der jungkonservativen Monatszeitschrift Die Tat, was man als Abkehr von der bürgerlich-liberalen Generallinie bewerten darf, die die Frankfurter Zeitung auszeichnete. 1932 veröffentlichte er auch einige Beiträge in der Täglichen Rundschau, die wie Die Tat von Hans Zehrer geleitet wurde, dessen Hinwirken auf ein Querfrontbündnis zwischen "linken" Nationalsozialisten um Gregor Strasser, Gewerkschaftern und Sozialdemokraten zur Verhinderung eines Reichskanzlers Adolf Hitler von Sieburg unterstützt wurde. In seinem Buch Es werde Deutschland, das er im November 1932 abschloss, das aber erst nach Hitlers Machtübernahme erscheinen konnte, bewegte er sich, wie sein Freund Carl Zuckmayer 1944 in seinem Geheimreport urteilte, auf einer "sehr gefährlichen und ganz verschwommenen Grenze - zwischen Nationalismus, Kritik des 'liberalen Denkens' und politischer Progressivität". Dazu gehörte allerdings auch die entschiedene Ablehnung des Antisemitismus, weshalb das Buch 1936 verboten wurde. Während der NS-Zeit: Zwar hatte sich Sieburg in der Kampfschrift Es werde Deutschland parteipolitisch noch nicht festgelegt, bekannte sich in der englischen Übersetzung, die nach der Machtergreifung erschien, aber zum Nationalsozialismus und warb tagespublizistisch im Ausland für das "neue Deutschland", wodurch er sich die Feindschaft der deutschen Emigrantenkreise zuzog. Auf der anderen Seite missbilligte er die Machtergreifung in Briefen an den Verleger Heinrich Simon, für dessen Frankfurter Zeitung er 1932-39 als Auslandskorrespondent in Paris tätig war. Für autoritäre Regime wie in Portugal und Japan fand er in den Büchern Neues Portugal (1937) und Die stählerne Blume (1939) anerkennende Worte. Die 1935 von ihm verfasste Biografie Robespierre kann nur mit Einschränkungen der Inneren Emigration zugerechnet werden. 1939 wurde Sieburg in den deutschen Auswärtigen Dienst berufen. Nach Longerich, der sich auf Max W. Clauss beruft, wurden etwa 2 Dutzend NS-nahe Journalisten im Sommer zu Ribbentrop nach Fuschl am See geholt und dort durch Friedrich Berber, der hier als Chef auftrat, ultimativ zum Auslandseinsatz als NS-Propagandisten aufgefordert. Clauss gibt an, sich verweigert zu haben, während Sieburg, Hans Georg von Studnitz und Karl Megerle sofort zusagten. Sieburg war ab Februar 1940 an der Deutschen Botschaft in Brüssel als "Sonderbeauftragter" des Auswärtigen Amtes tätig. Von 1940 bis 1942 hielt er sich im besetzten Frankreich auf und wurde 1940 Botschaftsrat in Paris. In einer später auch gedruckten Rede France d'hier et de demain vor der Groupe Collaboration im März 1941 erklärte Sieburg, er sei durch das Leben in Frankreich "'zum Kämpfer und zum Nationalsozialisten erzogen'" worden. Nach der NSDAP-Mitgliederkartei stellte er am 9. April 1941 bei der NSDAP-Auslandsorganisation einen Antrag auf Aufnahme in die NSDAP, der am 1. September 1941 bewilligt wurde. Im Fragebogen der französischen Militärregierung gab er nach dem Zweiten Weltkrieg an, nicht Mitglied der NSDAP gewesen zu sein. 1942 kehrte Sieburg nach Deutschland zurück und arbeitete wieder für die Frankfurter Zeitung bis zu ihrem Verbot 1943. Danach wechselte er zur Börsenzeitung und war Ehrenbegleiter von Marschall Henri Philippe Pétain. Nachkriegszeit: Nach Kriegsende, das er in Bebenhausen miterlebte, wurde Sieburg von der französischen Besatzungsmacht mit einem Publikationsverbot (1945-1948) belegt. Sieburgs Schriften Neues Portugal (1937) und Die rote Arktis (1932) wurden in der Sowjetischen Besatzungszone bzw. in der Deutschen Demokratischen Republik auf die Liste der auszusondernden Literatur gesetzt. 1948 wurde er Mitarbeiter, 1949 auch Mitherausgeber der Wochenzeitschrift Die Gegenwart. In seinen Büchern über Frankreich distanzierte er sich jetzt stark vom Nationalsozialismus, nahm Abstand von einem deutschen Sonderbewusstsein und pries die moderne französische Literatur. Seit 1956 für die Frankfurter Allgemeine Zeitung tätig, war er bis zu seinem Tode einer der bedeutendsten Zeit- und Literaturkritiker Deutschlands. Insbesondere Sieburgs meisterhafte Inhaltswiedergaben, in denen er die Kritik souverän vorwegnimmt, und damit jegliche abschließende Argumentation überflüssig macht, gelten als unübertroffen. 1953 ernannte ihn das Land Baden-Württemberg zum Professor. Seit 1956 war er ein ordentliches Mitglied der Akademie der Künste Berlin. Friedrich Sieburg unterstützte die Adenauer-Regierung, war ein Gegner der Nachkriegsliteratur und kritisierte die Gruppe 47 mehrfach.
-
Das verschüttete Antlitz. Roman. Mit einem Nachwort der Verfasserin. - (=dtv 10029).
Verlag: München : Deutscher Taschenbuch-Verlag, 1982
ISBN 10: 342310029X ISBN 13: 9783423100298
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Zustand: Gut. 42. - 45. Tausend. 4. Auflage. 216 (9) Seiten. 18 cm. Umschlaggestaltung: Celestino Piatti. Guter Zustand. Besitzername auf dem Vortitel. Ein Arzt wird des Mordes an einem jungen Mädchen verdächtigt. Die Indizien sprechen gegen ihn, reichen aber für die Erhebung einer Anklage nicht aus. Der junge Mann wird aus der Untersuchungshaft entlassen und lebt mit dem Makel des Mörders behaftet weiter, obwohl er den wahren Täter kennt . Ein Kriminalfall als Ausgangspunkt für einen spannungsgeladenen Roman über Menschen aus dem alten Prag und dem ländlichen Nordböhmen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. - Gertrud Fussenegger (* 8. Mai 1912 in Pilsen, Böhmen, Österreich-Ungarn; 19. März 2009 in Linz), (vollständiger Name Gertrud Anna Fussenegger, auch Gertrud Dietz bzw. Dorn, Pseudonym Anna Egger war eine österreichische Schriftstellerin. Aufgrund ihres Wirkens in der Zeit des Nationalsozialismus blieb Fussenegger bis zu ihrem Tod umstritten. Leben: Fussenegger wurde als Tochter des k.u.k. Offiziers Emil Fussenegger geboren und wuchs in Neu Sandez (Galizien), Dornbirn und Telfs auf, ehe sie nach dem Tod ihrer Mutter 1926 wieder nach Pilsen (zu dieser Zeit Tschechoslowakei) zog, wo sie im Sommer 1930 ihre Matura ablegte. Anschließend studierte sie zunächst an der Universität Innsbruck und in München Geschichtswissenschaft, Kunstgeschichte und Philosophie und wurde 1934 in Innsbruck bei Harold Steinacker zum Dr. phil. promoviert. Bereits im Mai 1933 trat sie angeblich der österreichischen NSDAP bei. Nachdem sie bei einer Demonstration im Mai 1934 in Innsbruck das Horst-Wessel-Lied gesungen und den Hitlergruß dargeboten hatte, wurde sie zu einer Geldstrafe verurteilt. Im Februar 1935 gehörte sie noch einer österreichischen NS-Studentinnengruppe an, wechselte aber im November desselben Jahres ins Deutsche Reich. Nach dem Anschluss Österreichs" beantragte sie am 4. August 1938 die Aufnahme in die NSDAP, wurde rückwirkend zum 1. Mai desselben Jahres aufgenommen (Mitgliedsnummer 6.229.747) und huldigte Hitler mit einem Hymnus. Später lebte sie in München, von wo sie 1943 wegen der Bombardierungen mit den Kindern nach Hall in Tirol übersiedelte. 1961 zog sie nach Leonding bei Linz. In erster Ehe war sie von 1935 bis zur Scheidung 1947 mit dem Bildhauer Elmar Dietz verheiratet, in zweiter Ehe (seit 1950) mit dem Bildhauer Alois Dorn. Da meine zweite Ehe nur standesamtlich geschlossen war, war ich sehr lange von den Sakramenten ausgeschlossen. Das habe ich als tief schmerzlich empfunden, doch es war ein Schmerz, der auch sehr fruchtbar für mich geworden ist. Nur so ist mir die ganze Kostbarkeit der Eucharistie bewusst geworden. Ich kann es nicht bedauern, dass ich in jener Zeit oft bittere Tränen vergossen habe. Genau genommen war ich beschenkt durch das Verbot." Sie hatte vier Kinder Ricarda, Traudi, Dorothea und Raimund aus erster Ehe, einen zweiten Sohn, Lukas, aus der zweiten Ehe. Gertrud Fussenegger war Mitglied des Österreichischen P.E.N. Clubs, der Humboldt-Gesellschaft, der Sudetendeutschen Akademie und Ehrenmitglied des österreichischen Schriftstellerverbandes. In den Jahren 1977 bis 1979 und 1984 bis 1985 war sie Jury-Mitglied beim Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt. 1991 war sie Jury-Mitglied beim Franz-Grillparzer-Preis der Alfred Toepfer Stiftung F.V.S., was zu heftigen Kontroversen wegen ihrer und des Stifters Vergangenheit führte. 1978 erhielt sie die Humboldt-Plakette als Ehrengabe verliehen. Der Nachlass ihrer Werke befindet sich im Oberösterreichischen Literaturarchiv im Stifterhaus in Linz. Nachkriegszeit: In der Sowjetischen Besatzungszone wurden ihre Schriften Der Brautraub (1939) und Böhmische Verzauberungen (1944) auf die Liste der auszusondernden Literatur gesetzt. Auch in Wien wurden 1946 einige ihrer Werke auf die Liste der gesperrten Autoren und Bücher" gesetzt. Noch 1952 schrieb Fussenegger ganz in der Terminologie der nationalsozialistischen Rassenlehre , sie gehöre einer Rasse an, die hellhäutig, helläugig, empfindlich gegen die Wirkung des Lichts, ein Mischtyp aus nordischen und dinarischen Zügen" zu sein scheine. In der Nachkriegszeit setzte sich Fussenegger immer wieder mit der deutschen Schuldfrage auseinander. Der Literaturwissenschaftler Klaus Amann bezeichnete ihre Autobiographie von 1979 Ein Spiegelbild mit Feuersäule als insgesamt ein peinliches Dokument der Verdrängung und der Verstocktheit". . Ihre Mohrenlegende, einerseits von Nationalsozialisten als katholisches Machwerk" und als Mitleidwerbung für Andersrassige" verunglimpft, die unvereinbar mit unseren Auffassungen von den Rassegesetzen" sei, andererseits im Zuge der Vergangenheitsaufarbeitung in Österreich später als rassistisch" verurteilt, wurde in der BRD unverändert neu aufgelegt und 1988 von Gernot Friedel verfilmt. Fussenegger veröffentlichte in den folgenden Jahren außerdem Gedichte, Erzählungen und Theaterstücke. Ihr Roman Das verschüttete Antlitz behandelt die Vertreibung der Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei aufgrund der Bene-Dekrete. Pilatus, ein Oratorium mit Musik von Cesar Bresgen, wurde 1979 beim Carinthischen Sommer in Ossiach uraufgeführt. 1996 fand am Landestheater Linz die Uraufführung der Oper Kojiki Tage der Götter von Mayuzumi Toshiro statt, für die Fussenegger das Libretto bearbeitete. . . . Aus: wikipedia-Gertrud_Fussenegger. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 164 Taschenbuch. Kartoniert. Laminiert. Glanzfolienkaschierung.
-
Der veruntreute Himmel. Die Geschichte einer Magd. Roman. Mit einer Kurzbiografie des Autors.
Verlag: [Gütersloh], Bertelsmann Lesering, 1959
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Zustand: Gut. Lizenzausgabe des S. Fischer Verlags. 254 (2) Seiten. 19 cm. Einbandentwurf: S. Kortemeier und Karl Hartig. Sehr guter Zustand. Dekoratives Exemplar. Fußschnitt leicht fleckig. Die Magd Teta Linek hat bei aller Einfachheit ihres Verstandes einen festen Lebensplan und den unbeugsamen Willen zur Unsterblichkeit und Seligwerdung. Um sich einen Platz im Himmel für alle Ewigkeit zu sichern, versucht sie durch einen Mittler, den Sohn ihres einzigen Bruders Mojmir, sich dort einzukaufen; denn hat nicht auch der Herrgott einen Mittler zu den Menschen gesandt, um ihnen auf den Weg zur Seligkeit zu helfen? Teta meint, nur gute Werke gelte es dafür zu tun. So unterstützt sie mit ihren Ersparnissen das Studium ihres Neffen, ohne freilich Liebe für ihn zu empfinden oder überhaupt ein persönliches Interesse an ihm zu nehmen, ja ohne ihn über dreißig Jahre lang zu sehen. Es genügt ihr, wenn er als Priester durch das Lesen heiliger Messen für ihr Seelenheil sorgt. Aber Mojmir ist keineswegs Priester geworden: er ist ein Hallodri, ein Schwindler und Betrüger und treibt sein Spiel auf die Spitze, indem er der Tante vorgaukelt, in ihrer beider Geburtsort eine Pfarrstclle zu erhalten und sie zu sich nehmen zu wollen. Sie reist dorthin und muß erkennen, daß alle seine Beteuerungen erlogen waren und sie ihre Seligkeit beim Teufel eingekauft hat. Sie glaubt, jetzt Gottes strenges Urteil erwarten zu müssen. Aber mit der ihr eigenen Härte, die zugleich eine Angst vor dem eigenen Gefühl ist, rafft sie sich auf und versucht die Ausführung ihres Lebcnsplans dennoch durchzusetzen, indem sie aufs neue gute Werke tun will: auf einer Pilgerfahrt nach Rom lernt sie einen jungen Priester kennen; dem will sie als Magd dienen; doch während einer Audienz beim schwerkranken Papst Pius XI. bricht sie zusammen und stirbt kurz darauf. Werfel hat seinen Roman »eine Groteske, in der sich eine Legende verschlingt«, genannt und die Frage aufgeworfen, inwiefern ein Mensch - aus Furcht vor der Wahrheit - in die Schuld eines anderen mit verstrickt sein kann. Die Quintessenz dieses Romans lautet: »Der veruntreute Himmel ist der große Fehlbetrag unserer Zeit.« - Aus wikipedia-Franz_Werfel: Franz Viktor Werfel (* 10. September 1890 in Prag; 26. August 1945 in Beverly Hills, Kalifornien) war ein deutschböhmischer Schriftsteller. Er war ein Wortführer des Expressionismus. In den 1920er und 1930er Jahren waren seine Bücher Bestseller. Seine Popularität beruht vor allem auf seinen erzählenden Werken und Theaterstücken, über die aber Werfel selbst seine Lyrik setzte. Leben: Franz Werfel wurde 1890 in Prag als Sohn des wohlhabenden Handschuhfabrikanten Rudolf Werfel und dessen Frau Albine, geb. Kussi, geboren. Die Familie gehörte dem deutschböhmischen Judentum an. Die Frömmigkeit seiner tschechischen Kinderfrau, der Besuch der Privatvolksschule der Piaristen und die barocke Katholizität seiner Heimatstadt prägten den jungen Werfel. Seine Reifeprüfung legte Werfel 1909 am Deutschen Gymnasium Stefansgasse in Prag ab. Schon während seiner Schulzeit veröffentlichte er Gedichte. Mit den Schriftstellern Willy Haas, Ernst Deutsch, Max Brod und Franz Kafka sowie mit dem Literaturagenten Ernst Polak, seinem ehemaligen Mitschüler, war Werfel ein Leben lang befreundet. Volontär und Lektor: 1910 absolvierte Werfel ein Volontariat bei einer Hamburger Speditionsfirma. Zwischen 1911 und 1912 leistete er Militärdienst auf dem Prager Hradschin. Von 1912 bis 1915 war er Lektor beim Kurt-Wolff-Verlag in Leipzig. Unter seiner Mitverantwortung erschien die expressionistische Schriftenreihe Der jüngste Tag. Werfel begegnete Rainer Maria Rilke und schloss Freundschaft mit Walter Hasenclever und Karl Kraus, mit dem er sich später überwarf. Er publizierte u. a. auch in der ungarischen deutschsprachigen Zeitung Pester Lloyd. Erster Weltkrieg: Zwischen 1915 und 1917 diente Werfel an der ostgalizischen Front. 1917 wurde er ins Wiener Kriegspressequartier versetzt. Alma Mahler: Werfel lebte die folgenden zwei Jahrzehnte in Wien und schloss hier Freundschaft mit Alma Mahler, der Witwe Gustav Mahlers und der Ehefrau von Walter Gropius. Unter Almas Einfluss zog er sich weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück, ging aber oft auf Reisen, so z. B. nach Breitenstein am Semmering, Santa Margherita Ligure und nach Venedig. Während einer Nahostreise Ende der zwanziger Jahre traf er in einem Waisenhaus in Syrien Überlebende des Völkermordes an den Armeniern während des Ersten Weltkrieges. Diese Begegnung inspiriert ihn zu seinem Roman Die vierzig Tage des Musa Dagh, in dem das Schicksal von etwa 5000 Armeniern geschildert wird, die sich vor den Jungtürken auf den Berg Musa Dagi geflüchtet hatten. 1918 brachte Alma seinen Sohn Martin Carl Johannes zur Welt, der 1919 verstarb. Am 7. August 1929 heiratete Werfel Alma Mahler, die von Walter Gropius geschieden worden war. Sie war eine Frau von gewaltigem Kunstverstand und Kunstinstinkt. Wenn sie von jemandes Talent überzeugt war, ließ sie für dessen Inhaber mit einer oft an Brutalität grenzenden Energie gar keinen anderen Weg mehr offen als den der Erfüllung.". So spornte sie vermutlich auch Franz Werfel an. Am Höhepunkt seiner amerikanischen Bestsellererfolge sagte er zu seinem Freund Friedrich Torberg: Wenn ich die Alma nicht getroffen hätte ich hätte noch hundert Gedichte geschrieben und wäre selig verkommen." Laut Torberg hatte Werfel oft und oft davon gesprochen, wie unvorstellbar ein Leben ohne Alma für ihn gewesen wäre." 1935 starb seine an Kinderlähmung erkrankte Stieftochter Manon Gropius. Emigration: Nach dem Anschluss" Österreichs ließ sich Werfel, der sich schon im Winter 1937/1938 mit seiner Frau im Ausland aufgehalten hatte und nach dem Anschluss nicht mehr zurückkehrte, mit Alma in Sanary-sur-Mer in Südfrankreich nieder, wo auch andere Emigranten lebten. 1940, als die Wehrmacht große Teile Frankreichs besetzte, fand er Zuflucht in Lourdes, und Werfel gelobte, falls er gerettet würde, ein Buch über die heilige Bernadette zu schreiben. Zu Fuß übe.
-
Provoziertes Leben. Eine Auswahl aus den Prosaschriften. Quellenhinweis. - (=Ullstein Bücher, Nr. 54).
Verlag: Frankfurt am Main, Berlin, Wien: Ullstein Verlag, 1957
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Zustand: Gut. 3. Auflage. 180 (4) Seiten. 18 cm. Umschlagentwurf: Dieter Oestreich. Guter Zustand. Besitzerstempel auf dem Vorsatz. Aus dem Klappentext: Benns Prosa ist gefährlich; wer sich mit ihr einlässt, muss damit rechnen, dass er von ihr verändert wird. Gleichgültig, ab man seinen scharfen Thesen zustimmt - man kann an ihnen nicht vorübergehen. Alle seine Sätze sind Prüfsteine, die in die tiefste Krisis hineinreissen, die eine Entscheidung geradezu aufzwingen. Sie stellen mit einem Wort "existentielle Prosa" dar. - Gottfried Benn (* 2. Mai 1886 in Mansfeld, Brandenburg; 7. Juli 1956 in Berlin) war ein deutscher Arzt, Dichter und Essayist. . Gottfried Benn gilt als einer der bedeutendsten deutschen Dichter der literarischen Moderne. Ein erstes Mal betrat er die literarische Szene als Expressionist mit seinen Morgue-Gedichten, die mit herkömmlichen poetischen Traditionen radikal brachen und in denen vor allem Eindrücke aus seiner Tätigkeit als Arzt starken Niederschlag fanden. Sektionen und Krebs- und Geburtsstationen werden scheinbar emotionslos beschrieben, und romantische Titel wie Kleine Aster" wecken Erwartungen, die dann krass enttäuscht werden. Nach dem oben genannten Gedichtband erschienen in der Folgezeit nur noch wenige mit äußerst geringer Auflage; während der Nazizeit unterlag Benn einem Schreibverbot. Vom Nationalsozialismus, mit dem er zuerst sympathisiert hatte, wandte sich Benn wohl vor allem ab, weil er ihn schließlich als ähnlich antikulturell einschätzte wie den Kommunismus und Sozialismus. Nach Kriegsende wurde er zunächst wegen seiner anfänglichen Unterstützung des Hitlerregimes angefeindet, doch spätestens mit seinen Statischen Gedichten, die sich weit vom wild-zynischen Ton der Morgue-Gedichte entfernt hatten, fand er in der jungen Bundesrepublik ein neues, stetig wachsendes Publikum. So wurde der Autor zum Ende hin ein weitberühmter, mit dem Büchner-Preis ausgezeichneter und stilbildender Dichter. . Aus: wikipedia-Gottfried_Benn Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 160 Illustrierter Karton. Taschenbuch. Kartoniert. Laminiert. Glanzfolienkaschierung.
-
Die acht Gesichter am Biwasee. - (=Ullstein ; Nr. 20764).
Verlag: Frankfurt/M ; Berlin : Ullstein Verlag, 1987
ISBN 10: 3548207642 ISBN 13: 9783548207643
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Taschenbuch. Kartoniert. Zustand: Sehr gut. Erste Auflage dieser Ausgabe. 162 (6) Seiten. 17,7 cm. Umschlaggestaltung: Theodor Bayer-Eynck. Sehr guter Zustand. Acht japanische Liebesgeschichten von Max Dauthendey rund um den größten See Japans mit erotischen Folgen. - Max Dauthendey (* als Maximilian Albert Dauthendey am 25. Juli 1867 in Würzburg; 29. August 1918 in Malang auf Java) war ein deutscher Dichter und Maler. . Leistungen und Rezeption: Die von Farben und Tönen bestimmte ungebundene und rhythmische Lyrik und Prosa machte Dauthendey zu einem der bedeutendsten Vertreter des Impressionismus in Deutschland. Seine Werke sind bestimmt von der Liebe zur Natur und deren Ästhetik. Mit virtuoser Sprachbegabung setzte er seine Sensibilität für sinnenhafte Eindrücke in impressionistische Wortkunstwerke um. Über seine Gedichte sagte Stefan George, sie seien das einzige, was jetzt in der ganzen Literatur als vollständig Neues dastehe [] eine eigenartige Kunst, die reicher genießen lasse als Musik und Malerei, da sie beides zusammen sei." Bereits seine erste Gedichtsammlung von 1893 mit dem Titel Ultra-Violett" lässt die Ansätze einer impressionistischen Bildkraft erkennen, die dichterisch gestaltete Wahrnehmung von Farben, Düften, Tönen und Stimmungen offenbart. In seiner späteren Natur- und Liebenslyrik steigerte sich dies bis zur Verherrlichung des Sinnenhaften und Erotischen und traf sich mit seiner Philosophie, die das Leben und die Welt als Fest, als panpsychische Weltfestlichkeit" begriff. Rilke bezeichnete ihn als einen unserer sinnlichsten Dichter, in einem fast östlichen Begriffe" Die Novellen als lyrisch-impressionistische Stimmungsbilder mit persönlichen Reiseerfahrungen lassen Frische und erzählerische Lust verspüren. Die Sammlungen Lingam" (1909) und Die acht Gesichter vom Biwasee" (1911) markieren den künstlerischen Höhepunkt seines Werkes. Nicht so erfolgreich waren die Romane Dauthendeys, denen teilweise eine konsequente Handlungsführung fehlt und die unter dem Mangel einer individuellen Personengestaltung leiden. Neben den Reiseschilderungen können vor allem die autobiographischen Schriften literarische und historische Bedeutung für sich in Anspruch nehmen. Seine typische Technik, Bilder und Szenen farbig, improvisierend und achronologisch aneinanderzureihen, unterstreicht und steigert hier die Wirkung des erzählerischen Inhalts. Mit der farbigen Bildersprache der frühen Werke setzte Dauthendey sich vom Naturalismus ab und ging mit seiner Sprachdynamik und teilweise radikalen Abstraktion der späteren Werke auch über die impressionistischen Gestaltungsmittel hinaus, so dass er als einer der Vorläufer des literarischen Expressionismus gelten kann. In der späteren Lyrik wurden allerdings stellenweise auch ornamental-dekorative Muster bemüht, die zu einer sprachlichen Verflachung führten. In der Zeit des Nationalsozialismus stießen Dauthendeys Werk und Person auf offizielle Ablehnung. So stellte einer der tonangebenden Literaturhistoriker in der NS-Zeit, Adolf Bartels, mit Blick auf die fernöstlichen Handlungsorte der dauthendeyschen Novellen und Erzählungen fest, dass der Verfasser nun als Exotist gelten" muss. August Diehl als Landesleiter der Reichsschrifttumskammer in Mainfranken fällte im Mainfränkischen Kalender" von 1937, dem amtlichen Jahrbuch der NSDAP im Gau Mainfranken, das parteiamtliche Verdikt über Dauthendey als Dichter mit dem nie versiegende[n], fast ausschliessliche[n] Grundthema einer ganz ungermanischen Verherrlichung der Geschlechtsliebe als einer kosmischen Brunst." Am entschiedensten wurde der Dichter-Philosoph und seine Weltfestlichkeit" abgelehnt, die jedem völkischen Gemeinschaftssinn zuwiderlaufe. Ihr Prophet Dauthendey wurde damit zum Gegenfüßler [der] nationalsozialistischen Weltanschauung" erklärt. Heute zählt sein Werk nicht nur zu den fränkischen Klassikern, sondern hat auch in der deutschen Literatur einen festen Platz. . . Aus: wikipedia-Max_Dauthendey. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 101.
-
Gottfried Benn in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Mit Zeittafel, Zeugnisse, Bibliographie und Register. Den dokumentarischen und bibliographischen Anhang bearbeitete Paul Raabe. - (=Rowohlts Monographien, herausgegeben von Kurt Kusenberg, Band rm 71).
Verlag: Reinbek bei Hamburg, Rowohlt-Taschenbuch-Verlag, 1962
ISBN 10: 349950071X ISBN 13: 9783499500718
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Erstausgabe
Zustand: Befriedigend. Erstausgabe. 179 (1) Seiten mit vielen Abbildungen. Einbandentwurf: Werner Rebhuhn. Guter Zustand. Die einschlägige Forschung hat über alle Zweifel hinaus nachgewiesen, welche Fülle von Genie und Hochbegabung in mehr als vier Jahrhunderten aus dem protestantischen Pfarrhaus hervorgegangen ist. Mit Recht war also Gottfried Benn auf diese Herkunft stolz und ist in seinem Werk verschiedentlich auf sie eingegangen, am ausführlichsten in den Jahren 1933/34, als er sich genötigt sah, gegen den Vorwurf "nichtarischer" Abstammung. - Gottfried Benn (* 2. Mai 1886 in Mansfeld, Brandenburg; 7. Juli 1956 in Berlin) war ein deutscher Arzt, Dichter und Essayist. . Gottfried Benn gilt als einer der bedeutendsten deutschen Dichter der literarischen Moderne. Ein erstes Mal betrat er die literarische Szene als Expressionist mit seinen Morgue-Gedichten, die mit herkömmlichen poetischen Traditionen radikal brachen und in denen vor allem Eindrücke aus seiner Tätigkeit als Arzt starken Niederschlag fanden. Sektionen und Krebs- und Geburtsstationen werden scheinbar emotionslos beschrieben, und romantische Titel wie Kleine Aster" wecken Erwartungen, die dann krass enttäuscht werden. Nach dem oben genannten Gedichtband erschienen in der Folgezeit nur noch wenige mit äußerst geringer Auflage; während der Nazizeit unterlag Benn einem Schreibverbot. Vom Nationalsozialismus, mit dem er zuerst sympathisiert hatte, wandte sich Benn wohl vor allem ab, weil er ihn schließlich als ähnlich antikulturell einschätzte wie den Kommunismus und Sozialismus. Nach Kriegsende wurde er zunächst wegen seiner anfänglichen Unterstützung des Hitlerregimes angefeindet, doch spätestens mit seinen Statischen Gedichten, die sich weit vom wild-zynischen Ton der Morgue-Gedichte entfernt hatten, fand er in der jungen Bundesrepublik ein neues, stetig wachsendes Publikum. So wurde der Autor zum Ende hin ein weitberühmter, mit dem Büchner-Preis ausgezeichneter und stilbildender Dichter. . Aus: wikipedia-Gottfried_Benn. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 142 19 cm. Taschenbuch. Kartoniert.
-
Antike Kameen. 32 farbige Tafeln. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Oleg Newerow. Aus dem Russischen von Gerd Philipps und Sergej Daniltschenko. Farbaufnahmen: I.D. Nikolajew. - (=Insel-Bücherei, Nr. IB 1045).
Verlag: Leipzig, Insel Verlag Anton Kippenberg, 1985
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Zustand: Wie neu. 2. Auflage. 54 (2) Seiten mit vielen Abbildungen. Überzugspapier Jenne 106. Sehr guter Zustand. Frisches Exemplar. Wie ungelesen. Aus dem Besitz der Kunsthistorikerin Barbara Göpel. Beiliegend: Postkarte: Aachener Domschatz: Lotharkreuz ca. 990 n.Ch. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 138 18,4 cm. Illustrierter Pappband mit Schmuckpapierbezug und montiertem Deckel- und Rückenschild.
-
Das Duell der Pferde. Erzählungen. - (=dtv, Band 273).
Verlag: München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1965
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Erstausgabe
Zustand: Gut. Taschenbucherstausgabe. 149 (3) Seiten. 18 cm. Umschlaggestaltung: Celestino Piatti. Guter Zustand. - Georg Josef Britting (* 17. Februar 1891 in Regensburg; 27. April 1964 in München) war ein deutscher Schriftsteller. Sein Schaffen wurde vom literarischen Expressionismus beeinflusst; gelegentlich wird es dem Magischen Realismus zugeordnet: In scheinbar idyllischen Bildern entwickeln sich oft unwirklich anmutende, verstörende, bisweilen groteske und erschreckende Handlungen. Britting schrieb nicht in Mundart; seine künstlerisch komponierte Sprache spiegelt jedoch in Satzbau und Wortwahl Eigenheiten des süddeutschen Idioms. Leben: Georg Britting wurde in der Alten Manggasse in Regensburg geboren; aufgewachsen ist er in der Engelburgergasse nahe der Donau (daher die von ihm selbst genährte Legende, er sei auf einer Donauinsel" zur Welt gekommen). Ab 1911 publizierte er Gedichte, Feuilletons, Buch- und Schauspielrezensionen in den liberalen Regensburger Neuesten Nachrichten. 1913 wurde sein verschollener Einakter-Zyklus An der Schwelle im Stadttheater Regensburg uraufgeführt. Im selben Jahr begann Britting ein Studium an der Königlichen Akademie für Landwirtschaft und Brauerei in Weihenstephan. 1914 zog er als Freiwilliger in den Ersten Weltkrieg. 1918 kehrte er nach Regensburg zurück, schloss sich einem Arbeiter- und Soldatenrat an und wurde Schauspielrezensent der sozialdemokratischen Neuen Donau-Post (ab 1920 Volkswacht für Oberpfalz und Niederbayern). Zusammen mit dem Maler Josef Achmann (18851958) gab er Die Sichel heraus, eine Zeitschrift für Dichtung und Grafik. Hier erschien u.a. die erste Fassung von Brittings Erzählung Marion. 1921 wurde Die Sichel wegen Inflation eingestellt; Britting folgte Josef Achmann nach München und arbeitete als freier Schriftsteller. Seine Stücke Das Storchennest (1922), Die Stubenfliege (UA München 1923) und Paula und Bianka (UA Dresden 1928) fanden dabei weniger Resonanz als seine Gedichte und Erzählungen, von denen einige mehrfach in Zeitungen und Zeitschriften nachgedruckt wurden und auch Eingang in Lese- und Schulbücher fanden. 1932 veröffentlichte Britting mit dem Lebenslauf eines dicken Mannes, der Hamlet hieß seinen einzigen Roman. Während der Zeit des Nationalsozialismus publizierte er regelmäßig in der von Paul Alverdes und Karl Benno von Mechow herausgegebenen Literaturzeitschrift Das Innere Reich. 1946 heiratete er die Schauspielerin Ingeborg Fröhlich. Ab 1951 wohnte er mit ihr am Sankt-Anna-Platz in München, wo er auch starb. Zu seinem Münchner Freundeskreis zählten u.a. die Kollegen Eugen Roth, Georg von der Vring und Curt Hohoff. In der Bayerischen Akademie der Schönen Künste arbeitete Britting mit Clemens Podewils zusammen und förderte junge Autoren wie Cyrus Atabay, Heinz Piontek und Albert von Schirnding. . . . Aus: wikipedia-Georg_Britting. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 122 Taschenbuch. Kartoniert. Laminiert. Glanzfolienkaschierung.
-
Säure. Gedichte. Mit einer Grafik des Autors. - (=Fischer-Taschenbücher 5122).
Verlag: Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verlag, 1981
ISBN 10: 3596251222 ISBN 13: 9783596251223
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Erstausgabe
Taschenbuch. Kartoniert. Zustand: Gut. Taschenbucherstausgabe. 115 (13) Seiten mit einer Abbildung. 18 cm. Umschlagentwurf: Jan Buchholz und Reni Hinsch. Guter Zustand. Seiten papierbedingt leicht gebräunt. - Christoph Meckel (* 12. Juni 1935 in Berlin; 29. Januar 2020 in Freiburg im Breisgau war ein deutscher Schriftsteller und Grafiker. Leben: Christoph Meckel, Sohn des Schriftstellers Eberhard Meckel und Enkel des Architekten Carl Anton Meckel, verbrachte Kindheit und Jugend in Freiburg im Breisgau, wo er das Gymnasium bis zur Unterprima besuchte. 1954/55 studierte er Grafik an der Kunstakademie in Freiburg im Breisgau, 1956 an der Akademie der Bildenden Künste München. Seit 1956 arbeitet er als Schriftsteller und Grafiker. Er unternahm ausgedehnte Reisen durch Europa, Afrika und Amerika und lebte in Ötlingen im Markgräflerland, in Berlin, in Südfrankreich und in der Toskana. Meckel war bis 1997 Mitglied des PEN-Zentrums der Bundesrepublik Deutschland. Er ist Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Christoph Meckel lebt heute wieder in Ötlingen und in der Kleinstadt Rémuzat bei Nyons, Département Drôme in Südostfrankreich. In seinem Bericht" Ein unbekannter Mensch (1997) erscheint Rémuzat als Villededons". Werk: Meckels biografische Daten sind Teil seines künstlerischen Werks. So behauptete er 1992 im Bericht zur Entstehung einer Weltkomödie, der Schriftsteller Christoph Meckel hätte eine andere Biographie als der Grafiker. Die Auseinandersetzung mit seinem Vater und dessen Generation im Nationalsozialismus und im Krieg prägte Meckel und wird am deutlichsten im Werk Suchbild. Über meinen Vater (1980). Ebenso intensiv setzte er sich 22 Jahre später in Suchbild: meine Mutter (2002) mit seiner Mutter auseinander, von der er sich zeitlebens ungeliebt fühlte, und der er geistige Enge und Frigidität vorwarf. Meckels grafisches Werk rankt sich um die Weltkomödie: In zwölf Zyklen, schon als junger Mann begonnen und bis 1993 fortgesetzt, führt Meckel seinen Protagonisten durch Leben und Welt, Zeit und Raum. Die Blätter wurden von Meckel selbst als Handabzüge in Auflagen von in der Regel nur rund fünf Exemplaren angefertigt, nur einzelne Zyklen wurden ausgestellt, lediglich der Zyklus Passage ist als Buch veröffentlicht. Es kommt vor, gewöhnlich nachts, daß ich in Fächern und Schränken Papiere suche und Bilder finde, von denen ich nichts mehr weiß. So entdeckte ich einen ganzen Zyklus O Babylon! , vor 30 Jahren gezeichnet, verlegt, vergessen. Das sind die guten Augenblicke des Zeichners, nachdem die Komödie beendet ist. Sein grafisches Werk wurde in zahlreichen Ausstellungen gezeigt, so etwa 1987 in der Städtischen Galerie im Park Viersen und 2008 an der Bayerische Akademie der Schönen Künste in der Münchner Residenz. Darüber hinaus illustrierte Meckel eine Vielzahl an Büchern, darunter die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1974 für den Insel Verlag. . . . Aus wikipedia-Christoph_Meckel. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 90.
-
Katzenkopfpflaster. Gedichte. - (=dtv, Band 10506).
Verlag: München, Deutscher Taschenbuch-Verlag, 1985
ISBN 10: 3423105062 ISBN 13: 9783423105064
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Zustand: Sehr gut. 39. - 50. Tausend. 5. Auflage. 115 (5) Seiten. 18 cm. Umschlaggestaltung: Celestino Piatti. Sehr guter Zustand. - Sarah Kirsch (* 16. April 1935 in Limlingerode, Kreis Nordhausen; 5. Mai 2013 in Heide (Holstein); eigentlich Ingrid Hella Irmelinde Kirsch, geborene Bernstein) war eine deutsche Schriftstellerin. . Werk: Sarah Kirsch gilt als eine der bedeutendsten deutschen Lyrikerinnen. Ihre Lyrik ist von der Form her offen, meist ohne Reim und in freiem Versmaß. Dennoch spielt der Rhythmus im Sinne des Atemtempos eine große Rolle, ebenso Zeilenumbrüche und Zeilensprünge, durch die ein Strömen oder eine Atemlosigkeit erzeugt wird. Kirsch kombiniert häufig fachsprachliche oder altmodische Ausdrücke mit einem saloppen Ton. Charakteristisch für ihre Metaphorik sind Bilder, die in Alltags-, Natur- oder Landschaftsbetrachtung ihren Ausgangspunkt nehmen, aber verfremdet werden oder eine überraschende Wendung nehmen. Sarah Kirsch kontrastiert dabei oft präzise Naturbeobachtung mit dem Gefühlsleben des lyrischen Ichs oder politischer Reflexion. Während in frühen Gedichten die Auseinandersetzung mit Krieg und Nationalsozialismus vorherrschte, dominiert später das Landschaftsgedicht und die Reflexion auf die zivilisatorische Weltkrise. Kirsch gehört zu keiner Schule, wird aber manchmal der Neuen Subjektivität zugeordnet. Als literarisches Vorbild nannte Kirsch Annette von Droste-Hülshoff, daneben ist ihr Werk durch Johannes Bobrowski und Wladimir Majakowski beeinflusst. . . . Aus: wikipedia-Sarah_Kirsch. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 100 Taschenbuch. Kartoniert. Laminiert. Glanzfolienkaschierung.
-
Säure. Gedichte. Mit einer Grafik des Autors. - (=Fischer-Taschenbücher 5122).
Verlag: Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verlag, 1981
ISBN 10: 3596251222 ISBN 13: 9783596251223
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Erstausgabe
Zustand: Gut. Taschenbucherstausgabe. 115 (13) Seiten mit einer Abbildung. 18 cm. Umschlagentwurf: Jan Buchholz und Reni Hinsch. Umschlagillustration: Radierung von Christoph Meckel Guter Zustand. Seiten papierbedingt leicht gebräunt. - Christoph Meckel (* 12. Juni 1935 in Berlin; 29. Januar 2020 in Freiburg im Breisgau war ein deutscher Schriftsteller und Grafiker. Leben: Christoph Meckel, Sohn des Schriftstellers Eberhard Meckel und Enkel des Architekten Carl Anton Meckel, verbrachte Kindheit und Jugend in Freiburg im Breisgau, wo er das Gymnasium bis zur Unterprima besuchte. 1954/55 studierte er Grafik an der Kunstakademie in Freiburg im Breisgau, 1956 an der Akademie der Bildenden Künste München. Seit 1956 arbeitet er als Schriftsteller und Grafiker. Er unternahm ausgedehnte Reisen durch Europa, Afrika und Amerika und lebte in Ötlingen im Markgräflerland, in Berlin, in Südfrankreich und in der Toskana. Meckel war bis 1997 Mitglied des PEN-Zentrums der Bundesrepublik Deutschland. Er ist Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Christoph Meckel lebt heute wieder in Ötlingen und in der Kleinstadt Rémuzat bei Nyons, Département Drôme in Südostfrankreich. In seinem Bericht" Ein unbekannter Mensch (1997) erscheint Rémuzat als Villededons". Werk: Meckels biografische Daten sind Teil seines künstlerischen Werks. So behauptete er 1992 im Bericht zur Entstehung einer Weltkomödie, der Schriftsteller Christoph Meckel hätte eine andere Biographie als der Grafiker. Die Auseinandersetzung mit seinem Vater und dessen Generation im Nationalsozialismus und im Krieg prägte Meckel und wird am deutlichsten im Werk Suchbild. Über meinen Vater (1980). Ebenso intensiv setzte er sich 22 Jahre später in Suchbild: meine Mutter (2002) mit seiner Mutter auseinander, von der er sich zeitlebens ungeliebt fühlte, und der er geistige Enge und Frigidität vorwarf. Meckels grafisches Werk rankt sich um die Weltkomödie: In zwölf Zyklen, schon als junger Mann begonnen und bis 1993 fortgesetzt, führt Meckel seinen Protagonisten durch Leben und Welt, Zeit und Raum. Die Blätter wurden von Meckel selbst als Handabzüge in Auflagen von in der Regel nur rund fünf Exemplaren angefertigt, nur einzelne Zyklen wurden ausgestellt, lediglich der Zyklus Passage ist als Buch veröffentlicht. Es kommt vor, gewöhnlich nachts, daß ich in Fächern und Schränken Papiere suche und Bilder finde, von denen ich nichts mehr weiß. So entdeckte ich einen ganzen Zyklus O Babylon! , vor 30 Jahren gezeichnet, verlegt, vergessen. Das sind die guten Augenblicke des Zeichners, nachdem die Komödie beendet ist. Sein grafisches Werk wurde in zahlreichen Ausstellungen gezeigt, so etwa 1987 in der Städtischen Galerie im Park Viersen und 2008 an der Bayerische Akademie der Schönen Künste in der Münchner Residenz. Darüber hinaus illustrierte Meckel eine Vielzahl an Büchern, darunter die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1974 für den Insel Verlag. . . . Aus wikipedia-Christoph_Meckel. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 90 Taschenbuch. Kartoniert mit Leinenkaschierung.
-
Am Beispiel meines Bruders. - (=dtv 13316).
Verlag: München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 2005
ISBN 10: 3423133163 ISBN 13: 9783423133166
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Zustand: Wie neu. 154 (6) Seiten. 19,1 cm. Umschlagfoto: Privatbesitz des Autors. Umschlagkonzept: Balk & Brumshagen. Sehr guter Zustand. Frisches Exemplar. Ungelesen. "Dieses Buch liegt mir sehr am Herzen . Die Jungen sollten es lesen, um zu lernen, die Alten, um sich zu erinnern, und alle, weil es gute Literatur ist." (Elke Heidenreich). Ein kurzes Leben, das lange nachwirkt Uwe Timm erzählt die Geschichte seines älteren Bruders Karl Heinz Timm, geboren 1924 in Hamburg, gestorben 1943 in einem Lazarett in der Ukraine Erst nach dem Tod von Mutter und Schwester fühlt Uwe Timm sich frei genug, über seinen sechzehn Jahre älteren Bruder zu schreiben, der sich 1942 freiwillig zur SS-Totenkopfdivision gemeldet hatte und nicht mehr zurückkehrte. Der Neunzehnjährige lebt weiter in der Trauer der Eltern, ihren Erzählungen, den sprachlichen Wendungen, die für sein Schicksal bemüht wurden, aber auch in den Träumen des jüngeren Bruders, der kaum eigene Erinnerungen an ihn hat. Warum wurden diese Träume nach einem halben Jahrhundert immer drängender? Der Impuls, über den Bruder zu schreiben, sich ein Bild von ihm zu machen, von seiner Generation im Nazikrieg, erwächst bei Uwe Timm auch aus der Notwendigkeit, über die Voraussetzungen der eigenen Biographie Klarheit zu gewinnen. Es ist die Frage nach familiären Prägungen, nach Werten und Erziehungszielen, nach Liebe, Nähe und Respekt unter den Bedingungen des nationalsozialistischen Zivilisationsbruchs. Warum hat sich der Bruder freiwillig zur SS gemeldet? Wie ging er mit der Verpflichtung zum Töten um? Welche Optionen hatte er, welche Möglichkeiten blieben ihm verschlossen? Wo ist der Ort der Schuld, wo der des Gewissens bei den Eltern, die ihn überlebt haben? Uwe Timms neues Buch ist ein bewegender und nachdenklicher Versuch über den Bruder, über Schuld und Erinnerung, es ist auch ein Porträt der eigenen Familie und eine Studie darüber, welche Haltungen den Nationalsozialismus und den Krieg möglich machten, was das mit uns zu tun hat und wie man darüber sprechen kann. Ein schönes, kluges und trauriges Buch, das einen nicht loslässt.? - Uwe Timm (* 30. März 1940 in Hamburg) ist ein deutscher Schriftsteller. Leben: Uwe Timm wurde im März 1940 in Hamburg geboren. 1943 wurde er mit seiner Mutter zu Verwandten nach Coburg evakuiert und kehrte im Spätsommer 1945 nach Hamburg zurück, wo der aus dem Krieg heimgekehrte Vater eine Kürschnerei eröffnete. Nach der Volksschule machte er eine Lehre als Kürschner und übernahm das hoch verschuldete Pelzgeschäft des kurz zuvor verstorbenen Vaters. Nachdem das Geschäft entschuldet war, besuchte er ab 1961 das Braunschweig-Kolleg zusammen mit Benno Ohnesorg, wo er 1963 sein Abitur bestand. Seine ersten Gedichte erscheinen in der zusammen mit Ohnesorg herausgegebenen Zeitschrift teils-teils, von der aber nur eine Nummer erschien. Es folgte ein Studium der Philosophie und Germanistik in München. 1966 setzt er dieses in Paris fort, wo er den Mathematiker Diederich Hinrichsen kennenlernt. Gemeinsam schreiben sie ein Theaterstück, für das sie aber keinen Verlag finden. 1967-69 war Timm, nach seiner Rückkehr nach München, im Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) politisch tätig. Er schrieb Agitprop-Lyrik und Straßentheaterstücke und beteiligte sich an der Besetzung der Münchner Universität. 1969 heiratet er die spätere Übersetzerin Dagmar Ploetz. 1970 begann er ein Zweistudium der Soziologie und Volkswirtschaft, das er aber 1972 wieder aufgab. 1971 promovierte er über »Das Problem der Absurdität bei Albert Camus«. Seitdem arbeitet Timm als freier Schriftsteller. 1971/72 gründete er die »Wortgruppe München« und war Mitherausgeber der Zeitschrift »Literarische Hefte«. Von 1972 bis 1982 gab er die AutorenEdition mit heraus. . Heute lebt Uwe Timm als freier Schriftsteller mit seiner Familie in München und Berlin. Rezeption: In den 1970er-Jahren erlangte Uwe Timm als Autor erstmals große Aufmerksamkeit durch seinen Roman Heißer Sommer, der bis heute zu den wenigen literarischen Zeugnissen der 68er-Studentenrevolte zählt, sowie mit seinem postkolonial-historischen Roman Morenga. . . . Aus: wikipedia-Uwe_Timm. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 195 Taschenbuch. Kartoniert. Laminiert. Glanzfolienkaschierung. Ungekürzte, vom Autor neu durchgesehene Auflage.
-
Provoziertes Leben. Eine Auswahl aus den Prosaschriften. Quellenhinweis. - (=Ullstein Bücher, Nr. 54).
Verlag: Frankfurt am Main, Berlin, Wien: Ullstein Verlag, 1955
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Erstausgabe
Zustand: Gut. Taschenbucherstausgabe. 180 (4) Seiten. 18 cm. Umschlagentwurf: Dieter Oestreich. Guter Zustand. Interessante Vorbesitzerzeichungen auf den Vorsätzen. Aus dem Klappentext: Benns Prosa ist gefährlich; wer sich mit ihr einlässt, muss damit rechnen, dass er von ihr verändert wird. Gleichgültig, ab man seinen scharfen Thesen zustimmt - man kann an ihnen nicht vorübergehen. Alle seine Sätze sind Prüfsteine, die in die tiefste Krisis hineinreissen, die eine Entscheidung geradezu aufzwingen. Sie stellen mit einem Wort "existentielle Prosa" dar. - Gottfried Benn (* 2. Mai 1886 in Mansfeld, Brandenburg; 7. Juli 1956 in Berlin) war ein deutscher Arzt, Dichter und Essayist. . Gottfried Benn gilt als einer der bedeutendsten deutschen Dichter der literarischen Moderne. Ein erstes Mal betrat er die literarische Szene als Expressionist mit seinen Morgue-Gedichten, die mit herkömmlichen poetischen Traditionen radikal brachen und in denen vor allem Eindrücke aus seiner Tätigkeit als Arzt starken Niederschlag fanden. Sektionen und Krebs- und Geburtsstationen werden scheinbar emotionslos beschrieben, und romantische Titel wie Kleine Aster" wecken Erwartungen, die dann krass enttäuscht werden. Nach dem oben genannten Gedichtband erschienen in der Folgezeit nur noch wenige mit äußerst geringer Auflage; während der Nazizeit unterlag Benn einem Schreibverbot. Vom Nationalsozialismus, mit dem er zuerst sympathisiert hatte, wandte sich Benn wohl vor allem ab, weil er ihn schließlich als ähnlich antikulturell einschätzte wie den Kommunismus und Sozialismus. Nach Kriegsende wurde er zunächst wegen seiner anfänglichen Unterstützung des Hitlerregimes angefeindet, doch spätestens mit seinen Statischen Gedichten, die sich weit vom wild-zynischen Ton der Morgue-Gedichte entfernt hatten, fand er in der jungen Bundesrepublik ein neues, stetig wachsendes Publikum. So wurde der Autor zum Ende hin ein weitberühmter, mit dem Büchner-Preis ausgezeichneter und stilbildender Dichter. . Aus: wikipedia-Gottfried_Benn Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 160 Illustrierter Karton. Taschenbuch. Kartoniert. Laminiert. Glanzfolienkaschierung.
-
Die Schreie der Fledermäuse. Geschichten, Gedichte, Aufsätze. Interview mit Dieter E. Zimmer. - (=Ullstein-Buch ; Nr. 26041 : Literatur heute).
Verlag: Frankfurt/M ; Berlin ; Wien : Ullstein Verlag, 1981
ISBN 10: 3548260411 ISBN 13: 9783548260419
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Taschenbuch. Kartoniert. Zustand: Wie neu. Erste Auflage dieser Ausgabe. 383 (1) Seiten. 18 cm. Umschlagentwurf: Zembsch. Guter Zustand. - Günter Kunert (* 6. März 1929 in Berlin) ist ein deutscher Schriftsteller, der mit seinem Werk in besonderem Maße die Literatur der beiden deutschen Staaten, d. h. die Kompliziertheit ihrer Wechselbeziehungen und ihrer unterschiedlichen Befindlichkeiten, sowie dann des wiedervereinigten Deutschlands repräsentiert. Leben: Nach dem Besuch der Volksschule war es Günter Kunert auf Grund der nationalsozialistischen Rassengesetze (seine Mutter war Jüdin) nicht möglich, eine höhere Schule zu besuchen. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges studierte er in Ost-Berlin fünf Semester Grafik, brach sein Studium dann jedoch ab. 1948 trat er der SED bei. Er lernte Bertolt Brecht und Johannes R. Becher kennen. Seit Mitte der sechziger Jahre pflegte er eine jahrelange enge Freundschaft zu dem Kollegen Nicolas Born, einen intensiven Briefwechsel, der 1978 kurzzeitig zu einem zur Veröffentlichung vorgesehenen Schriftwechsel wurde. 1972/73 war er Gastdozent an der University of Texas in Austin, 1975 an der University of Warwick in England. Er gehörte 1976 zu den Erstunterzeichnern der Petition gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann. Daraufhin wurde ihm 1977 die SED-Mitgliedschaft entzogen. 1979 ermöglichte ihm ein mehrjähriges Visum das Verlassen der DDR. Kunert ließ sich mit seiner Frau Marianne in Kaisborstel bei Itzehoe nieder, wo er bis heute als freier Schriftsteller lebt. Kunert gilt als einer der vielseitigsten und bedeutendsten Gegenwartsschriftsteller. Neben der Lyrik sind es Kurzgeschichten (Parabeln) und Erzählungen, Essays, autobiographische Aufzeichnungen, Aphorismen, Glossen und Satiren, Märchen und Sciencefiction, Hörspiele, Reden, Reiseskizzen, Drehbücher, eine Vielzahl von Vor- und Nachworten zu Veröffentlichungen von anderen Autoren, Libretti, Kinderbücher, ein Roman, ein Drama und anderes mehr, die Kunerts kaum noch überschaubares schriftstellerisches Werk ausmachen. Viele seiner Texte wurden von Kurt Schwaen vertont. Auch als Maler und Zeichner ist Kunert hervorgetreten. In seinen Arbeiten nimmt er eine kritische Haltung zu Themen wie Fortschrittsgläubigkeit, Nationalsozialismus und der Politik des DDR-Regimes ein. Während seine frühen Gedichte, pädagogisch-kritisch argumentierend, dem sozialistischen Realismus verpflichtet waren und dem Fortschritt dienen sollten, nahm er später eine zunehmend skeptische und pessimistische Haltung ein. Günter Kunert ist seit 1988 Mitglied der Freien Akademie der Künste Hamburg und seit 2005 Vorstandspräsident des P.E.N.-Zentrum deutschsprachiger Autoren im Ausland. Aus wikipedia-G%C3%BCnter_Kunert Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 280.
-
Prosa eines Liebenden. Idolino. Korporal Mombour. Der Delphin. Verbesserte Neuauflage der Erstausgabe, welche im Jahr 1951 im Band "Süße Bitternis" erschien. - (=Bibliothek Suhrkamp, BS 78).
Verlag: Frankfurt a.M., Suhrkamp Verlag, 1963
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Zustand: Gut. 6. - 9. Tausend. 178 Seiten. Guter Zustand. - Ernst Penzoldt (* 14. Juni 1892 in Erlangen; 27. Januar 1955 in München) war ein deutscher Schriftsteller, unter dem Pseudonym Fritz Fliege" auch Bildhauer, Maler, Zeichner und Karikaturist. Leben und Werk: Penzoldt wächst als jüngster von vier Brüdern in einem großbürgerlichen Haus auf und verlebt, nach eigener Aussage, eine wundervolle, fast verwöhnte Jugendzeit". Sein Vater Franz Penzoldt zählt als Medizin-Professor zu den Erlanger Honoratioren. Während der Vater den künstlerischen Neigungen des Sohnes skeptisch gegenüber steht, scheint die Mutter Valerie (geb. Beckh) diese zu fördern. Zwar sahen die Pläne der Eltern auch für den vierten Sohn ein Medizin-Studium vor, doch unterstützen sie Ernst letztlich auch in dessen Entscheidung, eine Künstlerlaufbahn anzustreben: 1912 nimmt Penzoldt an der Weimarer Kunsthochschule bei Albin Egger-Lienz das Studium der Bildhauerei auf. Hier lernt er seinen Freund Günther Stolle kennen, in dem er das ergänzende Gegenstück zur eigenen Persönlichkeit zu erkennen meint. Nach dem Weggang Egger-Lienz' aus Weimar wechseln sie 1913 gemeinsam an die Kunstakademie in Kassel, der heutigen Kunsthochschule Kassel. Als 1914 der Erste Weltkrieg beginnt, ist Penzoldt wie die Mehrzahl seiner Altersgenossen begeistert und will seinen Freunden und Hochschul-Kameraden nicht nachstehen und die Erwartungen der Eltern erfüllen. Er meldet sich daher freiwillig zum Militärdienst, den er (fast) bis Kriegsende als Sanitäter ableistet. Ab 1915 beginnt er in der Etappe, Gedichte und Erzählungen zu schreiben. 1917 fällt Günther Stolle spätestens seit dieser Zeit sind Tod und Freundschaft wesentliche Bestandteile in Penzoldts Schaffen. 1918 kehrt Penzoldt verstört und desillusioniert heim: Vom Gott des Krieges angebrüllt stand ich lange verdutzt. Ich fand zuerst die Sprache wieder, die Hände waren noch ohnmächtig." Seine schriftstellerische Karriere hat Penzoldt entsprechend (und nicht ganz ohne Koketterie) eine Art Kriegsbeschädigung" genannt. In den politisch unruhigen Zeiten des Frühjahrs 1919 zieht es Penzoldt nach München, wo er kurz darauf seinem neuen Gefährten", dem jungen Ernst Heimeran begegnet. Diese Freundschaft wird entscheidend für Penzoldts weiteren persönlichen und beruflichen Werdegang, denn Heimeran gründet im Inflationsjahr 1922 einen eigenen Verlag (Heimeran Verlag), wo Penzoldts erste Publikationen erscheinen: Den Anfang macht 1922 der Gedichtband Der Gefährte, gefolgt von Idyllen (1923) und Der Schatten Amphion (1924). 1922 heiratet Penzoldt Heimerans Schwester Friederike, genannt Friedi. Die Eheschließung dient Penzoldt nach eigener Aussage auch dazu, seiner Homosexualität, die er zeitweise als verunsichernd erfuhr, ein in den Konventionen des Bürgertums verankertes Leben entgegenzusetzen. Aus der Ehe gehen zwei Kinder hervor: Günther (* 1923, später Dramaturg, u. a. am Deutschen Schauspielhaus unter Gustaf Gründgens, 1997)) und Ulrike, genannt Ulla (* 1927). Anfang der 1920er beschäftigt sich Penzoldt bereits mit verschiedenen literarischen Stoffen, die ihm, erscheinend in renommierten Verlagen wie Reclam oder Insel, zum Durchbruch als Schriftsteller verhelfen: Der Zwerg (1923), Der arme Chatterton (1928) und Etienne und Luise (1929). Penzoldt freundet sich mit Münchener Literaten und Literaturkritikern wie Hans Brandenburg, Paul Alverdes, Eugen Roth oder Hans Carossa an und gehört 1924 zu den Gründungsmitgliedern der Künstlervereinigung Die Argonauten", die bald zur entscheidenden Größe im Münchener Kulturleben wird. 1927 erhält Penzoldt die Möglichkeit, in dem berühmten literarischen Salon von Elsa Bernstein vor so illustren Gästen wie Thomas Mann zu lesen, der retrospektiv über seine erste Begegnung mit Penzoldt schreibt: [.] mit taktvoll gedämpfter Stimme las er seine Novelle Der arme Chatterton" vor, und gleich spürte ich den Reiz und Rang seines Talentes, etwas unverkennbar Musisches, einen Geist zart schwebender Leichtigkeit und des romantischen Spottes über die plumpe und häßliche Mühsal eines von den Grazien ungesegneten Lebens, eingeschlossen das Erbarmen mit den Beleidigten, Verstoßenen und Darbenden einer verhärteten Gesellschaft .". Ein Gerichtsprozess, der von Penzoldts ehemaligem Turnlehrer gegen die Verbreitung der Novelle Etienne und Luise angestrengt wird, da dieser sich und seine Tochter porträtiert zu finden glaubt, verschafft Penzoldt reichsweite Bekanntheit und führt zu einem Verbot der Novelle. 1929/30 schreibt Penzoldt sein erfolgreichstes Buch, Die Powenzbande, einen der seltenen humoristischen Romane, wie sie uns Deutschen leider nur alle 50 Jahre gelingen" (Walther Kiaulehn). Dieser Schelmenroman" rechnet mit dem Spießbürgertum ab und entsteht nicht zufällig zur Zeit des Gerichtsverfahrens. Parallel arbeitet Penzoldt an verschiedenen Theaterstücken, die zum Teil mit namhafter Besetzung aufgeführt werden (Bernhard Minetti, Ida Ehre). Im Jahr 1932 bittet der Komponist Paul Hindemith Ernst Penzoldt darum, das Libretto für eine geplante deutsche Volksoper" zu schreiben, was zu einer intensiven Zusammenarbeit führt, letztlich aber an den politischen Umbrüchen scheitert. Ebenfalls 1932 entsteht Penzoldts Theaterstück So war Herr Brummell, das sich der historischen Figur des Dandys George Bryan Brummell widmet und 1934 am Wiener Burgtheater mit großem Erfolg uraufgeführt wird, bevor es 1935 am Hamburger Schauspielhaus und 1939 im Deutschen Theater Berlin auf die Bühne gelangt. Obwohl Penzoldts ablehnende Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus bekannt ist, erscheinen 1934 unter dem Lektorat von Penzoldts Freund Peter Suhrkamp der Roman Kleiner Erdenwurm (ein liebenswertes, auf eine entzückende Art unzeitgemäßes Buch", Hermann Hesse), 1935 die Erzählung Idolino und 1937 der Band Der dankbare Patient, den die Zensur wohlwollend aufnimmt und der sich gut verkauft. Im Frühjahr 1938 wird Penzoldt in die Wehrmacht eingezogen. Während dieser Zeit entstehen einige wichtige Texte, unter denen vor.
-
Der Schatz auf Pagensand. Mit Vignetten des Autors. - (=dtv junior, 70593).
Verlag: München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 2021
ISBN 10: 3423705930 ISBN 13: 9783423705936
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Zustand: Wie neu. 22. Auflage. 173 (3) Seiten mit Vignetten von Uwe Timm. 19,1 cm. Umschlagbild von Ute Martens. Sehr guter Zustand. Frisches Exemplar. Wie ungelesen. Aus dem Klappentext: Schatzsuche auf der Elbe! Als Benno, Georg, Jan und Jutta heimlich mit einem alten Segelboot aufbrechen, um auf einer der vielen unbewohnten Inseln einen längst vergessenen Schatz zu heben, werden sie in immer abenteuerlichere Geschehnisse verwickelt. Mit zahlreichen Karten und einem zusätzlichen Spezialauftrag des Königs von Albanien unterwegs, kommen ihnen sogar ein paar schießwütige Ganoven in die Quere. Doch damit nicht genug: Vor Pagensand erleiden die Vier Schiffbruch und müssen plötzlich völlig auf sich gestellt um ihr Überleben kämpfen. Da machen sie eine folgenschwere Entdeckung. - Uwe Timm (* 30. März 1940 in Hamburg) ist ein deutscher Schriftsteller. Leben: Uwe Timm wurde im März 1940 in Hamburg geboren. 1943 wurde er mit seiner Mutter zu Verwandten nach Coburg evakuiert und kehrte im Spätsommer 1945 nach Hamburg zurück, wo der aus dem Krieg heimgekehrte Vater eine Kürschnerei eröffnete. Nach der Volksschule machte er eine Lehre als Kürschner und übernahm das hoch verschuldete Pelzgeschäft des kurz zuvor verstorbenen Vaters. Nachdem das Geschäft entschuldet war, besuchte er ab 1961 das Braunschweig-Kolleg zusammen mit Benno Ohnesorg, wo er 1963 sein Abitur bestand. Seine ersten Gedichte erscheinen in der zusammen mit Ohnesorg herausgegebenen Zeitschrift teils-teils, von der aber nur eine Nummer erschien. Es folgte ein Studium der Philosophie und Germanistik in München. 1966 setzt er dieses in Paris fort, wo er den Mathematiker Diederich Hinrichsen kennenlernt. Gemeinsam schreiben sie ein Theaterstück, für das sie aber keinen Verlag finden. 1967-69 war Timm, nach seiner Rückkehr nach München, im Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) politisch tätig. Er schrieb Agitprop-Lyrik und Straßentheaterstücke und beteiligte sich an der Besetzung der Münchner Universität. 1969 heiratet er die spätere Übersetzerin Dagmar Ploetz. 1970 begann er ein Zweistudium der Soziologie und Volkswirtschaft, das er aber 1972 wieder aufgab. 1971 promovierte er über »Das Problem der Absurdität bei Albert Camus«. Seitdem arbeitet Timm als freier Schriftsteller. 1971/72 gründete er die »Wortgruppe München« und war Mitherausgeber der Zeitschrift »Literarische Hefte«. Von 1972 bis 1982 gab er die AutorenEdition mit heraus. 1973 trat er in die DKP ein, mit deren Zielen er sich aber nie vollständig identifizieren konnte. 1981 trat er wieder aus, u. A. wegen der unkritischen Haltung der Partei gegenüber der DDR, und siedelte für zwei Jahre nach Rom über. Nach der Auflösung der AutorenEdition wechselte Timm zum Verlag Kiepenheuer & Witsch, wo seitdem alle seine Werke erscheinen. Im Wintersemester 1991/92 hielt Timm Poetikvorlesungen an der Universität Paderborn, die später in dem Band Erzählen und kein Ende erscheinen. Seit Herbst 1994 ist er ordentliches Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, Darmstadt, des PEN-Zentrums der Bundesrepublik Deutschland und der Akademie der Künste (Berlin). Dreimal wurde Timm als writer in residence an verschiedene Universitäten des englischsprachigen Raums berufen, so 1981 nach Warwick, 1994 nach Swansea und 1997 nach St. Louis. 2005 hatte er die Poetikprofessur an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg inne. Außerdem war er 2006 Ehrengast der Villa Massimo in Rom. Heute lebt Uwe Timm als freier Schriftsteller mit seiner Familie in München und Berlin. Rezeption: In den 1970er-Jahren erlangte Uwe Timm als Autor erstmals große Aufmerksamkeit durch seinen Roman Heißer Sommer, der bis heute zu den wenigen literarischen Zeugnissen der 68er-Studentenrevolte zählt, sowie mit seinem postkolonial-historischen Roman Morenga. Große Erfolge feierte Uwe Timm Anfang der 90er-Jahre mit der Novelle Die Entdeckung der Currywurst, die in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurde. Die Novelle wurde 2008 von Ulla Wagner mit Barbara Sukowa und Alexander Khuon in den Hauptrollen verfilmt. Im neuen Jahrtausend wurde Uwe Timm gefeiert für seinen Roman Rot (2001), der von den Hoffnungen und Wünschen der 68er, von Lebensläufen und ihren Geheimnissen, von den Utopien und Verbrechen unserer Geschichte erzählt. 2003 erschien Timms autobiografische Erzählung Am Beispiel meines Bruders, die eine allgemeine Diskussion über die deutsche Erinnerungskultur und den Nationalsozialismus auslöste. Ein großes Echo rief er zuletzt mit seiner Erzählung Der Freund und der Fremde (2005) hervor, in der er die Geschichte seiner Freundschaft zu Benno Ohnesorg aufarbeitet. . . . Aus: wikipedia-Uwe_Timm. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 197 Taschenbuch. Kartoniert. Laminiert. Glanzfolienkaschierung.
-
Unsere schönsten Jahre. Ein Leben mit Paris. - (=Die Bücher der Neunzehn, Band 34).
Verlag: Tübingen: Rainer Wunderlich Verlag Hermann Leins, 1957
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Zustand: Sehr gut. Einmalige Sonderausgabe. 341 (3) Seiten. 19,1 cm. Einbandentwurf und Schutzumschlag: Walter Brudi. Sehr guter Zustand. - Friedrich Carl Maria Sieburg (* 18. Mai 1893 in Altena/Sauerland; 19. Juli 1964 in Gärtringen/Württemberg) war ein deutscher Journalist, Schriftsteller und Literaturkritiker. Leben - Herkunft: Friedrich Sieburg stammte aus einer Kaufmannsfamilie. Er besuchte zunächst das Realgymnasium in Altena, danach ein humanistisches Gymnasium in Düsseldorf. Als 16-Jähriger veröffentlichte er erste Gedichte in den Düsseldorfer Nachrichten. Studium: 1912 begann er das Studium der Philosophie, Geschichte, Literatur und Nationalökonomie in Heidelberg. 1919 promovierte Sieburg in Münster in Literaturwissenschaft (Thema: Die Grade der lyrischen Formung. Beiträge zu einer Ästhetik des lyrischen Stils). Zu seinen Universitätslehrern zählten Max Weber und Friedrich Gundolf. Er hatte Verbindung zum George-Kreis. Im Ersten Weltkrieg war er zunächst als Infanterist, ab 1916 als Fliegeroffizier im Einsatz. Weimarer Republik: 1919 bis 1923 lebte Sieburg als freier Schriftsteller in Berlin, war Anhänger der Revolution und schrieb in dieser Zeit vor allem Filmkritiken. Von 1923 an war er, anfangs in loser Form, für die Frankfurter Zeitung in Kopenhagen tätig. Im Mai 1926 wurde er ihr Auslandskorrespondent in Paris. Dort entstand auch sein bekanntestes Buch Gott in Frankreich? (1929). 1930 bis 1932 war er Auslandskorrespondent in London, danach wieder in Paris. 1929 veröffentlichte Sieburg einen Artikel in der jungkonservativen Monatszeitschrift Die Tat, was man als Abkehr von der bürgerlich-liberalen Generallinie bewerten darf, die die Frankfurter Zeitung auszeichnete. 1932 veröffentlichte er auch einige Beiträge in der Täglichen Rundschau, die wie Die Tat von Hans Zehrer geleitet wurde, dessen Hinwirken auf ein Querfrontbündnis zwischen "linken" Nationalsozialisten um Gregor Strasser, Gewerkschaftern und Sozialdemokraten zur Verhinderung eines Reichskanzlers Adolf Hitler von Sieburg unterstützt wurde. In seinem Buch Es werde Deutschland, das er im November 1932 abschloss, das aber erst nach Hitlers Machtübernahme erscheinen konnte, bewegte er sich, wie sein Freund Carl Zuckmayer 1944 in seinem Geheimreport urteilte, auf einer "sehr gefährlichen und ganz verschwommenen Grenze - zwischen Nationalismus, Kritik des 'liberalen Denkens' und politischer Progressivität". Dazu gehörte allerdings auch die entschiedene Ablehnung des Antisemitismus, weshalb das Buch 1936 verboten wurde. Während der NS-Zeit: Zwar hatte sich Sieburg in der Kampfschrift Es werde Deutschland parteipolitisch noch nicht festgelegt, bekannte sich in der englischen Übersetzung, die nach der Machtergreifung erschien, aber zum Nationalsozialismus und warb tagespublizistisch im Ausland für das "neue Deutschland", wodurch er sich die Feindschaft der deutschen Emigrantenkreise zuzog. Auf der anderen Seite missbilligte er die Machtergreifung in Briefen an den Verleger Heinrich Simon, für dessen Frankfurter Zeitung er 1932-39 als Auslandskorrespondent in Paris tätig war. Für autoritäre Regime wie in Portugal und Japan fand er in den Büchern Neues Portugal (1937) und Die stählerne Blume (1939) anerkennende Worte. Die 1935 von ihm verfasste Biografie Robespierre kann nur mit Einschränkungen der Inneren Emigration zugerechnet werden. 1939 wurde Sieburg in den deutschen Auswärtigen Dienst berufen. Nach Longerich, der sich auf Max W. Clauss beruft, wurden etwa 2 Dutzend NS-nahe Journalisten im Sommer zu Ribbentrop nach Fuschl am See geholt und dort durch Friedrich Berber, der hier als Chef auftrat, ultimativ zum Auslandseinsatz als NS-Propagandisten aufgefordert. Clauss gibt an, sich verweigert zu haben, während Sieburg, Hans Georg von Studnitz und Karl Megerle sofort zusagten. Sieburg war ab Februar 1940 an der Deutschen Botschaft in Brüssel als "Sonderbeauftragter" des Auswärtigen Amtes tätig. Von 1940 bis 1942 hielt er sich im besetzten Frankreich auf und wurde 1940 Botschaftsrat in Paris. In einer später auch gedruckten Rede France d'hier et de demain vor der Groupe Collaboration im März 1941 erklärte Sieburg, er sei durch das Leben in Frankreich "'zum Kämpfer und zum Nationalsozialisten erzogen'" worden. Nach der NSDAP-Mitgliederkartei stellte er am 9. April 1941 bei der NSDAP-Auslandsorganisation einen Antrag auf Aufnahme in die NSDAP, der am 1. September 1941 bewilligt wurde. Im Fragebogen der französischen Militärregierung gab er nach dem Zweiten Weltkrieg an, nicht Mitglied der NSDAP gewesen zu sein. 1942 kehrte Sieburg nach Deutschland zurück und arbeitete wieder für die Frankfurter Zeitung bis zu ihrem Verbot 1943. Danach wechselte er zur Börsenzeitung und war Ehrenbegleiter von Marschall Henri Philippe Pétain. Nachkriegszeit: Nach Kriegsende, das er in Bebenhausen miterlebte, wurde Sieburg von der französischen Besatzungsmacht mit einem Publikationsverbot (1945-1948) belegt. Sieburgs Schriften Neues Portugal (1937) und Die rote Arktis (1932) wurden in der Sowjetischen Besatzungszone bzw. in der Deutschen Demokratischen Republik auf die Liste der auszusondernden Literatur gesetzt. 1948 wurde er Mitarbeiter, 1949 auch Mitherausgeber der Wochenzeitschrift Die Gegenwart. In seinen Büchern über Frankreich distanzierte er sich jetzt stark vom Nationalsozialismus, nahm Abstand von einem deutschen Sonderbewusstsein und pries die moderne französische Literatur. Seit 1956 für die Frankfurter Allgemeine Zeitung tätig, war er bis zu seinem Tode einer der bedeutendsten Zeit- und Literaturkritiker Deutschlands. Insbesondere Sieburgs meisterhafte Inhaltswiedergaben, in denen er die Kritik souverän vorwegnimmt, und damit jegliche abschließende Argumentation überflüssig macht, gelten als unübertroffen. 1953 ernannte ihn das Land Baden-Württemberg zum Professor. Seit 1956 war er ein ordentliches Mitglied der Akademie der Künste Berlin. Friedrich Sieburg unterstützte die Adenauer-Regierung, war ein Gegner der Nachkriegsliteratur und kritisierte die Gruppe 47 mehrfach in sc.