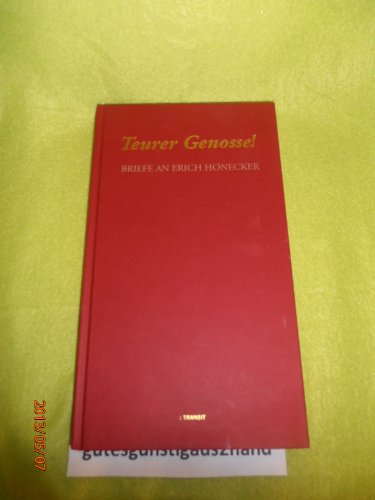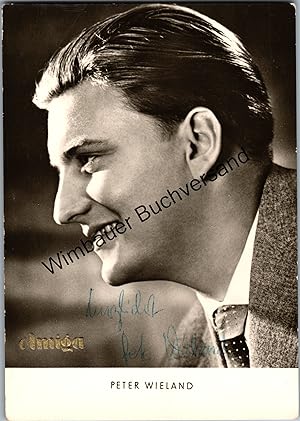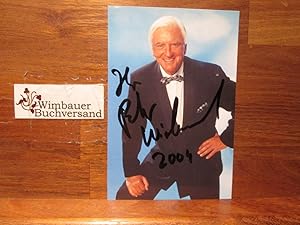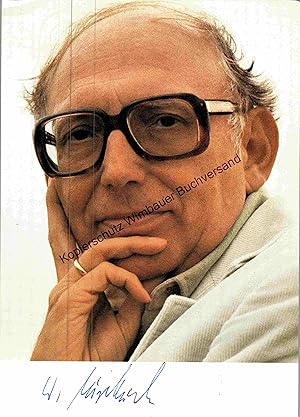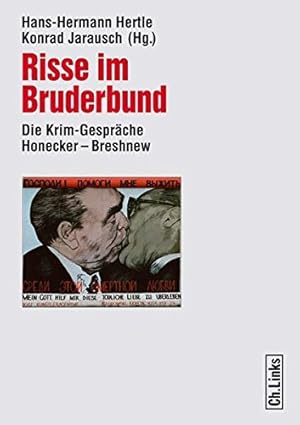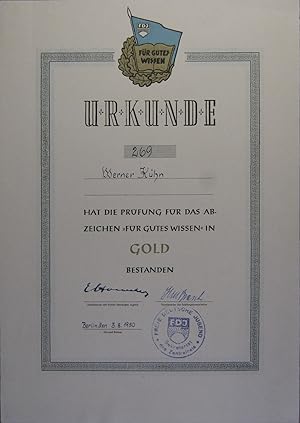erich honecker, Signiert (49 Ergebnisse)
FeedbackSuchfilter
Produktart
- Alle Product Types
- Bücher (17)
- Magazine & Zeitschriften (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Kunst, Grafik & Poster (1)
- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Manuskripte & Papierantiquitäten (31)
Zustand Mehr dazu
- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Wie Neu, Sehr Gut oder Gut Bis Sehr Gut (1)
- Gut oder Befriedigend (33)
- Ausreichend oder Schlecht (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Wie beschrieben (15)
Einband
Weitere Eigenschaften
Sprache (3)
Gratisversand
Land des Verkäufers
Verkäuferbewertung
-
EUR 10,00
Währung umrechnenEUR 4,60 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den Warenkorb24 cm, Pappband. Zustand: Gut. 157 S., 23,5 cm Private Widmung von Jochen Staadt auf Vorsatz. Leichte Lese- und Lagerspuren. Einband berieben. Gutes Exemplar (H47.) A/Z 51053 H47 ISBN 3887470966 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 380.
-
Beim Barte des Proleten: Geschichten aus dem Kabarett-Theater Distel in den Zeiten von Walter Ulbricht, Erich Honecker und Helmut Kohl Geschichten aus dem Kabarett-Theater Distel in den Zeiten von Walter Ulbricht, Erich Honecker und Helmut Kohl
Anbieter: Book Broker, Berlin, Deutschland
Signiert
EUR 14,97
Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbSoftcover. Zustand: Wie neu. 1. 272 S. Alle Bücher & Medienartikel von Book Broker sind stets in gutem & sehr gutem gebrauchsfähigen Zustand. Unser Produktfoto entspricht dem hier angebotenen Artikel, dieser weist folgende Merkmale auf: Helle/saubere Seiten in fester Bindung. Mit Original-Autorenautogramm. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 1100.
-
Original Danksagungskarte Joachim Kardinal Meisner
Verlag: Köln, 2009
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 10,00
Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Befriedigend. Faltkarte mit Dank für Weihnachts- und Geburtstagsglückwünsche von Joachim Cardinal Meisner signiert (sieht aber ziemlich gedruckt aus, daher zum Postkartenpreis statt dem eines Autographs), mit kleinem Einriss an Falz ///Joachim Kardinal Meisner (* 25. Dezember 1933 in Breslau, Niederschlesien; ? 5. Juli 2017 in Bad Füssing, Niederbayern) war ein deutscher Theologe und Erzbischof der römisch-katholischen Kirche. Er war von 1980 bis 1989 Bischof von Berlin und von 1982 bis 1989 Vorsitzender der Berliner Bischofskonferenz. 1983 wurde er Kardinal. Von 1989 bis 2014 war Meisner Erzbischof von Köln und Metropolit der Kirchenprovinz Köln. Joachim Meisner wurde im Breslauer Stadtteil Deutsch Lissa (heute poln. Lesnica) geboren und in der dortigen St.-Hedwigs-Kirche getauft. Er wuchs mit drei Brüdern in einem stark katholisch geprägten Umfeld auf. Nach der Vertreibung 1945 aus Schlesien und dem Tod seines Vaters im selben Jahr lebte Meisner im thüringischen Körner. Nach einer Lehre als Bankkaufmann trat Meisner 1953 ins Seminar für Spätberufene Norbertinum in Magdeburg ein und holte hier zunächst das Abitur nach. Von 1959 bis 1962 studierte er Philosophie und Theologie in Erfurt und wurde dort am 8. April 1962 zum Diakon und am 22. Dezember 1962 durch den damaligen Fuldaer Weihbischof Joseph Freusberg zum Priester geweiht. Er war Kaplan in Heiligenstadt und Erfurt, danach Rektor des Erfurter Caritasverbandes. 1969 wurde er von der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom zum Dr. theol. promoviert. Bischof Joachim Meisner (rechts) mit dem DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker, 1987 Weihbischof in Erfurt Am 17. März 1975 wurde er zum Titularbischof von Vina und Weihbischof des Bischöflichen Amtes Erfurt-Meiningen ernannt und am 17. Mai 1975 vom Apostolischen Administrator von Erfurt Hugo Aufderbeck zum Bischof geweiht. Mitkonsekratoren waren die Bischöfe Johannes Braun und Georg Weinhold. Meisners Wahlspruch lautete Spes nostra firma est pro vobis (?Unsere Hoffnung für euch steht fest?, nach der Erhebung zum Kardinal auf Spes nostra firma verkürzt) und entstammt dem 2. Korintherbrief (2 Kor 1,7 EU). Zum Bischöflichen Amt gehörte unter anderem das Eichsfeld, das eine katholische Enklave innerhalb der traditionell protestantisch und seit DDR-Zeiten atheistisch geprägten Glaubenslandschaft ist. Dort fand Meisner ein ähnlich intensives katholisches Gemeindeleben wie in seiner schlesischen Heimat vor. Bischof von Berlin Joachim Meisner, rechts, mit (v.l.) Bischof Karl Lehmann, Bischof Gerhard Schaffran und dem Kardinal Joseph Ratzinger auf dem Dresdner Katholikentreffen 1987 Am 22. April 1980 ernannte ihn Papst Johannes Paul II., den er seit Jahren persönlich kannte, zum Bischof von Berlin. In dieses Amt wurde er am 17. Mai 1980 eingeführt. Das Bistum Berlin mit seinen Ost- und Westteilen galt in der Zeit der Deutschen Teilung als eines der kirchenpolitisch schwierigsten europäischen Bistümer. 1984 weihte Bischof Meisner den in Berlin neu errichteten Karmel Regina Martyrum. Von 1982 bis 1989 stand Meisner der Berliner Bischofskonferenz vor. In dieser Funktion organisierte Meisner im Jahre 1987 das erste und einzige DDR-weite Katholikentreffen,[1] das mit über 100.000 Teilnehmern (bei weniger als 800.000 Katholiken in der DDR) ein großer Erfolg war.[2] Beim Abschlussgottesdienst sagte Meisner mit Anspielung auf die allgegenwärtigen Sowjetsterne (in Anwesenheit der staatlichen Vertreter), dass ?.die Christen in unserem Land keinem anderen Stern folgen möchten . als dem von Betlehem.?[3] Am 2. Februar 1983 nahm ihn Johannes Paul II. als Kardinalpriester mit der Titelkirche Santa Pudenziana in das Kardinalskollegium auf. Erzbischof von Köln Kontroverse um die Ernennung Nach dem Tod Joseph Kardinal Höffners im Jahr 1987 war das Amt des Kölner Erzbischofs neu zu besetzen. Traditionell besitzt das Kölner Domkapitel seit dem Jahr 1200 das Recht zur Wahl des Erzbischofs. Gemäß dem Staatskirchenvertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Preußen aus dem Jahr 1929 hat das Kapitel eine Liste von ?kanonisch geeigneten Kandidaten? bei der Bischofskongregation in Rom einzureichen, um auf diese Weise die Mitsprache der römischen Kurie und des Papstes sicherzustellen. Ebenso können die Bischöfe auf dem Gebiet des ehemaligen Preußen Vorschläge nach Rom schicken. Gemäß den Bestimmungen des preußischen Konkordates stellt der Papst ?unter Würdigung dieser Listen? einen Dreiervorschlag (Terna) zusammen, aus dem dann das Domkapitel einen Kandidaten zu wählen hat.[4] Freilich ist der Papst danach nicht an die eingereichten Vorschläge gebunden. Aufgrund des Dreiervorschlages aus Rom gelang dem Kölner Domkapitel keine Einigung, da nach den Statuten des Kölner Domkapitels eine absolute Mehrheit der Mitglieder des Kapitels für einen neuen Erzbischof stimmen musste. Nachdem Dompropst Bernard Henrichs dem päpstlichen Nuntius die nicht erfolgte Wahl mitgeteilt hatte, stellte sich Rom auf den Standpunkt des im Kirchenrecht vorgesehenen Devolutionsrechts, das besagt, dass die Entscheidung an die nächsthöhere Ebene fällt, wenn eine untere Ebene zu keiner Entscheidung kommt. Diesen Standpunkt vertrat der Heilige Stuhl auch gegenüber den Konkordatspartnern, den Ländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Ministerpräsidenten Johannes Rau und Bernhard Vogel waren dagegen der Auffassung, dass das Preußen-Konkordat zwingend eine Wahl vorschreibe und dass der völkerrechtliche Vertrag Vorrang vor dem kirchlichen Eigenrecht habe. Erst auf Druck der Ministerpräsidenten lenkte der Vatikan ein und ließ das Kapitel neuerlich wählen. Dazu änderte Papst Johannes Paul II. die Kölner Wahlordnung gemäß den Regeln des allgemeinen Kirchenrechts, wonach im dritten Wahlgang nur noch eine relative Mehrheit der Stimmen erforderlich war. Mit sechs Ja-Stimmen bei zehn Enthaltungen wurde Meisner schließlich gewählt und am 20. Dezember 1988 vom Papst zum Erzbischof von Köln ernannt. Am 12. Februar 1989 wurde er in sein neues Amt eingeführ.
-
Original Autogramm Peter Wieland (1930-2020) /// Autogramm Autograph signiert signed signee
Verlag: Amiga
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 15,00
Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Peter Wieland bildseitig mit blauem Kuli signiert mit eigenhändigem Zusatz "herzlichst", umseitig Notizen von dritter Hand /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Peter Wieland (bürgerlich Ralf Sauer; * 6. Juli 1930 in Stralsund; ? 1. März oder 2. März 2020 in Berlin) war ein deutscher Musical- und Schlagersänger, Entertainer und Musikpädagoge. In der DDR gehörte er zu den bekanntesten Unterhaltungskünstlern. Ralf Sauer kam nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtling mit seiner Familie aus Stettin nach Köthen, wo er den Beruf des Zimmermanns erlernte. Sein Talent wurde beim Singen im örtlichen Kirchenchor entdeckt. Mitte der 1950er Jahre gewann er einen Hauptpreis beim Gesamtdeutschen Gesangswettbewerb in Leipzig und begann damit seine Laufbahn als Sänger in der DDR. Er studierte an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin, wo er zum lyrischen Bariton im Opernfach ausgebildet wurde. Nach dem Staatsexamen erhielt er sein erstes Engagement am Theater in Neustrelitz.[2] Nach dreijähriger Tätigkeit als Opernsänger wandte er sich dem zu dieser Zeit neuen Genre des Musicals zu. Mit Musicalmelodien war er Gesangssolist beim Rundfunkorchester des Deutschlandsenders in Ost-Berlin und beim Sender Leipzig. Hier legte er sich 1957 den Künstlernamen Peter Wieland zu. Mit einer Rolle in der musikalischen Revue Das goldene Prag begann seine langjährige Tätigkeit als Darsteller im Berliner Friedrichstadt-Palast, wo er später auch als Entertainer und Moderator auftrat. Wieland nahm einige Schallplatten auf, die meist Musical- und Operettenmelodien zum Inhalt hatten. Im Radio hatte er zeitweilig eine Sendereihe mit dem Namen Show in Stereo. Es ergaben sich Fernsehauftritte und Tourneen, meist in die damals sozialistischen Länder. Als Musikpädagoge unterrichtete er seit 1966 die junge Dagmar Frederic. Später traten beide regelmäßig im Duett auf und waren von 1977 bis 1983 auch miteinander verheiratet. 1979 präsentierten Frederic und Wieland im DDR-Fernsehen die Sendung Ein Kessel Buntes. Als Kollektiv erhielten sie am 6. Oktober 1981 den Nationalpreis der DDR aus den Händen von Erich Honecker. Nach der Wende hatte Wieland weiterhin Fernsehauftritte bei den Sommermelodien (ARD), der Operettengala der Elblandfestspiele Wittenberge und bei Weihnachten bei uns im MDR. Wieland trat bis 2008 noch gelegentlich als Sänger auf, unter anderem mit seinem Programm Peter Wieland - hautnah. Weiterhin hatte er ein erneutes Engagement in Flensburg am Theater. Ferner wirkte er 1992 für einige Episoden in der Daily-Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten als Walter Bornat, der Verlobte von Helga Markmann (Nora Bendig), mit. 1999 und 2000 gestaltete er über 50 Mal die Rolle des Kaisers Franz Joseph in der Operette Im weißen Rößl unter freiem Himmel in Berlin-Treptow. 2003 brachte er die Uraufführung des Theaterstückes zum 100. Geburtstages des von ihm sehr verehrten Schauspielers Heinz Rühmann am Festspielhaus Wittenberge heraus, das nach einer Idee von Heiko Reissig und unter der Regie von Hans-Hermann Krug entstand. Seinen Erfolgstitel Erinnerung widmete Peter Wieland ebenfalls Rühmann. Peter Wieland war lange ein gefragter Sänger und Entertainer. Im Mai 2008 hatte er einen Auftritt beim Frühlingsfest in Fürstenwalde als Kaiser Franz Joseph. Im August 2008 trat er in der Sommerrevue im Berliner Friedrichstadt-Palast auf. Am 7. Juni 2010 feierte er mit vielen bekannten Kollegen im ausverkauften Friedrichstadt-Palast Berlin seinen 80. Geburtstag. Auf der Bühne wurde er von Renate Holm und Präsident Heiko Reissig zum Ehrenmitglied der Europäischen Kulturwerkstatt e. V. (EKW) berufen. Am 18. März 2014 wurde Peter Wieland zum Köthen-Botschafter für die 900-Jahr-Feier 2015 berufen.[3] Wieland lebte mit seiner dritten Ehefrau Marion Sauer bis zu ihrem Tod im August 2017 in Berlin-Rudow. Peter Wieland starb in der Nacht zum 2. März 2020 im Alter von 89 Jahren in einem Berliner Krankenhaus, wo er sich wegen eines Oberschenkelhalsbruches in Behandlung befunden hatte.[4] /// Standort Wimregal PKis-Box81-U009 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.
-
Zum Thema: Fälschungen. Heft 2; Diagonal. Zeitschrift der Universität-Gesamthochschule Siegen. Jahrgang 1994.
Sprache: Deutsch
Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland
Signiert
EUR 9,50
Währung umrechnenEUR 3,99 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbZustand: Gut. 168 S.; Illustr.; 24 cm; kart. Gutes Ex.; Einband mit kl. Knick u. stw. leicht berieben. - Titelblatt von Karl Riha SIGNIERT und mit kl. Widmung. - INHALT : Editorial oder: Ein Grußwort voran! --- Zeitungsartikel - aktuell, Eine Auswahl. --- Peter Gendolla, Alles gelogen - Zur Geschichte der Fälschung. --- Hans Ulrich Reck, Ein aktueller Maschinentraum - Unwahr falsch. --- Bazon Brock, Der falsche Hase - Hakenschlagen auf Kunstrasen --- Ausriß aus einem TV-Treatment für den ORF Wien. --- Timm Ulrichs, Original und Fälschung. --- Kurt Kusenberg, Die Kunst, Kunst zu fälschen. --- Der Finanzminister in Nöten, Ein Fundstück. --- Roland Müller, Falschgeld. --- Kieselsteine oder Bonbons (echt oder falsch). --- Manfred Deckers, Die Würzburger Lügensteine --- und andere Fälschungen von Fossilien. --- Lars Rademacher, Ein Irrtum mit Folgen - --- Die verfälschende Rezeption Joachims von Fiore durch seine Interpreten --- zu Beginn des dreizehnten Jahrhunderts. --- Faschiertes (.) auch 'falscher Hase'genannt. --- Helmut Schrey, Spezialgebiet: Literary Forgeries. --- Ina Krauß, Eine diducktische Sensation. --- Karl Otto Conrady, Eine Miszelle zu Heinrich von Kleist. --- Karl Riha, Von Zaubristen und Scharlatanen. --- Dieter H. Stündel, James Joyce. --- Ernest Hemingway (Michal Viewegh), Die verlorene Generation und ich. --- Die Beatles treffen die Beatles. --- Erich Honecker, Tiefe Eindrücke und andere Gedichte, mitgeteilt v. H. Wald. --- Hans Schwerte, Friedrich Wilhelm Kurzvig - Ein Brief. --- Edmund F. Dräcker, Ministerialdirigent a.D. Dr. h.c. Edmund F. Dräcker --- - Eine Mitteilung aus dem Auswärtigen Amt. --- Sonett für Goethefreunde. --- Johann Wolfgang Goethe, Noch eines (brieflich). / (u.a.) Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 550.
-
Original Autogramm Peter Wieland (1930-2020) /// Autogramm Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 15,00
Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 3 verfügbar
In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Peter Wieland bildseitig mit schwarzem Edding signiert mit eigenhändigem Zusatz "Ihr / 2004" bzw. "Für STephan Ihr 1.3.2006" u.a. /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Peter Wieland (bürgerlich Ralf Sauer; * 6. Juli 1930 in Stralsund; ? 1. März oder 2. März 2020 in Berlin) war ein deutscher Musical- und Schlagersänger, Entertainer und Musikpädagoge. In der DDR gehörte er zu den bekanntesten Unterhaltungskünstlern. Ralf Sauer kam nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtling mit seiner Familie aus Stettin nach Köthen, wo er den Beruf des Zimmermanns erlernte. Sein Talent wurde beim Singen im örtlichen Kirchenchor entdeckt. Mitte der 1950er Jahre gewann er einen Hauptpreis beim Gesamtdeutschen Gesangswettbewerb in Leipzig und begann damit seine Laufbahn als Sänger in der DDR. Er studierte an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin, wo er zum lyrischen Bariton im Opernfach ausgebildet wurde. Nach dem Staatsexamen erhielt er sein erstes Engagement am Theater in Neustrelitz.[2] Nach dreijähriger Tätigkeit als Opernsänger wandte er sich dem zu dieser Zeit neuen Genre des Musicals zu. Mit Musicalmelodien war er Gesangssolist beim Rundfunkorchester des Deutschlandsenders in Ost-Berlin und beim Sender Leipzig. Hier legte er sich 1957 den Künstlernamen Peter Wieland zu. Mit einer Rolle in der musikalischen Revue Das goldene Prag begann seine langjährige Tätigkeit als Darsteller im Berliner Friedrichstadt-Palast, wo er später auch als Entertainer und Moderator auftrat. Wieland nahm einige Schallplatten auf, die meist Musical- und Operettenmelodien zum Inhalt hatten. Im Radio hatte er zeitweilig eine Sendereihe mit dem Namen Show in Stereo. Es ergaben sich Fernsehauftritte und Tourneen, meist in die damals sozialistischen Länder. Als Musikpädagoge unterrichtete er seit 1966 die junge Dagmar Frederic. Später traten beide regelmäßig im Duett auf und waren von 1977 bis 1983 auch miteinander verheiratet. 1979 präsentierten Frederic und Wieland im DDR-Fernsehen die Sendung Ein Kessel Buntes. Als Kollektiv erhielten sie am 6. Oktober 1981 den Nationalpreis der DDR aus den Händen von Erich Honecker. Nach der Wende hatte Wieland weiterhin Fernsehauftritte bei den Sommermelodien (ARD), der Operettengala der Elblandfestspiele Wittenberge und bei Weihnachten bei uns im MDR. Wieland trat bis 2008 noch gelegentlich als Sänger auf, unter anderem mit seinem Programm Peter Wieland - hautnah. Weiterhin hatte er ein erneutes Engagement in Flensburg am Theater. Ferner wirkte er 1992 für einige Episoden in der Daily-Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten als Walter Bornat, der Verlobte von Helga Markmann (Nora Bendig), mit. 1999 und 2000 gestaltete er über 50 Mal die Rolle des Kaisers Franz Joseph in der Operette Im weißen Rößl unter freiem Himmel in Berlin-Treptow. 2003 brachte er die Uraufführung des Theaterstückes zum 100. Geburtstages des von ihm sehr verehrten Schauspielers Heinz Rühmann am Festspielhaus Wittenberge heraus, das nach einer Idee von Heiko Reissig und unter der Regie von Hans-Hermann Krug entstand. Seinen Erfolgstitel Erinnerung widmete Peter Wieland ebenfalls Rühmann. Peter Wieland war lange ein gefragter Sänger und Entertainer. Im Mai 2008 hatte er einen Auftritt beim Frühlingsfest in Fürstenwalde als Kaiser Franz Joseph. Im August 2008 trat er in der Sommerrevue im Berliner Friedrichstadt-Palast auf. Am 7. Juni 2010 feierte er mit vielen bekannten Kollegen im ausverkauften Friedrichstadt-Palast Berlin seinen 80. Geburtstag. Auf der Bühne wurde er von Renate Holm und Präsident Heiko Reissig zum Ehrenmitglied der Europäischen Kulturwerkstatt e. V. (EKW) berufen. Am 18. März 2014 wurde Peter Wieland zum Köthen-Botschafter für die 900-Jahr-Feier 2015 berufen.[3] Wieland lebte mit seiner dritten Ehefrau Marion Sauer bis zu ihrem Tod im August 2017 in Berlin-Rudow. Peter Wieland starb in der Nacht zum 2. März 2020 im Alter von 89 Jahren in einem Berliner Krankenhaus, wo er sich wegen eines Oberschenkelhalsbruches in Behandlung befunden hatte.[4] /// Standort Wimregal PKis-Box11-U002ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.
-
Personiflage. Handelsblatt-Caricaturen.
Verlag: Döhlau: Luzifer Edition, 1985
Anbieter: Antiquariat Hartmut König, Nauen, OT Markee, Deutschland
Erstausgabe Signiert
EUR 12,00
Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den Warenkorbca 120 einseitig bedruckte Blätter/Tafeln ca 24 x 18 cm Orig.Kart (= Luzifer Edition Nr. 9) *** Erstausgabe. Vom Künstler signiert. Von Shintaro Abe bis Zhao Ziyang. Unter anderen: Ernst Albrecht, Norbert Blüm, WILLY BRANDT, Jimmy Carter, Erich Honecker, Philipp Jenninger, Oskar Lafontaine, Shimon Peres, Helmut Schmidt, F. J. Strauß, Nancy Reagan, Herbert Wehner, R.v. Weizsäcker, Manfred Wörner . . - Von guter Erhaltung.
-
Original Autogramm Lothar Späth (1937-2016) Ministerpräsident /// Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 12,00
Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbEchtfoto. Zustand: Gut. Farbfoto von Lothar Späth bildseitig mit schwarzem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Lothar Späth (* 16. November 1937 in Sigmaringen; ? 18. März 2016 in Stuttgart[1]) war ein deutscher Politiker (CDU) und Manager. Von 1978 bis 1991 war er Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Lothar Späth wurde am 16. November 1937 als Sohn eines Teilhabers einer Samenhandlung in Sigmaringen geboren. Zwei Jahre nach Späths Geburt[2] verließ die streng pietistische Familie Sigmaringen und zog nach Ilsfeld, wo er die Volksschule besuchte. Es folgten die Oberschule in Beilstein und das Robert-Mayer-Gymnasium in Heilbronn, das er bereits nach der mittleren Reife verließ. Zwischen 1953 und 1958 wurde Späth im Verwaltungsdienst der Stadt Giengen an der Brenz und beim Landratsamt Bad Mergentheim ausgebildet. 1958-1959 besuchte er die Staatliche Verwaltungsschule Stuttgart. Öffentliche Ämter und politische Tätigkeiten Lothar Späth (1983) Ab 1960 arbeitete Späth bei der Finanzverwaltung der Stadt Bietigheim. Er übernahm 1963 den Vorsitz des dortigen, 1961 von ihm selbst gegründeten[3] Stadtjugendrings. 1965 wurde er Beigeordneter und Finanzreferent der Stadt, 1967 wurde er dort zum Bürgermeister gewählt. Von 1970 bis 1974 war er Geschäftsführer der Neuen Heimat in Stuttgart und Hamburg und bis 1977 auch im Vorstand bzw. Aufsichtsrat der Baufirma C. Baresel AG in Stuttgart. 1968 wurde er erstmals als Abgeordneter in den Landtag gewählt. 1972 wurde er Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Nachdem er mehrmals ihm von Ministerpräsident Filbinger angebotene anderweitige Ministerämter zunächst ausgeschlagen hatte, wurde er 1978 zum Innenminister ernannt. Späth mit Erich Honecker (1987) Nach dem Rücktritt von Hans Filbinger wegen der ?Filbinger-Affäre? wurde Lothar Späth schließlich am 30. August 1978 zum fünften Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg gewählt. Er konnte sich gegen den Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel, der ebenfalls Ambitionen auf das Amt hatte, innerhalb der Landtagsfraktion durchsetzen. Von 1979 bis 1991 war er Landesvorsitzender der CDU von Baden-Württemberg, anschließend deren Ehrenvorsitzender, sowie von 1981 bis 1989 stellvertretender Bundesvorsitzender dieser Partei. Im Sommer 1989 gehörte er zu der innerparteilichen Gruppe, die auf dem CDU-Parteitag in Bremen eine Gegenkandidatur zum Vorsitzenden Helmut Kohl vorbereitete. Letzten Endes trat er aber doch nicht an.[4] Turnusgemäß war er als Ministerpräsident von Baden-Württemberg vom 1. November 1984 bis zum 31. Oktober 1985 Bundesratspräsident. Von 1987 bis 1990 war Späth Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Élysée-Vertrags. In dieser Funktion war er wesentlich an der Idee und Gründung des Fernseh-Kulturkanals Arte beteiligt.[5] Späth konnte bei den Landtagswahlen 1980, 1984 und 1988 jeweils die absolute Mehrheit der CDU verteidigen, während die anderen Parteien stagnierten. Als Ministerpräsident trieb er die wirtschaftliche Entwicklung des Landes voran und erhielt für den ökonomischen Erfolg den Spitznamen ?Cleverle? Späth arbeitete dabei mit in Baden-Württemberg ansässigen Konzernen und deren Managern eng zusammen, insbesondere mit dem Wirtschaftsmanager und Konzernchef der Südmilch AG, Friedrich Wilhelm Schnitzler, dem Mercedes-Benz Konzern, der Porsche AG und mit deren Vorständen. Nachdem Späth im Zusammenhang mit der ?Traumschiff-Affäre? Vorteilsnahme bei Ferienreisen vorgeworfen worden war, trat er am 13. Januar 1991 von seinem Amt als Regierungschef zurück und legte am 31. Juli 1991 auch sein Mandat als Landtagsabgeordneter nieder. Sein Nachfolger als Ministerpräsident wurde der baden-württembergische CDU-Fraktionsvorsitzende Erwin Teufel. Sein Landtagsmandat übernahm der Oberbürgermeister von Bietigheim-Bissingen Manfred List. Im Bundestagswahlkampf 2002 war Späth als Schatten-Wirtschaftsminister Mitglied im Schattenkabinett des Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber. Sonstige Tätigkeiten Um mittelständische Unternehmen aus Baden-Württemberg bei der Erschließung ausländischer Märkte zu unterstützen, rief er 1984 die ?Exportstiftung Baden-Württemberg?, heute Baden-Württemberg International, ins Leben.[6] /// Standort Wimregal GAD-0343 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.
-
Original Autogramm Dieter Zimmer (1939-2024) /// Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 12,00
Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbBlatt. Zustand: Gut. Quadratisches Albumblatt von Dieter Zimmer bildseitig mit schwarzem Edding signiert mit eigenhändigem Zusatz "Für Karl-Heinz mit besten Wünschen, 11.9.02", umseitig Fotoecken /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Dieter Zimmer (* 19. Dezember 1939 in Leipzig; ? 17. Juni 2024 in Wiesbaden[1]) war ein deutscher Fernsehjournalist und Schriftsteller. Zimmer wuchs in Leipzig (im Stadtteil Gohlis)[2] auf und besuchte dort die Schule. Seinen Vater, einen Polizeioffizier, hat er nicht mehr bewusst kennengelernt. Dieser wurde 1941 möglicherweise unter einem Vorwand wegen politischer Unzuverlässigkeit in einem deutschen Straflager inhaftiert und in den Norden Norwegens verlegt; er kam dort 1942 im Alter von 36 Jahren ums Leben.[3] Im Jahr 1953, als Dieter Zimmer 13 Jahre alt war, floh seine Mutter mit ihm in das zu dieser Zeit noch offene West-Berlin. Von dort wurden beide in ein Flüchtlingslager im Südwesten der Bundesrepublik ausgeflogen und in der Folge zunächst von Bekannten in Baden-Baden aufgenommen. Dort besuchte Zimmer das Markgraf-Ludwig-Gymnasium. Später erfolgte ein Umzug nach Hannover, wo Zimmer sein Abitur an der Goetheschule machte. Im Anschluss daran leistete er seinen Wehrdienst ab. Zwischen 1961 und 1967 studierte Zimmer an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und der Ludwig-Maximilians-Universität München in den Fächern Zeitungswissenschaft, Politologie und Geschichte. Während der Semesterferien erarbeitete sich Zimmer unter anderen bei Continental und Volkswagen, am Theater der Jugend in München und als Taxifahrer das nötige Geld, um sein Studium finanzieren zu können. Die Schauspielerin Marlene Zimmer ist seine Tochter.[4] Berufliche Entwicklung Südwestfunk Nach Abschluss seines Studiums war Zimmer im Jahr 1968 als Hospitant beim SWF, woraus sich seine spätere Tätigkeit als Fernsehreporter entwickelte, für Regionales, Beiträge in der Tagesschau und als Moderator der Stuttgarter Abendschau. ZDF Im Jahr 1972 wechselte Zimmer zum ZDF und war dort zunächst als Reporter und Moderator der Sendung Die Drehscheibe tätig. 1973 wurde er Studioredakteur der heute-Nachrichten um 19 Uhr. 1978 wechselte er in die Hauptredaktion Innenpolitik und war an Filmreportagen und Dokumentationen über deutsche Zeitgeschichte, insbesondere über die DDR, beteiligt. Live-Reportagen lieferte er von bedeutenden Ereignissen wie den Besuchen von Helmut Schmidt in der DDR (Dezember 1981) am Werbellinsee und in Güstrow, von Ronald Reagan in Berlin (Juni 1987), Erich Honecker (September 1987) und Michail Gorbatschow in Bonn (Juni 1989). Von 1981 bis 1999 präsentierte Zimmer im ZDF-Wahlstudio Hochrechnungen und Analysen, von 1984 bis 1989 war er Gastgeber im ZDF-Sonntagsgespräch, von 1984 bis 2002 leitete er die Redaktion Dokumentation und Reportagen. Dabei war er für innenpolitische Themen und unter anderen für Sendungen der Reihen Die ZDF-Reportage, Die ZDF-Dokumentation und Ganz persönlich verantwortlich. 1989 riss ihn ein Schlaganfall aus dem beruflichen und privaten Alltag, eine Erfahrung, die er später in einem Buch verarbeitete.[5] Nach einem zweiten, weniger schweren Schlaganfall widmete sich Zimmer auch im Fernsehen diesem Thema. Er trat bei Hans Mohl in der Sendung Gesundheitsmagazin Praxis auf und berichtete über seine Krankheit. Ziel der Sendung war es vor allem, die Bevölkerung auf Vorboten eines drohenden Schlaganfalls hinzuweisen.[6] Von 1994 bis 2010 war Zimmer Moderator der Reihe ?Leipziger Gespräche? im Gewandhaus in Leipzig.[7] 2002 schied er beim ZDF aus.[8] ?Dieter Zimmer war immer ein Reporter, der Distanz zu den Personen und Themen seiner Arbeit hielt, aber sie gerade dadurch klar und verständlich erfasste. Dieter Zimmers Instinkt für Wichtiges, sein untrügliches Gefühl für Geschichten wird den Dokumentationen und Reportagen des ZDF künftig fehlen.? - Nikolaus Brender, ZDF-Chefredakteur, 30. April 2002 Schriftsteller Seit 1980 betätigte sich Zimmer auch als Autor. Einige seiner Romane und Sachbücher sind autobiografisch gefärbt. Sein Erstling Für?n Groschen Brause, der sich mit seiner Kindheit im Leipzig der Nachkriegszeit und den Umständen seiner Flucht aus der DDR beschäftigt, wurde 1983 für das Fernsehen verfilmt; 1994/1995 gelangte auch sein Buch Kalifornisches Quartett als Dreiteiler ins Fernsehen. Sein Geburtsort Leipzig war für Zimmer Dreh- und Angelpunkt vielfältiger Betrachtung, so in den Sachbüchern Mein Leipzig - lob ich?s mir? und Leipzig - Phönix aus viel Asche, deren Basis seine gleich betitelten ZDF-Fernsehreportagen aus den Jahren 1980 und 1991 waren.[9] Auszeichnungen Zimmer wurde 1984 mit dem Jakob-Kaiser-Preis für die Verfilmung seines Buches bzw. Drehbuches zu Für?n Groschen Brause und 1988 mit dem Adolf-Grimme-Preis in Gold für Phantom-Fieber (zusammen mit Hartmut Schoen und Carl-Franz Hutterer) ausgezeichnet. /// Standort Wimregal Ill-Umschl2025-503 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.
-
Original Autogramm Dieter Zimmer (1939-2024) /// Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 12,00
Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Dieter Zimmer bildseitig mit schwarzem Edding signiert mit eigenhändigem Zusatz "Für Karl-Heinz Mehler" /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Dieter Zimmer (* 19. Dezember 1939 in Leipzig; ? 17. Juni 2024 in Wiesbaden[1]) war ein deutscher Fernsehjournalist und Schriftsteller. Zimmer wuchs in Leipzig (im Stadtteil Gohlis)[2] auf und besuchte dort die Schule. Seinen Vater, einen Polizeioffizier, hat er nicht mehr bewusst kennengelernt. Dieser wurde 1941 möglicherweise unter einem Vorwand wegen politischer Unzuverlässigkeit in einem deutschen Straflager inhaftiert und in den Norden Norwegens verlegt; er kam dort 1942 im Alter von 36 Jahren ums Leben.[3] Im Jahr 1953, als Dieter Zimmer 13 Jahre alt war, floh seine Mutter mit ihm in das zu dieser Zeit noch offene West-Berlin. Von dort wurden beide in ein Flüchtlingslager im Südwesten der Bundesrepublik ausgeflogen und in der Folge zunächst von Bekannten in Baden-Baden aufgenommen. Dort besuchte Zimmer das Markgraf-Ludwig-Gymnasium. Später erfolgte ein Umzug nach Hannover, wo Zimmer sein Abitur an der Goetheschule machte. Im Anschluss daran leistete er seinen Wehrdienst ab. Zwischen 1961 und 1967 studierte Zimmer an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und der Ludwig-Maximilians-Universität München in den Fächern Zeitungswissenschaft, Politologie und Geschichte. Während der Semesterferien erarbeitete sich Zimmer unter anderen bei Continental und Volkswagen, am Theater der Jugend in München und als Taxifahrer das nötige Geld, um sein Studium finanzieren zu können. Die Schauspielerin Marlene Zimmer ist seine Tochter.[4] Berufliche Entwicklung Südwestfunk Nach Abschluss seines Studiums war Zimmer im Jahr 1968 als Hospitant beim SWF, woraus sich seine spätere Tätigkeit als Fernsehreporter entwickelte, für Regionales, Beiträge in der Tagesschau und als Moderator der Stuttgarter Abendschau. ZDF Im Jahr 1972 wechselte Zimmer zum ZDF und war dort zunächst als Reporter und Moderator der Sendung Die Drehscheibe tätig. 1973 wurde er Studioredakteur der heute-Nachrichten um 19 Uhr. 1978 wechselte er in die Hauptredaktion Innenpolitik und war an Filmreportagen und Dokumentationen über deutsche Zeitgeschichte, insbesondere über die DDR, beteiligt. Live-Reportagen lieferte er von bedeutenden Ereignissen wie den Besuchen von Helmut Schmidt in der DDR (Dezember 1981) am Werbellinsee und in Güstrow, von Ronald Reagan in Berlin (Juni 1987), Erich Honecker (September 1987) und Michail Gorbatschow in Bonn (Juni 1989). Von 1981 bis 1999 präsentierte Zimmer im ZDF-Wahlstudio Hochrechnungen und Analysen, von 1984 bis 1989 war er Gastgeber im ZDF-Sonntagsgespräch, von 1984 bis 2002 leitete er die Redaktion Dokumentation und Reportagen. Dabei war er für innenpolitische Themen und unter anderen für Sendungen der Reihen Die ZDF-Reportage, Die ZDF-Dokumentation und Ganz persönlich verantwortlich. 1989 riss ihn ein Schlaganfall aus dem beruflichen und privaten Alltag, eine Erfahrung, die er später in einem Buch verarbeitete.[5] Nach einem zweiten, weniger schweren Schlaganfall widmete sich Zimmer auch im Fernsehen diesem Thema. Er trat bei Hans Mohl in der Sendung Gesundheitsmagazin Praxis auf und berichtete über seine Krankheit. Ziel der Sendung war es vor allem, die Bevölkerung auf Vorboten eines drohenden Schlaganfalls hinzuweisen.[6] Von 1994 bis 2010 war Zimmer Moderator der Reihe ?Leipziger Gespräche? im Gewandhaus in Leipzig.[7] 2002 schied er beim ZDF aus.[8] ?Dieter Zimmer war immer ein Reporter, der Distanz zu den Personen und Themen seiner Arbeit hielt, aber sie gerade dadurch klar und verständlich erfasste. Dieter Zimmers Instinkt für Wichtiges, sein untrügliches Gefühl für Geschichten wird den Dokumentationen und Reportagen des ZDF künftig fehlen.? - Nikolaus Brender, ZDF-Chefredakteur, 30. April 2002 Schriftsteller Seit 1980 betätigte sich Zimmer auch als Autor. Einige seiner Romane und Sachbücher sind autobiografisch gefärbt. Sein Erstling Für?n Groschen Brause, der sich mit seiner Kindheit im Leipzig der Nachkriegszeit und den Umständen seiner Flucht aus der DDR beschäftigt, wurde 1983 für das Fernsehen verfilmt; 1994/1995 gelangte auch sein Buch Kalifornisches Quartett als Dreiteiler ins Fernsehen. Sein Geburtsort Leipzig war für Zimmer Dreh- und Angelpunkt vielfältiger Betrachtung, so in den Sachbüchern Mein Leipzig - lob ich?s mir? und Leipzig - Phönix aus viel Asche, deren Basis seine gleich betitelten ZDF-Fernsehreportagen aus den Jahren 1980 und 1991 waren.[9] Auszeichnungen Zimmer wurde 1984 mit dem Jakob-Kaiser-Preis für die Verfilmung seines Buches bzw. Drehbuches zu Für?n Groschen Brause und 1988 mit dem Adolf-Grimme-Preis in Gold für Phantom-Fieber (zusammen mit Hartmut Schoen und Carl-Franz Hutterer) ausgezeichnet. /// Standort Wimregal GAD-20.068 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.
-
Original Autogramm Dieter Zimmer (1939-2024) /// Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 12,00
Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 2 verfügbar
In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Blankopostkarte mit aufmontiertem Druckfoto von Dieter Zimmer mit schwarzem Edding signiert /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Dieter Zimmer (* 19. Dezember 1939 in Leipzig; ? 17. Juni 2024 in Wiesbaden[1]) war ein deutscher Fernsehjournalist und Schriftsteller. Zimmer wuchs in Leipzig (im Stadtteil Gohlis)[2] auf und besuchte dort die Schule. Seinen Vater, einen Polizeioffizier, hat er nicht mehr bewusst kennengelernt. Dieser wurde 1941 möglicherweise unter einem Vorwand wegen politischer Unzuverlässigkeit in einem deutschen Straflager inhaftiert und in den Norden Norwegens verlegt; er kam dort 1942 im Alter von 36 Jahren ums Leben.[3] Im Jahr 1953, als Dieter Zimmer 13 Jahre alt war, floh seine Mutter mit ihm in das zu dieser Zeit noch offene West-Berlin. Von dort wurden beide in ein Flüchtlingslager im Südwesten der Bundesrepublik ausgeflogen und in der Folge zunächst von Bekannten in Baden-Baden aufgenommen. Dort besuchte Zimmer das Markgraf-Ludwig-Gymnasium. Später erfolgte ein Umzug nach Hannover, wo Zimmer sein Abitur an der Goetheschule machte. Im Anschluss daran leistete er seinen Wehrdienst ab. Zwischen 1961 und 1967 studierte Zimmer an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und der Ludwig-Maximilians-Universität München in den Fächern Zeitungswissenschaft, Politologie und Geschichte. Während der Semesterferien erarbeitete sich Zimmer unter anderen bei Continental und Volkswagen, am Theater der Jugend in München und als Taxifahrer das nötige Geld, um sein Studium finanzieren zu können. Die Schauspielerin Marlene Zimmer ist seine Tochter.[4] Berufliche Entwicklung Südwestfunk Nach Abschluss seines Studiums war Zimmer im Jahr 1968 als Hospitant beim SWF, woraus sich seine spätere Tätigkeit als Fernsehreporter entwickelte, für Regionales, Beiträge in der Tagesschau und als Moderator der Stuttgarter Abendschau. ZDF Im Jahr 1972 wechselte Zimmer zum ZDF und war dort zunächst als Reporter und Moderator der Sendung Die Drehscheibe tätig. 1973 wurde er Studioredakteur der heute-Nachrichten um 19 Uhr. 1978 wechselte er in die Hauptredaktion Innenpolitik und war an Filmreportagen und Dokumentationen über deutsche Zeitgeschichte, insbesondere über die DDR, beteiligt. Live-Reportagen lieferte er von bedeutenden Ereignissen wie den Besuchen von Helmut Schmidt in der DDR (Dezember 1981) am Werbellinsee und in Güstrow, von Ronald Reagan in Berlin (Juni 1987), Erich Honecker (September 1987) und Michail Gorbatschow in Bonn (Juni 1989). Von 1981 bis 1999 präsentierte Zimmer im ZDF-Wahlstudio Hochrechnungen und Analysen, von 1984 bis 1989 war er Gastgeber im ZDF-Sonntagsgespräch, von 1984 bis 2002 leitete er die Redaktion Dokumentation und Reportagen. Dabei war er für innenpolitische Themen und unter anderen für Sendungen der Reihen Die ZDF-Reportage, Die ZDF-Dokumentation und Ganz persönlich verantwortlich. 1989 riss ihn ein Schlaganfall aus dem beruflichen und privaten Alltag, eine Erfahrung, die er später in einem Buch verarbeitete.[5] Nach einem zweiten, weniger schweren Schlaganfall widmete sich Zimmer auch im Fernsehen diesem Thema. Er trat bei Hans Mohl in der Sendung Gesundheitsmagazin Praxis auf und berichtete über seine Krankheit. Ziel der Sendung war es vor allem, die Bevölkerung auf Vorboten eines drohenden Schlaganfalls hinzuweisen.[6] Von 1994 bis 2010 war Zimmer Moderator der Reihe ?Leipziger Gespräche? im Gewandhaus in Leipzig.[7] 2002 schied er beim ZDF aus.[8] ?Dieter Zimmer war immer ein Reporter, der Distanz zu den Personen und Themen seiner Arbeit hielt, aber sie gerade dadurch klar und verständlich erfasste. Dieter Zimmers Instinkt für Wichtiges, sein untrügliches Gefühl für Geschichten wird den Dokumentationen und Reportagen des ZDF künftig fehlen.? - Nikolaus Brender, ZDF-Chefredakteur, 30. April 2002 Schriftsteller Seit 1980 betätigte sich Zimmer auch als Autor. Einige seiner Romane und Sachbücher sind autobiografisch gefärbt. Sein Erstling Für?n Groschen Brause, der sich mit seiner Kindheit im Leipzig der Nachkriegszeit und den Umständen seiner Flucht aus der DDR beschäftigt, wurde 1983 für das Fernsehen verfilmt; 1994/1995 gelangte auch sein Buch Kalifornisches Quartett als Dreiteiler ins Fernsehen. Sein Geburtsort Leipzig war für Zimmer Dreh- und Angelpunkt vielfältiger Betrachtung, so in den Sachbüchern Mein Leipzig - lob ich?s mir? und Leipzig - Phönix aus viel Asche, deren Basis seine gleich betitelten ZDF-Fernsehreportagen aus den Jahren 1980 und 1991 waren.[9] Auszeichnungen Zimmer wurde 1984 mit dem Jakob-Kaiser-Preis für die Verfilmung seines Buches bzw. Drehbuches zu Für?n Groschen Brause und 1988 mit dem Adolf-Grimme-Preis in Gold für Phantom-Fieber (zusammen mit Hartmut Schoen und Carl-Franz Hutterer) ausgezeichnet. /// Standort Wimregal GAD-10.414ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.
-
Original Autogramm Dieter Zimmer (1939-2024) /// Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 12,00
Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Blankopostkarte mit aufmontiertem Druckfoto von Dieter Zimmer mit schwarzem Edding signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Dieter Zimmer (* 19. Dezember 1939 in Leipzig; ? 17. Juni 2024 in Wiesbaden[1]) war ein deutscher Fernsehjournalist und Schriftsteller. Zimmer wuchs in Leipzig (im Stadtteil Gohlis)[2] auf und besuchte dort die Schule. Seinen Vater, einen Polizeioffizier, hat er nicht mehr bewusst kennengelernt. Dieser wurde 1941 möglicherweise unter einem Vorwand wegen politischer Unzuverlässigkeit in einem deutschen Straflager inhaftiert und in den Norden Norwegens verlegt; er kam dort 1942 im Alter von 36 Jahren ums Leben.[3] Im Jahr 1953, als Dieter Zimmer 13 Jahre alt war, floh seine Mutter mit ihm in das zu dieser Zeit noch offene West-Berlin. Von dort wurden beide in ein Flüchtlingslager im Südwesten der Bundesrepublik ausgeflogen und in der Folge zunächst von Bekannten in Baden-Baden aufgenommen. Dort besuchte Zimmer das Markgraf-Ludwig-Gymnasium. Später erfolgte ein Umzug nach Hannover, wo Zimmer sein Abitur an der Goetheschule machte. Im Anschluss daran leistete er seinen Wehrdienst ab. Zwischen 1961 und 1967 studierte Zimmer an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und der Ludwig-Maximilians-Universität München in den Fächern Zeitungswissenschaft, Politologie und Geschichte. Während der Semesterferien erarbeitete sich Zimmer unter anderen bei Continental und Volkswagen, am Theater der Jugend in München und als Taxifahrer das nötige Geld, um sein Studium finanzieren zu können. Die Schauspielerin Marlene Zimmer ist seine Tochter.[4] Berufliche Entwicklung Südwestfunk Nach Abschluss seines Studiums war Zimmer im Jahr 1968 als Hospitant beim SWF, woraus sich seine spätere Tätigkeit als Fernsehreporter entwickelte, für Regionales, Beiträge in der Tagesschau und als Moderator der Stuttgarter Abendschau. ZDF Im Jahr 1972 wechselte Zimmer zum ZDF und war dort zunächst als Reporter und Moderator der Sendung Die Drehscheibe tätig. 1973 wurde er Studioredakteur der heute-Nachrichten um 19 Uhr. 1978 wechselte er in die Hauptredaktion Innenpolitik und war an Filmreportagen und Dokumentationen über deutsche Zeitgeschichte, insbesondere über die DDR, beteiligt. Live-Reportagen lieferte er von bedeutenden Ereignissen wie den Besuchen von Helmut Schmidt in der DDR (Dezember 1981) am Werbellinsee und in Güstrow, von Ronald Reagan in Berlin (Juni 1987), Erich Honecker (September 1987) und Michail Gorbatschow in Bonn (Juni 1989). Von 1981 bis 1999 präsentierte Zimmer im ZDF-Wahlstudio Hochrechnungen und Analysen, von 1984 bis 1989 war er Gastgeber im ZDF-Sonntagsgespräch, von 1984 bis 2002 leitete er die Redaktion Dokumentation und Reportagen. Dabei war er für innenpolitische Themen und unter anderen für Sendungen der Reihen Die ZDF-Reportage, Die ZDF-Dokumentation und Ganz persönlich verantwortlich. 1989 riss ihn ein Schlaganfall aus dem beruflichen und privaten Alltag, eine Erfahrung, die er später in einem Buch verarbeitete.[5] Nach einem zweiten, weniger schweren Schlaganfall widmete sich Zimmer auch im Fernsehen diesem Thema. Er trat bei Hans Mohl in der Sendung Gesundheitsmagazin Praxis auf und berichtete über seine Krankheit. Ziel der Sendung war es vor allem, die Bevölkerung auf Vorboten eines drohenden Schlaganfalls hinzuweisen.[6] Von 1994 bis 2010 war Zimmer Moderator der Reihe ?Leipziger Gespräche? im Gewandhaus in Leipzig.[7] 2002 schied er beim ZDF aus.[8] ?Dieter Zimmer war immer ein Reporter, der Distanz zu den Personen und Themen seiner Arbeit hielt, aber sie gerade dadurch klar und verständlich erfasste. Dieter Zimmers Instinkt für Wichtiges, sein untrügliches Gefühl für Geschichten wird den Dokumentationen und Reportagen des ZDF künftig fehlen.? - Nikolaus Brender, ZDF-Chefredakteur, 30. April 2002 Schriftsteller Seit 1980 betätigte sich Zimmer auch als Autor. Einige seiner Romane und Sachbücher sind autobiografisch gefärbt. Sein Erstling Für?n Groschen Brause, der sich mit seiner Kindheit im Leipzig der Nachkriegszeit und den Umständen seiner Flucht aus der DDR beschäftigt, wurde 1983 für das Fernsehen verfilmt; 1994/1995 gelangte auch sein Buch Kalifornisches Quartett als Dreiteiler ins Fernsehen. Sein Geburtsort Leipzig war für Zimmer Dreh- und Angelpunkt vielfältiger Betrachtung, so in den Sachbüchern Mein Leipzig - lob ich?s mir? und Leipzig - Phönix aus viel Asche, deren Basis seine gleich betitelten ZDF-Fernsehreportagen aus den Jahren 1980 und 1991 waren.[9] Auszeichnungen Zimmer wurde 1984 mit dem Jakob-Kaiser-Preis für die Verfilmung seines Buches bzw. Drehbuches zu Für?n Groschen Brause und 1988 mit dem Adolf-Grimme-Preis in Gold für Phantom-Fieber (zusammen mit Hartmut Schoen und Carl-Franz Hutterer) ausgezeichnet. /// Standort Wimregal GAD-10.415 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.
-
Original Autogramm Dieter Zimmer (1939-2024) /// Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 12,00
Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbBlatt. Zustand: Gut. Albumblatt A4 mit aufmontiertem Druckfoto von Dieter Zimmer mit schwarzem Edding signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Dieter Zimmer (* 19. Dezember 1939 in Leipzig; 17. Juni 2024 in Wiesbaden[1]) war ein deutscher Fernsehjournalist und Schriftsteller. Zimmer wuchs in Leipzig (im Stadtteil Gohlis)[2] auf und besuchte dort die Schule. Seinen Vater, einen Polizeioffizier, hat er nicht mehr bewusst kennengelernt. Dieser wurde 1941 möglicherweise unter einem Vorwand wegen politischer Unzuverlässigkeit in einem deutschen Straflager inhaftiert und in den Norden Norwegens verlegt; er kam dort 1942 im Alter von 36 Jahren ums Leben.[3] Im Jahr 1953, als Dieter Zimmer 13 Jahre alt war, floh seine Mutter mit ihm in das zu dieser Zeit noch offene West-Berlin. Von dort wurden beide in ein Flüchtlingslager im Südwesten der Bundesrepublik ausgeflogen und in der Folge zunächst von Bekannten in Baden-Baden aufgenommen. Dort besuchte Zimmer das Markgraf-Ludwig-Gymnasium. Später erfolgte ein Umzug nach Hannover, wo Zimmer sein Abitur an der Goetheschule machte. Im Anschluss daran leistete er seinen Wehrdienst ab. Zwischen 1961 und 1967 studierte Zimmer an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und der Ludwig-Maximilians-Universität München in den Fächern Zeitungswissenschaft, Politologie und Geschichte. Während der Semesterferien erarbeitete sich Zimmer unter anderen bei Continental und Volkswagen, am Theater der Jugend in München und als Taxifahrer das nötige Geld, um sein Studium finanzieren zu können. Die Schauspielerin Marlene Zimmer ist seine Tochter.[4] Berufliche Entwicklung Südwestfunk Nach Abschluss seines Studiums war Zimmer im Jahr 1968 als Hospitant beim SWF, woraus sich seine spätere Tätigkeit als Fernsehreporter entwickelte, für Regionales, Beiträge in der Tagesschau und als Moderator der Stuttgarter Abendschau. ZDF Im Jahr 1972 wechselte Zimmer zum ZDF und war dort zunächst als Reporter und Moderator der Sendung Die Drehscheibe tätig. 1973 wurde er Studioredakteur der heute-Nachrichten um 19 Uhr. 1978 wechselte er in die Hauptredaktion Innenpolitik und war an Filmreportagen und Dokumentationen über deutsche Zeitgeschichte, insbesondere über die DDR, beteiligt. Live-Reportagen lieferte er von bedeutenden Ereignissen wie den Besuchen von Helmut Schmidt in der DDR (Dezember 1981) am Werbellinsee und in Güstrow, von Ronald Reagan in Berlin (Juni 1987), Erich Honecker (September 1987) und Michail Gorbatschow in Bonn (Juni 1989). Von 1981 bis 1999 präsentierte Zimmer im ZDF-Wahlstudio Hochrechnungen und Analysen, von 1984 bis 1989 war er Gastgeber im ZDF-Sonntagsgespräch, von 1984 bis 2002 leitete er die Redaktion Dokumentation und Reportagen. Dabei war er für innenpolitische Themen und unter anderen für Sendungen der Reihen Die ZDF-Reportage, Die ZDF-Dokumentation und Ganz persönlich verantwortlich. 1989 riss ihn ein Schlaganfall aus dem beruflichen und privaten Alltag, eine Erfahrung, die er später in einem Buch verarbeitete.[5] Nach einem zweiten, weniger schweren Schlaganfall widmete sich Zimmer auch im Fernsehen diesem Thema. Er trat bei Hans Mohl in der Sendung Gesundheitsmagazin Praxis auf und berichtete über seine Krankheit. Ziel der Sendung war es vor allem, die Bevölkerung auf Vorboten eines drohenden Schlaganfalls hinzuweisen.[6] Von 1994 bis 2010 war Zimmer Moderator der Reihe Leipziger Gespräche" im Gewandhaus in Leipzig.[7] 2002 schied er beim ZDF aus.[8] Dieter Zimmer war immer ein Reporter, der Distanz zu den Personen und Themen seiner Arbeit hielt, aber sie gerade dadurch klar und verständlich erfasste. Dieter Zimmers Instinkt für Wichtiges, sein untrügliches Gefühl für Geschichten wird den Dokumentationen und Reportagen des ZDF künftig fehlen." Nikolaus Brender, ZDF-Chefredakteur, 30. April 2002 Schriftsteller Seit 1980 betätigte sich Zimmer auch als Autor. Einige seiner Romane und Sachbücher sind autobiografisch gefärbt. Sein Erstling Für'n Groschen Brause, der sich mit seiner Kindheit im Leipzig der Nachkriegszeit und den Umständen seiner Flucht aus der DDR beschäftigt, wurde 1983 für das Fernsehen verfilmt; 1994/1995 gelangte auch sein Buch Kalifornisches Quartett als Dreiteiler ins Fernsehen. Sein Geburtsort Leipzig war für Zimmer Dreh- und Angelpunkt vielfältiger Betrachtung, so in den Sachbüchern Mein Leipzig lob ich's mir? und Leipzig Phönix aus viel Asche, deren Basis seine gleich betitelten ZDF-Fernsehreportagen aus den Jahren 1980 und 1991 waren.[9] Auszeichnungen Zimmer wurde 1984 mit dem Jakob-Kaiser-Preis für die Verfilmung seines Buches bzw. Drehbuches zu Für'n Groschen Brause und 1988 mit dem Adolf-Grimme-Preis in Gold für Phantom-Fieber (zusammen mit Hartmut Schoen und Carl-Franz Hutterer) ausgezeichnet. /// Standort Wimregal Ill-Umschl2025-012 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.
-
Original Autogramm Lothar Späth (1937-2016) Ministerpräsident /// Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 12,00
Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbEchtfoto. Zustand: Gut. Farbfoto von Lothar Späth bildseitig mit schwarzem Stift signiert, umseitig Jenoptikbapperl /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Lothar Späth (* 16. November 1937 in Sigmaringen; ? 18. März 2016 in Stuttgart[1]) war ein deutscher Politiker (CDU) und Manager. Von 1978 bis 1991 war er Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Lothar Späth wurde am 16. November 1937 als Sohn eines Teilhabers einer Samenhandlung in Sigmaringen geboren. Zwei Jahre nach Späths Geburt[2] verließ die streng pietistische Familie Sigmaringen und zog nach Ilsfeld, wo er die Volksschule besuchte. Es folgten die Oberschule in Beilstein und das Robert-Mayer-Gymnasium in Heilbronn, das er bereits nach der mittleren Reife verließ. Zwischen 1953 und 1958 wurde Späth im Verwaltungsdienst der Stadt Giengen an der Brenz und beim Landratsamt Bad Mergentheim ausgebildet. 1958-1959 besuchte er die Staatliche Verwaltungsschule Stuttgart. Öffentliche Ämter und politische Tätigkeiten Lothar Späth (1983) Ab 1960 arbeitete Späth bei der Finanzverwaltung der Stadt Bietigheim. Er übernahm 1963 den Vorsitz des dortigen, 1961 von ihm selbst gegründeten[3] Stadtjugendrings. 1965 wurde er Beigeordneter und Finanzreferent der Stadt, 1967 wurde er dort zum Bürgermeister gewählt. Von 1970 bis 1974 war er Geschäftsführer der Neuen Heimat in Stuttgart und Hamburg und bis 1977 auch im Vorstand bzw. Aufsichtsrat der Baufirma C. Baresel AG in Stuttgart. 1968 wurde er erstmals als Abgeordneter in den Landtag gewählt. 1972 wurde er Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Nachdem er mehrmals ihm von Ministerpräsident Filbinger angebotene anderweitige Ministerämter zunächst ausgeschlagen hatte, wurde er 1978 zum Innenminister ernannt. Späth mit Erich Honecker (1987) Nach dem Rücktritt von Hans Filbinger wegen der ?Filbinger-Affäre? wurde Lothar Späth schließlich am 30. August 1978 zum fünften Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg gewählt. Er konnte sich gegen den Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel, der ebenfalls Ambitionen auf das Amt hatte, innerhalb der Landtagsfraktion durchsetzen. Von 1979 bis 1991 war er Landesvorsitzender der CDU von Baden-Württemberg, anschließend deren Ehrenvorsitzender, sowie von 1981 bis 1989 stellvertretender Bundesvorsitzender dieser Partei. Im Sommer 1989 gehörte er zu der innerparteilichen Gruppe, die auf dem CDU-Parteitag in Bremen eine Gegenkandidatur zum Vorsitzenden Helmut Kohl vorbereitete. Letzten Endes trat er aber doch nicht an.[4] Turnusgemäß war er als Ministerpräsident von Baden-Württemberg vom 1. November 1984 bis zum 31. Oktober 1985 Bundesratspräsident. Von 1987 bis 1990 war Späth Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Élysée-Vertrags. In dieser Funktion war er wesentlich an der Idee und Gründung des Fernseh-Kulturkanals Arte beteiligt.[5] Späth konnte bei den Landtagswahlen 1980, 1984 und 1988 jeweils die absolute Mehrheit der CDU verteidigen, während die anderen Parteien stagnierten. Als Ministerpräsident trieb er die wirtschaftliche Entwicklung des Landes voran und erhielt für den ökonomischen Erfolg den Spitznamen ?Cleverle? Späth arbeitete dabei mit in Baden-Württemberg ansässigen Konzernen und deren Managern eng zusammen, insbesondere mit dem Wirtschaftsmanager und Konzernchef der Südmilch AG, Friedrich Wilhelm Schnitzler, dem Mercedes-Benz Konzern, der Porsche AG und mit deren Vorständen. Nachdem Späth im Zusammenhang mit der ?Traumschiff-Affäre? Vorteilsnahme bei Ferienreisen vorgeworfen worden war, trat er am 13. Januar 1991 von seinem Amt als Regierungschef zurück und legte am 31. Juli 1991 auch sein Mandat als Landtagsabgeordneter nieder. Sein Nachfolger als Ministerpräsident wurde der baden-württembergische CDU-Fraktionsvorsitzende Erwin Teufel. Sein Landtagsmandat übernahm der Oberbürgermeister von Bietigheim-Bissingen Manfred List. Im Bundestagswahlkampf 2002 war Späth als Schatten-Wirtschaftsminister Mitglied im Schattenkabinett des Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber. Sonstige Tätigkeiten Um mittelständische Unternehmen aus Baden-Württemberg bei der Erschließung ausländischer Märkte zu unterstützen, rief er 1984 die ?Exportstiftung Baden-Württemberg?, heute Baden-Württemberg International, ins Leben.[6] /// Standort Wimregal GAD-10.240 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.
-
Original Autogramm Lothar Späth (1937-2016) Ministerpräsident /// Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 12,00
Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Lothar Späth bildseitig mit schwarzem Edding signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Lothar Späth (* 16. November 1937 in Sigmaringen; ? 18. März 2016 in Stuttgart[1]) war ein deutscher Politiker (CDU) und Manager. Von 1978 bis 1991 war er Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Lothar Späth wurde am 16. November 1937 als Sohn eines Teilhabers einer Samenhandlung in Sigmaringen geboren. Zwei Jahre nach Späths Geburt[2] verließ die streng pietistische Familie Sigmaringen und zog nach Ilsfeld, wo er die Volksschule besuchte. Es folgten die Oberschule in Beilstein und das Robert-Mayer-Gymnasium in Heilbronn, das er bereits nach der mittleren Reife verließ. Zwischen 1953 und 1958 wurde Späth im Verwaltungsdienst der Stadt Giengen an der Brenz und beim Landratsamt Bad Mergentheim ausgebildet. 1958-1959 besuchte er die Staatliche Verwaltungsschule Stuttgart. Öffentliche Ämter und politische Tätigkeiten Lothar Späth (1983) Ab 1960 arbeitete Späth bei der Finanzverwaltung der Stadt Bietigheim. Er übernahm 1963 den Vorsitz des dortigen, 1961 von ihm selbst gegründeten[3] Stadtjugendrings. 1965 wurde er Beigeordneter und Finanzreferent der Stadt, 1967 wurde er dort zum Bürgermeister gewählt. Von 1970 bis 1974 war er Geschäftsführer der Neuen Heimat in Stuttgart und Hamburg und bis 1977 auch im Vorstand bzw. Aufsichtsrat der Baufirma C. Baresel AG in Stuttgart. 1968 wurde er erstmals als Abgeordneter in den Landtag gewählt. 1972 wurde er Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Nachdem er mehrmals ihm von Ministerpräsident Filbinger angebotene anderweitige Ministerämter zunächst ausgeschlagen hatte, wurde er 1978 zum Innenminister ernannt. Späth mit Erich Honecker (1987) Nach dem Rücktritt von Hans Filbinger wegen der ?Filbinger-Affäre? wurde Lothar Späth schließlich am 30. August 1978 zum fünften Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg gewählt. Er konnte sich gegen den Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel, der ebenfalls Ambitionen auf das Amt hatte, innerhalb der Landtagsfraktion durchsetzen. Von 1979 bis 1991 war er Landesvorsitzender der CDU von Baden-Württemberg, anschließend deren Ehrenvorsitzender, sowie von 1981 bis 1989 stellvertretender Bundesvorsitzender dieser Partei. Im Sommer 1989 gehörte er zu der innerparteilichen Gruppe, die auf dem CDU-Parteitag in Bremen eine Gegenkandidatur zum Vorsitzenden Helmut Kohl vorbereitete. Letzten Endes trat er aber doch nicht an.[4] Turnusgemäß war er als Ministerpräsident von Baden-Württemberg vom 1. November 1984 bis zum 31. Oktober 1985 Bundesratspräsident. Von 1987 bis 1990 war Späth Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Élysée-Vertrags. In dieser Funktion war er wesentlich an der Idee und Gründung des Fernseh-Kulturkanals Arte beteiligt.[5] Späth konnte bei den Landtagswahlen 1980, 1984 und 1988 jeweils die absolute Mehrheit der CDU verteidigen, während die anderen Parteien stagnierten. Als Ministerpräsident trieb er die wirtschaftliche Entwicklung des Landes voran und erhielt für den ökonomischen Erfolg den Spitznamen ?Cleverle? Späth arbeitete dabei mit in Baden-Württemberg ansässigen Konzernen und deren Managern eng zusammen, insbesondere mit dem Wirtschaftsmanager und Konzernchef der Südmilch AG, Friedrich Wilhelm Schnitzler, dem Mercedes-Benz Konzern, der Porsche AG und mit deren Vorständen. Nachdem Späth im Zusammenhang mit der ?Traumschiff-Affäre? Vorteilsnahme bei Ferienreisen vorgeworfen worden war, trat er am 13. Januar 1991 von seinem Amt als Regierungschef zurück und legte am 31. Juli 1991 auch sein Mandat als Landtagsabgeordneter nieder. Sein Nachfolger als Ministerpräsident wurde der baden-württembergische CDU-Fraktionsvorsitzende Erwin Teufel. Sein Landtagsmandat übernahm der Oberbürgermeister von Bietigheim-Bissingen Manfred List. Im Bundestagswahlkampf 2002 war Späth als Schatten-Wirtschaftsminister Mitglied im Schattenkabinett des Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber. Sonstige Tätigkeiten Um mittelständische Unternehmen aus Baden-Württemberg bei der Erschließung ausländischer Märkte zu unterstützen, rief er 1984 die ?Exportstiftung Baden-Württemberg?, heute Baden-Württemberg International, ins Leben.[6] /// Standort Wimregal PKis-Box85-U006 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.
-
Original Autogramm Lothar Späth (1937-2016) Ministerpräsident /// Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 12,00
Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Blanko-Postkarte von Lothar Späth mit blauem Edding signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Lothar Späth (* 16. November 1937 in Sigmaringen; ? 18. März 2016 in Stuttgart[1]) war ein deutscher Politiker (CDU) und Manager. Von 1978 bis 1991 war er Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Lothar Späth wurde am 16. November 1937 als Sohn eines Teilhabers einer Samenhandlung in Sigmaringen geboren. Zwei Jahre nach Späths Geburt[2] verließ die streng pietistische Familie Sigmaringen und zog nach Ilsfeld, wo er die Volksschule besuchte. Es folgten die Oberschule in Beilstein und das Robert-Mayer-Gymnasium in Heilbronn, das er bereits nach der mittleren Reife verließ. Zwischen 1953 und 1958 wurde Späth im Verwaltungsdienst der Stadt Giengen an der Brenz und beim Landratsamt Bad Mergentheim ausgebildet. 1958-1959 besuchte er die Staatliche Verwaltungsschule Stuttgart. Öffentliche Ämter und politische Tätigkeiten Lothar Späth (1983) Ab 1960 arbeitete Späth bei der Finanzverwaltung der Stadt Bietigheim. Er übernahm 1963 den Vorsitz des dortigen, 1961 von ihm selbst gegründeten[3] Stadtjugendrings. 1965 wurde er Beigeordneter und Finanzreferent der Stadt, 1967 wurde er dort zum Bürgermeister gewählt. Von 1970 bis 1974 war er Geschäftsführer der Neuen Heimat in Stuttgart und Hamburg und bis 1977 auch im Vorstand bzw. Aufsichtsrat der Baufirma C. Baresel AG in Stuttgart. 1968 wurde er erstmals als Abgeordneter in den Landtag gewählt. 1972 wurde er Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Nachdem er mehrmals ihm von Ministerpräsident Filbinger angebotene anderweitige Ministerämter zunächst ausgeschlagen hatte, wurde er 1978 zum Innenminister ernannt. Späth mit Erich Honecker (1987) Nach dem Rücktritt von Hans Filbinger wegen der ?Filbinger-Affäre? wurde Lothar Späth schließlich am 30. August 1978 zum fünften Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg gewählt. Er konnte sich gegen den Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel, der ebenfalls Ambitionen auf das Amt hatte, innerhalb der Landtagsfraktion durchsetzen. Von 1979 bis 1991 war er Landesvorsitzender der CDU von Baden-Württemberg, anschließend deren Ehrenvorsitzender, sowie von 1981 bis 1989 stellvertretender Bundesvorsitzender dieser Partei. Im Sommer 1989 gehörte er zu der innerparteilichen Gruppe, die auf dem CDU-Parteitag in Bremen eine Gegenkandidatur zum Vorsitzenden Helmut Kohl vorbereitete. Letzten Endes trat er aber doch nicht an.[4] Turnusgemäß war er als Ministerpräsident von Baden-Württemberg vom 1. November 1984 bis zum 31. Oktober 1985 Bundesratspräsident. Von 1987 bis 1990 war Späth Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Élysée-Vertrags. In dieser Funktion war er wesentlich an der Idee und Gründung des Fernseh-Kulturkanals Arte beteiligt.[5] Späth konnte bei den Landtagswahlen 1980, 1984 und 1988 jeweils die absolute Mehrheit der CDU verteidigen, während die anderen Parteien stagnierten. Als Ministerpräsident trieb er die wirtschaftliche Entwicklung des Landes voran und erhielt für den ökonomischen Erfolg den Spitznamen ?Cleverle? Späth arbeitete dabei mit in Baden-Württemberg ansässigen Konzernen und deren Managern eng zusammen, insbesondere mit dem Wirtschaftsmanager und Konzernchef der Südmilch AG, Friedrich Wilhelm Schnitzler, dem Mercedes-Benz Konzern, der Porsche AG und mit deren Vorständen. Nachdem Späth im Zusammenhang mit der ?Traumschiff-Affäre? Vorteilsnahme bei Ferienreisen vorgeworfen worden war, trat er am 13. Januar 1991 von seinem Amt als Regierungschef zurück und legte am 31. Juli 1991 auch sein Mandat als Landtagsabgeordneter nieder. Sein Nachfolger als Ministerpräsident wurde der baden-württembergische CDU-Fraktionsvorsitzende Erwin Teufel. Sein Landtagsmandat übernahm der Oberbürgermeister von Bietigheim-Bissingen Manfred List. Im Bundestagswahlkampf 2002 war Späth als Schatten-Wirtschaftsminister Mitglied im Schattenkabinett des Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber. Sonstige Tätigkeiten Um mittelständische Unternehmen aus Baden-Württemberg bei der Erschließung ausländischer Märkte zu unterstützen, rief er 1984 die ?Exportstiftung Baden-Württemberg?, heute Baden-Württemberg International, ins Leben.[6] /// Standort Wimregal Pkis-Box23-U21 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.
-
Original Autogramm Lothar Späth (1937-2016) Ministerpräsident /// Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 12,00
Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbBlatt. Zustand: Gut. Albumblatt/fragment von Lothar Späth mit blauem Edding signiert mit eigenhändigem Zusatz "26.2.98" /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Lothar Späth (* 16. November 1937 in Sigmaringen; ? 18. März 2016 in Stuttgart[1]) war ein deutscher Politiker (CDU) und Manager. Von 1978 bis 1991 war er Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Lothar Späth wurde am 16. November 1937 als Sohn eines Teilhabers einer Samenhandlung in Sigmaringen geboren. Zwei Jahre nach Späths Geburt[2] verließ die streng pietistische Familie Sigmaringen und zog nach Ilsfeld, wo er die Volksschule besuchte. Es folgten die Oberschule in Beilstein und das Robert-Mayer-Gymnasium in Heilbronn, das er bereits nach der mittleren Reife verließ. Zwischen 1953 und 1958 wurde Späth im Verwaltungsdienst der Stadt Giengen an der Brenz und beim Landratsamt Bad Mergentheim ausgebildet. 1958-1959 besuchte er die Staatliche Verwaltungsschule Stuttgart. Öffentliche Ämter und politische Tätigkeiten Lothar Späth (1983) Ab 1960 arbeitete Späth bei der Finanzverwaltung der Stadt Bietigheim. Er übernahm 1963 den Vorsitz des dortigen, 1961 von ihm selbst gegründeten[3] Stadtjugendrings. 1965 wurde er Beigeordneter und Finanzreferent der Stadt, 1967 wurde er dort zum Bürgermeister gewählt. Von 1970 bis 1974 war er Geschäftsführer der Neuen Heimat in Stuttgart und Hamburg und bis 1977 auch im Vorstand bzw. Aufsichtsrat der Baufirma C. Baresel AG in Stuttgart. 1968 wurde er erstmals als Abgeordneter in den Landtag gewählt. 1972 wurde er Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Nachdem er mehrmals ihm von Ministerpräsident Filbinger angebotene anderweitige Ministerämter zunächst ausgeschlagen hatte, wurde er 1978 zum Innenminister ernannt. Späth mit Erich Honecker (1987) Nach dem Rücktritt von Hans Filbinger wegen der ?Filbinger-Affäre? wurde Lothar Späth schließlich am 30. August 1978 zum fünften Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg gewählt. Er konnte sich gegen den Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel, der ebenfalls Ambitionen auf das Amt hatte, innerhalb der Landtagsfraktion durchsetzen. Von 1979 bis 1991 war er Landesvorsitzender der CDU von Baden-Württemberg, anschließend deren Ehrenvorsitzender, sowie von 1981 bis 1989 stellvertretender Bundesvorsitzender dieser Partei. Im Sommer 1989 gehörte er zu der innerparteilichen Gruppe, die auf dem CDU-Parteitag in Bremen eine Gegenkandidatur zum Vorsitzenden Helmut Kohl vorbereitete. Letzten Endes trat er aber doch nicht an.[4] Turnusgemäß war er als Ministerpräsident von Baden-Württemberg vom 1. November 1984 bis zum 31. Oktober 1985 Bundesratspräsident. Von 1987 bis 1990 war Späth Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Élysée-Vertrags. In dieser Funktion war er wesentlich an der Idee und Gründung des Fernseh-Kulturkanals Arte beteiligt.[5] Späth konnte bei den Landtagswahlen 1980, 1984 und 1988 jeweils die absolute Mehrheit der CDU verteidigen, während die anderen Parteien stagnierten. Als Ministerpräsident trieb er die wirtschaftliche Entwicklung des Landes voran und erhielt für den ökonomischen Erfolg den Spitznamen ?Cleverle? Späth arbeitete dabei mit in Baden-Württemberg ansässigen Konzernen und deren Managern eng zusammen, insbesondere mit dem Wirtschaftsmanager und Konzernchef der Südmilch AG, Friedrich Wilhelm Schnitzler, dem Mercedes-Benz Konzern, der Porsche AG und mit deren Vorständen. Nachdem Späth im Zusammenhang mit der ?Traumschiff-Affäre? Vorteilsnahme bei Ferienreisen vorgeworfen worden war, trat er am 13. Januar 1991 von seinem Amt als Regierungschef zurück und legte am 31. Juli 1991 auch sein Mandat als Landtagsabgeordneter nieder. Sein Nachfolger als Ministerpräsident wurde der baden-württembergische CDU-Fraktionsvorsitzende Erwin Teufel. Sein Landtagsmandat übernahm der Oberbürgermeister von Bietigheim-Bissingen Manfred List. Im Bundestagswahlkampf 2002 war Späth als Schatten-Wirtschaftsminister Mitglied im Schattenkabinett des Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber. Sonstige Tätigkeiten Um mittelständische Unternehmen aus Baden-Württemberg bei der Erschließung ausländischer Märkte zu unterstützen, rief er 1984 die ?Exportstiftung Baden-Württemberg?, heute Baden-Württemberg International, ins Leben.[6] /// Standort Wimregal Pkis-Box23-U22 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.
-
Original Autogramm Lothar Späth (1937-2016) Ministerpräsident /// Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 12,00
Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Lothar Späth bildseitig mit blauem Edding signiert mit eigenhändigem Zusatz "27.2.98 Für Botho" /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Lothar Späth (* 16. November 1937 in Sigmaringen; ? 18. März 2016 in Stuttgart[1]) war ein deutscher Politiker (CDU) und Manager. Von 1978 bis 1991 war er Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Lothar Späth wurde am 16. November 1937 als Sohn eines Teilhabers einer Samenhandlung in Sigmaringen geboren. Zwei Jahre nach Späths Geburt[2] verließ die streng pietistische Familie Sigmaringen und zog nach Ilsfeld, wo er die Volksschule besuchte. Es folgten die Oberschule in Beilstein und das Robert-Mayer-Gymnasium in Heilbronn, das er bereits nach der mittleren Reife verließ. Zwischen 1953 und 1958 wurde Späth im Verwaltungsdienst der Stadt Giengen an der Brenz und beim Landratsamt Bad Mergentheim ausgebildet. 1958-1959 besuchte er die Staatliche Verwaltungsschule Stuttgart. Öffentliche Ämter und politische Tätigkeiten Lothar Späth (1983) Ab 1960 arbeitete Späth bei der Finanzverwaltung der Stadt Bietigheim. Er übernahm 1963 den Vorsitz des dortigen, 1961 von ihm selbst gegründeten[3] Stadtjugendrings. 1965 wurde er Beigeordneter und Finanzreferent der Stadt, 1967 wurde er dort zum Bürgermeister gewählt. Von 1970 bis 1974 war er Geschäftsführer der Neuen Heimat in Stuttgart und Hamburg und bis 1977 auch im Vorstand bzw. Aufsichtsrat der Baufirma C. Baresel AG in Stuttgart. 1968 wurde er erstmals als Abgeordneter in den Landtag gewählt. 1972 wurde er Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Nachdem er mehrmals ihm von Ministerpräsident Filbinger angebotene anderweitige Ministerämter zunächst ausgeschlagen hatte, wurde er 1978 zum Innenminister ernannt. Späth mit Erich Honecker (1987) Nach dem Rücktritt von Hans Filbinger wegen der ?Filbinger-Affäre? wurde Lothar Späth schließlich am 30. August 1978 zum fünften Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg gewählt. Er konnte sich gegen den Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel, der ebenfalls Ambitionen auf das Amt hatte, innerhalb der Landtagsfraktion durchsetzen. Von 1979 bis 1991 war er Landesvorsitzender der CDU von Baden-Württemberg, anschließend deren Ehrenvorsitzender, sowie von 1981 bis 1989 stellvertretender Bundesvorsitzender dieser Partei. Im Sommer 1989 gehörte er zu der innerparteilichen Gruppe, die auf dem CDU-Parteitag in Bremen eine Gegenkandidatur zum Vorsitzenden Helmut Kohl vorbereitete. Letzten Endes trat er aber doch nicht an.[4] Turnusgemäß war er als Ministerpräsident von Baden-Württemberg vom 1. November 1984 bis zum 31. Oktober 1985 Bundesratspräsident. Von 1987 bis 1990 war Späth Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Élysée-Vertrags. In dieser Funktion war er wesentlich an der Idee und Gründung des Fernseh-Kulturkanals Arte beteiligt.[5] Späth konnte bei den Landtagswahlen 1980, 1984 und 1988 jeweils die absolute Mehrheit der CDU verteidigen, während die anderen Parteien stagnierten. Als Ministerpräsident trieb er die wirtschaftliche Entwicklung des Landes voran und erhielt für den ökonomischen Erfolg den Spitznamen ?Cleverle? Späth arbeitete dabei mit in Baden-Württemberg ansässigen Konzernen und deren Managern eng zusammen, insbesondere mit dem Wirtschaftsmanager und Konzernchef der Südmilch AG, Friedrich Wilhelm Schnitzler, dem Mercedes-Benz Konzern, der Porsche AG und mit deren Vorständen. Nachdem Späth im Zusammenhang mit der ?Traumschiff-Affäre? Vorteilsnahme bei Ferienreisen vorgeworfen worden war, trat er am 13. Januar 1991 von seinem Amt als Regierungschef zurück und legte am 31. Juli 1991 auch sein Mandat als Landtagsabgeordneter nieder. Sein Nachfolger als Ministerpräsident wurde der baden-württembergische CDU-Fraktionsvorsitzende Erwin Teufel. Sein Landtagsmandat übernahm der Oberbürgermeister von Bietigheim-Bissingen Manfred List. Im Bundestagswahlkampf 2002 war Späth als Schatten-Wirtschaftsminister Mitglied im Schattenkabinett des Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber. Sonstige Tätigkeiten Um mittelständische Unternehmen aus Baden-Württemberg bei der Erschließung ausländischer Märkte zu unterstützen, rief er 1984 die ?Exportstiftung Baden-Württemberg?, heute Baden-Württemberg International, ins Leben.[6] /// Standort Wimregal Pkis-Box23-U08 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.
-
2x Original Autogramm Peter Wieland (1930-2020) /// Autogramm Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 20,00
Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Peter Wieland bildseitig mit schwarzem Edding signiert mit eigenhändigem Zusatz "Dank für Ihre Zeilen - mit lieben Grüßen für Sie liebe Ilona Ihr April 2002" und den Umseitigen Worten "Natürlich sind die Grüße auch für D.(Dieter?) Messerschmidt Euer" und weiterer Unterschrift. /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Peter Wieland (bürgerlich Ralf Sauer; * 6. Juli 1930 in Stralsund; ? 1. März oder 2. März 2020 in Berlin) war ein deutscher Musical- und Schlagersänger, Entertainer und Musikpädagoge. In der DDR gehörte er zu den bekanntesten Unterhaltungskünstlern. Ralf Sauer kam nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtling mit seiner Familie aus Stettin nach Köthen, wo er den Beruf des Zimmermanns erlernte. Sein Talent wurde beim Singen im örtlichen Kirchenchor entdeckt. Mitte der 1950er Jahre gewann er einen Hauptpreis beim Gesamtdeutschen Gesangswettbewerb in Leipzig und begann damit seine Laufbahn als Sänger in der DDR. Er studierte an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin, wo er zum lyrischen Bariton im Opernfach ausgebildet wurde. Nach dem Staatsexamen erhielt er sein erstes Engagement am Theater in Neustrelitz.[2] Nach dreijähriger Tätigkeit als Opernsänger wandte er sich dem zu dieser Zeit neuen Genre des Musicals zu. Mit Musicalmelodien war er Gesangssolist beim Rundfunkorchester des Deutschlandsenders in Ost-Berlin und beim Sender Leipzig. Hier legte er sich 1957 den Künstlernamen Peter Wieland zu. Mit einer Rolle in der musikalischen Revue Das goldene Prag begann seine langjährige Tätigkeit als Darsteller im Berliner Friedrichstadt-Palast, wo er später auch als Entertainer und Moderator auftrat. Wieland nahm einige Schallplatten auf, die meist Musical- und Operettenmelodien zum Inhalt hatten. Im Radio hatte er zeitweilig eine Sendereihe mit dem Namen Show in Stereo. Es ergaben sich Fernsehauftritte und Tourneen, meist in die damals sozialistischen Länder. Als Musikpädagoge unterrichtete er seit 1966 die junge Dagmar Frederic. Später traten beide regelmäßig im Duett auf und waren von 1977 bis 1983 auch miteinander verheiratet. 1979 präsentierten Frederic und Wieland im DDR-Fernsehen die Sendung Ein Kessel Buntes. Als Kollektiv erhielten sie am 6. Oktober 1981 den Nationalpreis der DDR aus den Händen von Erich Honecker. Nach der Wende hatte Wieland weiterhin Fernsehauftritte bei den Sommermelodien (ARD), der Operettengala der Elblandfestspiele Wittenberge und bei Weihnachten bei uns im MDR. Wieland trat bis 2008 noch gelegentlich als Sänger auf, unter anderem mit seinem Programm Peter Wieland - hautnah. Weiterhin hatte er ein erneutes Engagement in Flensburg am Theater. Ferner wirkte er 1992 für einige Episoden in der Daily-Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten als Walter Bornat, der Verlobte von Helga Markmann (Nora Bendig), mit. 1999 und 2000 gestaltete er über 50 Mal die Rolle des Kaisers Franz Joseph in der Operette Im weißen Rößl unter freiem Himmel in Berlin-Treptow. 2003 brachte er die Uraufführung des Theaterstückes zum 100. Geburtstages des von ihm sehr verehrten Schauspielers Heinz Rühmann am Festspielhaus Wittenberge heraus, das nach einer Idee von Heiko Reissig und unter der Regie von Hans-Hermann Krug entstand. Seinen Erfolgstitel Erinnerung widmete Peter Wieland ebenfalls Rühmann. Peter Wieland war lange ein gefragter Sänger und Entertainer. Im Mai 2008 hatte er einen Auftritt beim Frühlingsfest in Fürstenwalde als Kaiser Franz Joseph. Im August 2008 trat er in der Sommerrevue im Berliner Friedrichstadt-Palast auf. Am 7. Juni 2010 feierte er mit vielen bekannten Kollegen im ausverkauften Friedrichstadt-Palast Berlin seinen 80. Geburtstag. Auf der Bühne wurde er von Renate Holm und Präsident Heiko Reissig zum Ehrenmitglied der Europäischen Kulturwerkstatt e. V. (EKW) berufen. Am 18. März 2014 wurde Peter Wieland zum Köthen-Botschafter für die 900-Jahr-Feier 2015 berufen.[3] Wieland lebte mit seiner dritten Ehefrau Marion Sauer bis zu ihrem Tod im August 2017 in Berlin-Rudow. Peter Wieland starb in der Nacht zum 2. März 2020 im Alter von 89 Jahren in einem Berliner Krankenhaus, wo er sich wegen eines Oberschenkelhalsbruches in Behandlung befunden hatte.[4] /// Standort Wimregal GAD-0129 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.
-
Original Autogramm Wolfgang Mischnick (1921-2002) Bundesminister /// Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 15,00
Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Fotopostkarte von Wolfgang Mischnick bildseitig mit blauem Stift signiert, geknickt /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Friedrich Adolf Wolfgang Mischnick (* 29. September 1921 in Dresden; ? 6. Oktober 2002 in Bad Soden am Taunus) war ein deutscher Politiker (FDP). Er war von 1961 bis 1963 Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte und von 1968 bis 1991 Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, als solcher war er von 1968 bis 1969 Oppositionsführer. Nach dem ihm vorzeitig zuerkannten Abitur auf dem Gymnasium Luisenstift in Radebeul[1][2] nahm Mischnick von 1939 bis 1945 als Soldat, zuletzt im Range eines Leutnants der Infanterie, am Zweiten Weltkrieg teil. Als ehemaligem Offizier der Wehrmacht verbot ihm die sowjetische Besatzungsmacht das angestrebte Ingenieurstudium. Im Jahre 1948 wurde er mit einem Schreib- und Redeverbot belegt. Daraufhin - und um der drohenden Verhaftung durch das NKWD zu entgehen - floh er zunächst nach Berlin, wenig später nach Frankfurt am Main. Von 1953 bis 1957 war er Vizepräsident der Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen. Zwischen 1957 und 1961 bekleidete er auch das Amt des Hessischen Landesvorsitzenden im Gesamtverband der Sowjetzonenflüchtlinge. Außerdem war er Mitglied im Kuratorium der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Wolfgang Mischnick starb im Alter von 81 Jahren und wurde auf dem alten Friedhof von Kronberg im Taunus beigesetzt.[3] Er war zweimal verheiratet und hatte drei Kinder. Partei Nach Kriegsende gehörte Mischnick zu den Mitbegründern der LDP in Dresden. Er wurde LDP-Jugendreferent für Sachsen und gehörte ab 1946 dem geschäftsführenden Zentralvorstand der LDP für die Sowjetische Besatzungszone an. Er wandte sich gegen den politischen Monopolanspruch der Freien Deutschen Jugend (FDJ) und die Vereinnahmung von Kindern in der Pionierorganisation Ernst Thälmann. Im Jahre 1947 wurde er zum stellvertretenden Landesvorsitzenden der LDP Sachsen gewählt. Die Wahl wurde jedoch von der sowjetischen Besatzungsmacht annulliert. Nach seiner Flucht nach Westdeutschland wurde Mischnick Mitglied der FDP in Hessen. Von 1954 bis 1957 war er Bundesvorsitzender der FDP-Jugendorganisation, der Deutschen Jungdemokraten. Zwischen 1954 und 1991 saß er auch im FDP-Bundesvorstand, davon in den Jahren 1964 bis 1988 als Stellvertretender Bundesvorsitzender. Zudem war er in den 1950er Jahren Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes Frankfurt am Main. Von 1954 bis 1967 war Mischnick daneben auch Stellvertretender Landesvorsitzender der FDP in Hessen, von 1967 bis 1977 amtierte er dann als deren Landesvorsitzender. Am 30./31. Mai 1973 reiste Mischnick zusammen mit Herbert Wehner (SPD) zu einem geheimen Treffen mit dem Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker in die DDR. Im Jagdhaus Hubertusstock in der Schorfheide wurden humanitäre Fragen der deutsch-deutschen Beziehungen erörtert. Von 1987 bis 1995 war Mischnick Vorsitzender der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. Er war zeitweilig Mitglied im Kuratorium der Wolf-Erich-Kellner-Gedächtnisstiftung. Von 1987 bis 1995 war er als Mitherausgeber der von der Stiftung herausgegebenen Zeitschrift liberal tätig. Der umfangreiche Nachlass von Mischnick befindet sich im Archiv des Liberalismus der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Gummersbach. Abgeordneter Wolfgang Mischnick, 1976 Mischnick, 1982 1946 wurde Mischnick in die Stadtverordnetenversammlung von Dresden gewählt. Von 1954 bis 1957 war er Mitglied des Hessischen Landtages. Hier fungierte er als Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion. Von 1956 bis 1961 sowie von 1964 bis 1972 war er Mitglied in der Stadtverordnetenversammlung von Frankfurt am Main. Er bekleidete zwischen 1956 und 1961 sowie 1964 und 1968 das Amt des Fraktionsvorsitzenden. Von 1957 bis 1994 war Wolfgang Mischnick Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 1959 bis 1961 war er Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Nach seinem Ausscheiden aus der Bundesregierung wurde er 1963 zum Stellvertretenden Vorsitzenden und 1968 schließlich zum Vorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion gewählt. Als solcher fungierte er bis zum Amtsantritt der Regierung Brandt am 21. Oktober 1969 als Oppositionsführer gegen die Regierung Kiesinger. Von 1969 bis 1972 und 1976 bis 1983 war er zudem stellvertretender Vorsitzender des Gemeinsamen Ausschusses gemäß Artikel 53a des Grundgesetzes und von 1972 bis zum 8. Dezember 1982 stellvertretender Vorsitzender des Sportausschusses. Erst 1991 schied Mischnick auf eigenen Wunsch aus dem Amt des Fraktionsvorsitzenden aus, das er länger innehatte als jeder andere Fraktionsvorsitzende in der Geschichte des Bundestags, und wurde daraufhin zum Ehrenvorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion gewählt. Berühmt ist Mischnicks Rede vor dem Deutschen Bundestag anlässlich des Misstrauensvotums gegen Helmut Schmidt am 1. Oktober 1982. Wolfgang Mischnick zog 1990 über die Landesliste Sachsen und davor stets über die Landesliste Hessen in den Bundestag ein. Öffentliche Ämter Nach der Bundestagswahl 1961 wurde Mischnick als damals jüngster Minister am 14. November 1961 zum Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte in der von Bundeskanzler Konrad Adenauer geführten Bundesregierung ernannt. Im Zuge der Spiegel-Affäre trat er am 19. November 1962 gemeinsam mit den anderen FDP-Bundesministern zwar zurück, wurde aber am 13. Dezember 1962 erneut in dieses Amt berufen. Mit dem Rücktritt von Konrad Adenauer schied auch Mischnick am 11. Oktober 1963 aus der Bundesregierung aus. /// Standort Wimregal GAD-0347 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.
-
Original Autogramm Wolfgang Mischnick (1921-2002) Bundesminister /// Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 15,00
Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 2 verfügbar
In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Wolfgang Mischnick bildseitig mit blauem Stift signiert /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Friedrich Adolf Wolfgang Mischnick (* 29. September 1921 in Dresden; ? 6. Oktober 2002 in Bad Soden am Taunus) war ein deutscher Politiker (FDP). Er war von 1961 bis 1963 Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte und von 1968 bis 1991 Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, als solcher war er von 1968 bis 1969 Oppositionsführer. Nach dem ihm vorzeitig zuerkannten Abitur auf dem Gymnasium Luisenstift in Radebeul[1][2] nahm Mischnick von 1939 bis 1945 als Soldat, zuletzt im Range eines Leutnants der Infanterie, am Zweiten Weltkrieg teil. Als ehemaligem Offizier der Wehrmacht verbot ihm die sowjetische Besatzungsmacht das angestrebte Ingenieurstudium. Im Jahre 1948 wurde er mit einem Schreib- und Redeverbot belegt. Daraufhin - und um der drohenden Verhaftung durch das NKWD zu entgehen - floh er zunächst nach Berlin, wenig später nach Frankfurt am Main. Von 1953 bis 1957 war er Vizepräsident der Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen. Zwischen 1957 und 1961 bekleidete er auch das Amt des Hessischen Landesvorsitzenden im Gesamtverband der Sowjetzonenflüchtlinge. Außerdem war er Mitglied im Kuratorium der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Wolfgang Mischnick starb im Alter von 81 Jahren und wurde auf dem alten Friedhof von Kronberg im Taunus beigesetzt.[3] Er war zweimal verheiratet und hatte drei Kinder. Partei Nach Kriegsende gehörte Mischnick zu den Mitbegründern der LDP in Dresden. Er wurde LDP-Jugendreferent für Sachsen und gehörte ab 1946 dem geschäftsführenden Zentralvorstand der LDP für die Sowjetische Besatzungszone an. Er wandte sich gegen den politischen Monopolanspruch der Freien Deutschen Jugend (FDJ) und die Vereinnahmung von Kindern in der Pionierorganisation Ernst Thälmann. Im Jahre 1947 wurde er zum stellvertretenden Landesvorsitzenden der LDP Sachsen gewählt. Die Wahl wurde jedoch von der sowjetischen Besatzungsmacht annulliert. Nach seiner Flucht nach Westdeutschland wurde Mischnick Mitglied der FDP in Hessen. Von 1954 bis 1957 war er Bundesvorsitzender der FDP-Jugendorganisation, der Deutschen Jungdemokraten. Zwischen 1954 und 1991 saß er auch im FDP-Bundesvorstand, davon in den Jahren 1964 bis 1988 als Stellvertretender Bundesvorsitzender. Zudem war er in den 1950er Jahren Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes Frankfurt am Main. Von 1954 bis 1967 war Mischnick daneben auch Stellvertretender Landesvorsitzender der FDP in Hessen, von 1967 bis 1977 amtierte er dann als deren Landesvorsitzender. Am 30./31. Mai 1973 reiste Mischnick zusammen mit Herbert Wehner (SPD) zu einem geheimen Treffen mit dem Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker in die DDR. Im Jagdhaus Hubertusstock in der Schorfheide wurden humanitäre Fragen der deutsch-deutschen Beziehungen erörtert. Von 1987 bis 1995 war Mischnick Vorsitzender der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. Er war zeitweilig Mitglied im Kuratorium der Wolf-Erich-Kellner-Gedächtnisstiftung. Von 1987 bis 1995 war er als Mitherausgeber der von der Stiftung herausgegebenen Zeitschrift liberal tätig. Der umfangreiche Nachlass von Mischnick befindet sich im Archiv des Liberalismus der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Gummersbach. Abgeordneter Wolfgang Mischnick, 1976 Mischnick, 1982 1946 wurde Mischnick in die Stadtverordnetenversammlung von Dresden gewählt. Von 1954 bis 1957 war er Mitglied des Hessischen Landtages. Hier fungierte er als Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion. Von 1956 bis 1961 sowie von 1964 bis 1972 war er Mitglied in der Stadtverordnetenversammlung von Frankfurt am Main. Er bekleidete zwischen 1956 und 1961 sowie 1964 und 1968 das Amt des Fraktionsvorsitzenden. Von 1957 bis 1994 war Wolfgang Mischnick Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 1959 bis 1961 war er Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Nach seinem Ausscheiden aus der Bundesregierung wurde er 1963 zum Stellvertretenden Vorsitzenden und 1968 schließlich zum Vorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion gewählt. Als solcher fungierte er bis zum Amtsantritt der Regierung Brandt am 21. Oktober 1969 als Oppositionsführer gegen die Regierung Kiesinger. Von 1969 bis 1972 und 1976 bis 1983 war er zudem stellvertretender Vorsitzender des Gemeinsamen Ausschusses gemäß Artikel 53a des Grundgesetzes und von 1972 bis zum 8. Dezember 1982 stellvertretender Vorsitzender des Sportausschusses. Erst 1991 schied Mischnick auf eigenen Wunsch aus dem Amt des Fraktionsvorsitzenden aus, das er länger innehatte als jeder andere Fraktionsvorsitzende in der Geschichte des Bundestags, und wurde daraufhin zum Ehrenvorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion gewählt. Berühmt ist Mischnicks Rede vor dem Deutschen Bundestag anlässlich des Misstrauensvotums gegen Helmut Schmidt am 1. Oktober 1982. Wolfgang Mischnick zog 1990 über die Landesliste Sachsen und davor stets über die Landesliste Hessen in den Bundestag ein. Öffentliche Ämter Nach der Bundestagswahl 1961 wurde Mischnick als damals jüngster Minister am 14. November 1961 zum Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte in der von Bundeskanzler Konrad Adenauer geführten Bundesregierung ernannt. Im Zuge der Spiegel-Affäre trat er am 19. November 1962 gemeinsam mit den anderen FDP-Bundesministern zwar zurück, wurde aber am 13. Dezember 1962 erneut in dieses Amt berufen. Mit dem Rücktritt von Konrad Adenauer schied auch Mischnick am 11. Oktober 1963 aus der Bundesregierung aus. /// Standort Wimregal GAD-20.070ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.
-
Original Autogramm Wolfgang Mischnick (1921-2002) Bundesminister /// Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 15,00
Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Wolfgang Mischnick bildseitig mit blauem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Friedrich Adolf Wolfgang Mischnick (* 29. September 1921 in Dresden; ? 6. Oktober 2002 in Bad Soden am Taunus) war ein deutscher Politiker (FDP). Er war von 1961 bis 1963 Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte und von 1968 bis 1991 Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, als solcher war er von 1968 bis 1969 Oppositionsführer. Nach dem ihm vorzeitig zuerkannten Abitur auf dem Gymnasium Luisenstift in Radebeul[1][2] nahm Mischnick von 1939 bis 1945 als Soldat, zuletzt im Range eines Leutnants der Infanterie, am Zweiten Weltkrieg teil. Als ehemaligem Offizier der Wehrmacht verbot ihm die sowjetische Besatzungsmacht das angestrebte Ingenieurstudium. Im Jahre 1948 wurde er mit einem Schreib- und Redeverbot belegt. Daraufhin - und um der drohenden Verhaftung durch das NKWD zu entgehen - floh er zunächst nach Berlin, wenig später nach Frankfurt am Main. Von 1953 bis 1957 war er Vizepräsident der Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen. Zwischen 1957 und 1961 bekleidete er auch das Amt des Hessischen Landesvorsitzenden im Gesamtverband der Sowjetzonenflüchtlinge. Außerdem war er Mitglied im Kuratorium der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Wolfgang Mischnick starb im Alter von 81 Jahren und wurde auf dem alten Friedhof von Kronberg im Taunus beigesetzt.[3] Er war zweimal verheiratet und hatte drei Kinder. Partei Nach Kriegsende gehörte Mischnick zu den Mitbegründern der LDP in Dresden. Er wurde LDP-Jugendreferent für Sachsen und gehörte ab 1946 dem geschäftsführenden Zentralvorstand der LDP für die Sowjetische Besatzungszone an. Er wandte sich gegen den politischen Monopolanspruch der Freien Deutschen Jugend (FDJ) und die Vereinnahmung von Kindern in der Pionierorganisation Ernst Thälmann. Im Jahre 1947 wurde er zum stellvertretenden Landesvorsitzenden der LDP Sachsen gewählt. Die Wahl wurde jedoch von der sowjetischen Besatzungsmacht annulliert. Nach seiner Flucht nach Westdeutschland wurde Mischnick Mitglied der FDP in Hessen. Von 1954 bis 1957 war er Bundesvorsitzender der FDP-Jugendorganisation, der Deutschen Jungdemokraten. Zwischen 1954 und 1991 saß er auch im FDP-Bundesvorstand, davon in den Jahren 1964 bis 1988 als Stellvertretender Bundesvorsitzender. Zudem war er in den 1950er Jahren Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes Frankfurt am Main. Von 1954 bis 1967 war Mischnick daneben auch Stellvertretender Landesvorsitzender der FDP in Hessen, von 1967 bis 1977 amtierte er dann als deren Landesvorsitzender. Am 30./31. Mai 1973 reiste Mischnick zusammen mit Herbert Wehner (SPD) zu einem geheimen Treffen mit dem Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker in die DDR. Im Jagdhaus Hubertusstock in der Schorfheide wurden humanitäre Fragen der deutsch-deutschen Beziehungen erörtert. Von 1987 bis 1995 war Mischnick Vorsitzender der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. Er war zeitweilig Mitglied im Kuratorium der Wolf-Erich-Kellner-Gedächtnisstiftung. Von 1987 bis 1995 war er als Mitherausgeber der von der Stiftung herausgegebenen Zeitschrift liberal tätig. Der umfangreiche Nachlass von Mischnick befindet sich im Archiv des Liberalismus der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Gummersbach. Abgeordneter Wolfgang Mischnick, 1976 Mischnick, 1982 1946 wurde Mischnick in die Stadtverordnetenversammlung von Dresden gewählt. Von 1954 bis 1957 war er Mitglied des Hessischen Landtages. Hier fungierte er als Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion. Von 1956 bis 1961 sowie von 1964 bis 1972 war er Mitglied in der Stadtverordnetenversammlung von Frankfurt am Main. Er bekleidete zwischen 1956 und 1961 sowie 1964 und 1968 das Amt des Fraktionsvorsitzenden. Von 1957 bis 1994 war Wolfgang Mischnick Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 1959 bis 1961 war er Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Nach seinem Ausscheiden aus der Bundesregierung wurde er 1963 zum Stellvertretenden Vorsitzenden und 1968 schließlich zum Vorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion gewählt. Als solcher fungierte er bis zum Amtsantritt der Regierung Brandt am 21. Oktober 1969 als Oppositionsführer gegen die Regierung Kiesinger. Von 1969 bis 1972 und 1976 bis 1983 war er zudem stellvertretender Vorsitzender des Gemeinsamen Ausschusses gemäß Artikel 53a des Grundgesetzes und von 1972 bis zum 8. Dezember 1982 stellvertretender Vorsitzender des Sportausschusses. Erst 1991 schied Mischnick auf eigenen Wunsch aus dem Amt des Fraktionsvorsitzenden aus, das er länger innehatte als jeder andere Fraktionsvorsitzende in der Geschichte des Bundestags, und wurde daraufhin zum Ehrenvorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion gewählt. Berühmt ist Mischnicks Rede vor dem Deutschen Bundestag anlässlich des Misstrauensvotums gegen Helmut Schmidt am 1. Oktober 1982. Wolfgang Mischnick zog 1990 über die Landesliste Sachsen und davor stets über die Landesliste Hessen in den Bundestag ein. Öffentliche Ämter Nach der Bundestagswahl 1961 wurde Mischnick als damals jüngster Minister am 14. November 1961 zum Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte in der von Bundeskanzler Konrad Adenauer geführten Bundesregierung ernannt. Im Zuge der Spiegel-Affäre trat er am 19. November 1962 gemeinsam mit den anderen FDP-Bundesministern zwar zurück, wurde aber am 13. Dezember 1962 erneut in dieses Amt berufen. Mit dem Rücktritt von Konrad Adenauer schied auch Mischnick am 11. Oktober 1963 aus der Bundesregierung aus. /// Standort Wimregal GAD-20.069 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.
-
Original Autogramm Wolfgang Mischnick (1921-2002) Bundesminister /// Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 15,00
Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Wolfgang Mischnick bildseitig mit blauem Kuli signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Friedrich Adolf Wolfgang Mischnick (* 29. September 1921 in Dresden; ? 6. Oktober 2002 in Bad Soden am Taunus) war ein deutscher Politiker (FDP). Er war von 1961 bis 1963 Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte und von 1968 bis 1991 Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, als solcher war er von 1968 bis 1969 Oppositionsführer. Nach dem ihm vorzeitig zuerkannten Abitur auf dem Gymnasium Luisenstift in Radebeul[1][2] nahm Mischnick von 1939 bis 1945 als Soldat, zuletzt im Range eines Leutnants der Infanterie, am Zweiten Weltkrieg teil. Als ehemaligem Offizier der Wehrmacht verbot ihm die sowjetische Besatzungsmacht das angestrebte Ingenieurstudium. Im Jahre 1948 wurde er mit einem Schreib- und Redeverbot belegt. Daraufhin - und um der drohenden Verhaftung durch das NKWD zu entgehen - floh er zunächst nach Berlin, wenig später nach Frankfurt am Main. Von 1953 bis 1957 war er Vizepräsident der Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen. Zwischen 1957 und 1961 bekleidete er auch das Amt des Hessischen Landesvorsitzenden im Gesamtverband der Sowjetzonenflüchtlinge. Außerdem war er Mitglied im Kuratorium der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Wolfgang Mischnick starb im Alter von 81 Jahren und wurde auf dem alten Friedhof von Kronberg im Taunus beigesetzt.[3] Er war zweimal verheiratet und hatte drei Kinder. Partei Nach Kriegsende gehörte Mischnick zu den Mitbegründern der LDP in Dresden. Er wurde LDP-Jugendreferent für Sachsen und gehörte ab 1946 dem geschäftsführenden Zentralvorstand der LDP für die Sowjetische Besatzungszone an. Er wandte sich gegen den politischen Monopolanspruch der Freien Deutschen Jugend (FDJ) und die Vereinnahmung von Kindern in der Pionierorganisation Ernst Thälmann. Im Jahre 1947 wurde er zum stellvertretenden Landesvorsitzenden der LDP Sachsen gewählt. Die Wahl wurde jedoch von der sowjetischen Besatzungsmacht annulliert. Nach seiner Flucht nach Westdeutschland wurde Mischnick Mitglied der FDP in Hessen. Von 1954 bis 1957 war er Bundesvorsitzender der FDP-Jugendorganisation, der Deutschen Jungdemokraten. Zwischen 1954 und 1991 saß er auch im FDP-Bundesvorstand, davon in den Jahren 1964 bis 1988 als Stellvertretender Bundesvorsitzender. Zudem war er in den 1950er Jahren Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes Frankfurt am Main. Von 1954 bis 1967 war Mischnick daneben auch Stellvertretender Landesvorsitzender der FDP in Hessen, von 1967 bis 1977 amtierte er dann als deren Landesvorsitzender. Am 30./31. Mai 1973 reiste Mischnick zusammen mit Herbert Wehner (SPD) zu einem geheimen Treffen mit dem Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker in die DDR. Im Jagdhaus Hubertusstock in der Schorfheide wurden humanitäre Fragen der deutsch-deutschen Beziehungen erörtert. Von 1987 bis 1995 war Mischnick Vorsitzender der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. Er war zeitweilig Mitglied im Kuratorium der Wolf-Erich-Kellner-Gedächtnisstiftung. Von 1987 bis 1995 war er als Mitherausgeber der von der Stiftung herausgegebenen Zeitschrift liberal tätig. Der umfangreiche Nachlass von Mischnick befindet sich im Archiv des Liberalismus der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Gummersbach. Abgeordneter Wolfgang Mischnick, 1976 Mischnick, 1982 1946 wurde Mischnick in die Stadtverordnetenversammlung von Dresden gewählt. Von 1954 bis 1957 war er Mitglied des Hessischen Landtages. Hier fungierte er als Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion. Von 1956 bis 1961 sowie von 1964 bis 1972 war er Mitglied in der Stadtverordnetenversammlung von Frankfurt am Main. Er bekleidete zwischen 1956 und 1961 sowie 1964 und 1968 das Amt des Fraktionsvorsitzenden. Von 1957 bis 1994 war Wolfgang Mischnick Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 1959 bis 1961 war er Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Nach seinem Ausscheiden aus der Bundesregierung wurde er 1963 zum Stellvertretenden Vorsitzenden und 1968 schließlich zum Vorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion gewählt. Als solcher fungierte er bis zum Amtsantritt der Regierung Brandt am 21. Oktober 1969 als Oppositionsführer gegen die Regierung Kiesinger. Von 1969 bis 1972 und 1976 bis 1983 war er zudem stellvertretender Vorsitzender des Gemeinsamen Ausschusses gemäß Artikel 53a des Grundgesetzes und von 1972 bis zum 8. Dezember 1982 stellvertretender Vorsitzender des Sportausschusses. Erst 1991 schied Mischnick auf eigenen Wunsch aus dem Amt des Fraktionsvorsitzenden aus, das er länger innehatte als jeder andere Fraktionsvorsitzende in der Geschichte des Bundestags, und wurde daraufhin zum Ehrenvorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion gewählt. Berühmt ist Mischnicks Rede vor dem Deutschen Bundestag anlässlich des Misstrauensvotums gegen Helmut Schmidt am 1. Oktober 1982. Wolfgang Mischnick zog 1990 über die Landesliste Sachsen und davor stets über die Landesliste Hessen in den Bundestag ein. Öffentliche Ämter Nach der Bundestagswahl 1961 wurde Mischnick als damals jüngster Minister am 14. November 1961 zum Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte in der von Bundeskanzler Konrad Adenauer geführten Bundesregierung ernannt. Im Zuge der Spiegel-Affäre trat er am 19. November 1962 gemeinsam mit den anderen FDP-Bundesministern zwar zurück, wurde aber am 13. Dezember 1962 erneut in dieses Amt berufen. Mit dem Rücktritt von Konrad Adenauer schied auch Mischnick am 11. Oktober 1963 aus der Bundesregierung aus. /// Standort Wimregal GAD-10.389 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.
-
Original Autogramm Wolfgang Mischnick (1921-2002) Bundesminister /// Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 15,00
Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 3 verfügbar
In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Wolfgang Mischnick bildseitig mit blauem Stift signiert. /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Friedrich Adolf Wolfgang Mischnick (* 29. September 1921 in Dresden; ? 6. Oktober 2002 in Bad Soden am Taunus) war ein deutscher Politiker (FDP). Er war von 1961 bis 1963 Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte und von 1968 bis 1991 Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, als solcher war er von 1968 bis 1969 Oppositionsführer. Nach dem ihm vorzeitig zuerkannten Abitur auf dem Gymnasium Luisenstift in Radebeul[1][2] nahm Mischnick von 1939 bis 1945 als Soldat, zuletzt im Range eines Leutnants der Infanterie, am Zweiten Weltkrieg teil. Als ehemaligem Offizier der Wehrmacht verbot ihm die sowjetische Besatzungsmacht das angestrebte Ingenieurstudium. Im Jahre 1948 wurde er mit einem Schreib- und Redeverbot belegt. Daraufhin - und um der drohenden Verhaftung durch das NKWD zu entgehen - floh er zunächst nach Berlin, wenig später nach Frankfurt am Main. Von 1953 bis 1957 war er Vizepräsident der Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen. Zwischen 1957 und 1961 bekleidete er auch das Amt des Hessischen Landesvorsitzenden im Gesamtverband der Sowjetzonenflüchtlinge. Außerdem war er Mitglied im Kuratorium der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Wolfgang Mischnick starb im Alter von 81 Jahren und wurde auf dem alten Friedhof von Kronberg im Taunus beigesetzt.[3] Er war zweimal verheiratet und hatte drei Kinder. Partei Nach Kriegsende gehörte Mischnick zu den Mitbegründern der LDP in Dresden. Er wurde LDP-Jugendreferent für Sachsen und gehörte ab 1946 dem geschäftsführenden Zentralvorstand der LDP für die Sowjetische Besatzungszone an. Er wandte sich gegen den politischen Monopolanspruch der Freien Deutschen Jugend (FDJ) und die Vereinnahmung von Kindern in der Pionierorganisation Ernst Thälmann. Im Jahre 1947 wurde er zum stellvertretenden Landesvorsitzenden der LDP Sachsen gewählt. Die Wahl wurde jedoch von der sowjetischen Besatzungsmacht annulliert. Nach seiner Flucht nach Westdeutschland wurde Mischnick Mitglied der FDP in Hessen. Von 1954 bis 1957 war er Bundesvorsitzender der FDP-Jugendorganisation, der Deutschen Jungdemokraten. Zwischen 1954 und 1991 saß er auch im FDP-Bundesvorstand, davon in den Jahren 1964 bis 1988 als Stellvertretender Bundesvorsitzender. Zudem war er in den 1950er Jahren Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes Frankfurt am Main. Von 1954 bis 1967 war Mischnick daneben auch Stellvertretender Landesvorsitzender der FDP in Hessen, von 1967 bis 1977 amtierte er dann als deren Landesvorsitzender. Am 30./31. Mai 1973 reiste Mischnick zusammen mit Herbert Wehner (SPD) zu einem geheimen Treffen mit dem Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker in die DDR. Im Jagdhaus Hubertusstock in der Schorfheide wurden humanitäre Fragen der deutsch-deutschen Beziehungen erörtert. Von 1987 bis 1995 war Mischnick Vorsitzender der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. Er war zeitweilig Mitglied im Kuratorium der Wolf-Erich-Kellner-Gedächtnisstiftung. Von 1987 bis 1995 war er als Mitherausgeber der von der Stiftung herausgegebenen Zeitschrift liberal tätig. Der umfangreiche Nachlass von Mischnick befindet sich im Archiv des Liberalismus der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Gummersbach. Abgeordneter Wolfgang Mischnick, 1976 Mischnick, 1982 1946 wurde Mischnick in die Stadtverordnetenversammlung von Dresden gewählt. Von 1954 bis 1957 war er Mitglied des Hessischen Landtages. Hier fungierte er als Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion. Von 1956 bis 1961 sowie von 1964 bis 1972 war er Mitglied in der Stadtverordnetenversammlung von Frankfurt am Main. Er bekleidete zwischen 1956 und 1961 sowie 1964 und 1968 das Amt des Fraktionsvorsitzenden. Von 1957 bis 1994 war Wolfgang Mischnick Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 1959 bis 1961 war er Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Nach seinem Ausscheiden aus der Bundesregierung wurde er 1963 zum Stellvertretenden Vorsitzenden und 1968 schließlich zum Vorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion gewählt. Als solcher fungierte er bis zum Amtsantritt der Regierung Brandt am 21. Oktober 1969 als Oppositionsführer gegen die Regierung Kiesinger. Von 1969 bis 1972 und 1976 bis 1983 war er zudem stellvertretender Vorsitzender des Gemeinsamen Ausschusses gemäß Artikel 53a des Grundgesetzes und von 1972 bis zum 8. Dezember 1982 stellvertretender Vorsitzender des Sportausschusses. Erst 1991 schied Mischnick auf eigenen Wunsch aus dem Amt des Fraktionsvorsitzenden aus, das er länger innehatte als jeder andere Fraktionsvorsitzende in der Geschichte des Bundestags, und wurde daraufhin zum Ehrenvorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion gewählt. Berühmt ist Mischnicks Rede vor dem Deutschen Bundestag anlässlich des Misstrauensvotums gegen Helmut Schmidt am 1. Oktober 1982. Wolfgang Mischnick zog 1990 über die Landesliste Sachsen und davor stets über die Landesliste Hessen in den Bundestag ein. Öffentliche Ämter Nach der Bundestagswahl 1961 wurde Mischnick als damals jüngster Minister am 14. November 1961 zum Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte in der von Bundeskanzler Konrad Adenauer geführten Bundesregierung ernannt. Im Zuge der Spiegel-Affäre trat er am 19. November 1962 gemeinsam mit den anderen FDP-Bundesministern zwar zurück, wurde aber am 13. Dezember 1962 erneut in dieses Amt berufen. Mit dem Rücktritt von Konrad Adenauer schied auch Mischnick am 11. Oktober 1963 aus der Bundesregierung aus. /// Standort Wimregal PKis-Box96-U023ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.
-
Original Autogramm Wolfgang Mischnick (1921-2002) Bundesminister /// Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 15,00
Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 3 verfügbar
In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Schwarzweiss-Postkarte von Wolfgang Mischnick bildseitig mit blauem Stift signiert /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Friedrich Adolf Wolfgang Mischnick (* 29. September 1921 in Dresden; ? 6. Oktober 2002 in Bad Soden am Taunus) war ein deutscher Politiker (FDP). Er war von 1961 bis 1963 Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte und von 1968 bis 1991 Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, als solcher war er von 1968 bis 1969 Oppositionsführer. Nach dem ihm vorzeitig zuerkannten Abitur auf dem Gymnasium Luisenstift in Radebeul[1][2] nahm Mischnick von 1939 bis 1945 als Soldat, zuletzt im Range eines Leutnants der Infanterie, am Zweiten Weltkrieg teil. Als ehemaligem Offizier der Wehrmacht verbot ihm die sowjetische Besatzungsmacht das angestrebte Ingenieurstudium. Im Jahre 1948 wurde er mit einem Schreib- und Redeverbot belegt. Daraufhin - und um der drohenden Verhaftung durch das NKWD zu entgehen - floh er zunächst nach Berlin, wenig später nach Frankfurt am Main. Von 1953 bis 1957 war er Vizepräsident der Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen. Zwischen 1957 und 1961 bekleidete er auch das Amt des Hessischen Landesvorsitzenden im Gesamtverband der Sowjetzonenflüchtlinge. Außerdem war er Mitglied im Kuratorium der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Wolfgang Mischnick starb im Alter von 81 Jahren und wurde auf dem alten Friedhof von Kronberg im Taunus beigesetzt.[3] Er war zweimal verheiratet und hatte drei Kinder. Partei Nach Kriegsende gehörte Mischnick zu den Mitbegründern der LDP in Dresden. Er wurde LDP-Jugendreferent für Sachsen und gehörte ab 1946 dem geschäftsführenden Zentralvorstand der LDP für die Sowjetische Besatzungszone an. Er wandte sich gegen den politischen Monopolanspruch der Freien Deutschen Jugend (FDJ) und die Vereinnahmung von Kindern in der Pionierorganisation Ernst Thälmann. Im Jahre 1947 wurde er zum stellvertretenden Landesvorsitzenden der LDP Sachsen gewählt. Die Wahl wurde jedoch von der sowjetischen Besatzungsmacht annulliert. Nach seiner Flucht nach Westdeutschland wurde Mischnick Mitglied der FDP in Hessen. Von 1954 bis 1957 war er Bundesvorsitzender der FDP-Jugendorganisation, der Deutschen Jungdemokraten. Zwischen 1954 und 1991 saß er auch im FDP-Bundesvorstand, davon in den Jahren 1964 bis 1988 als Stellvertretender Bundesvorsitzender. Zudem war er in den 1950er Jahren Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes Frankfurt am Main. Von 1954 bis 1967 war Mischnick daneben auch Stellvertretender Landesvorsitzender der FDP in Hessen, von 1967 bis 1977 amtierte er dann als deren Landesvorsitzender. Am 30./31. Mai 1973 reiste Mischnick zusammen mit Herbert Wehner (SPD) zu einem geheimen Treffen mit dem Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker in die DDR. Im Jagdhaus Hubertusstock in der Schorfheide wurden humanitäre Fragen der deutsch-deutschen Beziehungen erörtert. Von 1987 bis 1995 war Mischnick Vorsitzender der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. Er war zeitweilig Mitglied im Kuratorium der Wolf-Erich-Kellner-Gedächtnisstiftung. Von 1987 bis 1995 war er als Mitherausgeber der von der Stiftung herausgegebenen Zeitschrift liberal tätig. Der umfangreiche Nachlass von Mischnick befindet sich im Archiv des Liberalismus der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Gummersbach. Abgeordneter Wolfgang Mischnick, 1976 Mischnick, 1982 1946 wurde Mischnick in die Stadtverordnetenversammlung von Dresden gewählt. Von 1954 bis 1957 war er Mitglied des Hessischen Landtages. Hier fungierte er als Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion. Von 1956 bis 1961 sowie von 1964 bis 1972 war er Mitglied in der Stadtverordnetenversammlung von Frankfurt am Main. Er bekleidete zwischen 1956 und 1961 sowie 1964 und 1968 das Amt des Fraktionsvorsitzenden. Von 1957 bis 1994 war Wolfgang Mischnick Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 1959 bis 1961 war er Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Nach seinem Ausscheiden aus der Bundesregierung wurde er 1963 zum Stellvertretenden Vorsitzenden und 1968 schließlich zum Vorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion gewählt. Als solcher fungierte er bis zum Amtsantritt der Regierung Brandt am 21. Oktober 1969 als Oppositionsführer gegen die Regierung Kiesinger. Von 1969 bis 1972 und 1976 bis 1983 war er zudem stellvertretender Vorsitzender des Gemeinsamen Ausschusses gemäß Artikel 53a des Grundgesetzes und von 1972 bis zum 8. Dezember 1982 stellvertretender Vorsitzender des Sportausschusses. Erst 1991 schied Mischnick auf eigenen Wunsch aus dem Amt des Fraktionsvorsitzenden aus, das er länger innehatte als jeder andere Fraktionsvorsitzende in der Geschichte des Bundestags, und wurde daraufhin zum Ehrenvorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion gewählt. Berühmt ist Mischnicks Rede vor dem Deutschen Bundestag anlässlich des Misstrauensvotums gegen Helmut Schmidt am 1. Oktober 1982. Wolfgang Mischnick zog 1990 über die Landesliste Sachsen und davor stets über die Landesliste Hessen in den Bundestag ein. Öffentliche Ämter Nach der Bundestagswahl 1961 wurde Mischnick als damals jüngster Minister am 14. November 1961 zum Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte in der von Bundeskanzler Konrad Adenauer geführten Bundesregierung ernannt. Im Zuge der Spiegel-Affäre trat er am 19. November 1962 gemeinsam mit den anderen FDP-Bundesministern zwar zurück, wurde aber am 13. Dezember 1962 erneut in dieses Amt berufen. Mit dem Rücktritt von Konrad Adenauer schied auch Mischnick am 11. Oktober 1963 aus der Bundesregierung aus. /// Standort Wimregal Pkis-Box22-U16ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.
-
Risse im Bruderbund : Gespräche Honecker - Breshnew 1974 bis 1982. Hans-Hermann Hertle ; Konrad H. Jarausch (Hg.) / Forschungen zur DDR-Gesellschaft,
Anbieter: nika-books, art & crafts GbR, Nordwestuckermark-Fürstenwerder, NWUM, Deutschland
Erstausgabe Signiert
EUR 30,00
Währung umrechnenEUR 3,50 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbBroschur, 1. Auflage,. 273 Seiten, von den Autoren signiert, Schnitt etwas berieben, sonst in einem guten Zustand. 9783861534198 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 437.
-
Original Autogramm Joachim Kardinal Meisner (1933-2017) /// Autogramm Autograph signiert signed signee
Erscheinungsdatum: 2005
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 30,00
Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbBlatt. Zustand: Befriedigend. A4-Albumblatt mit aufmontiertem Auszug aus einer TV-Programmvorschau, darunter von Joachim Cardinal Meisner mit schwazrem Edding signiert, Fingerabdrücke ///Joachim Kardinal Meisner (* 25. Dezember 1933 in Breslau, Niederschlesien; ? 5. Juli 2017 in Bad Füssing, Niederbayern) war ein deutscher Theologe und Erzbischof der römisch-katholischen Kirche. Er war von 1980 bis 1989 Bischof von Berlin und von 1982 bis 1989 Vorsitzender der Berliner Bischofskonferenz. 1983 wurde er Kardinal. Von 1989 bis 2014 war Meisner Erzbischof von Köln und Metropolit der Kirchenprovinz Köln. Joachim Meisner wurde im Breslauer Stadtteil Deutsch Lissa (heute poln. Lesnica) geboren und in der dortigen St.-Hedwigs-Kirche getauft. Er wuchs mit drei Brüdern in einem stark katholisch geprägten Umfeld auf. Nach der Vertreibung 1945 aus Schlesien und dem Tod seines Vaters im selben Jahr lebte Meisner im thüringischen Körner. Nach einer Lehre als Bankkaufmann trat Meisner 1953 ins Seminar für Spätberufene Norbertinum in Magdeburg ein und holte hier zunächst das Abitur nach. Von 1959 bis 1962 studierte er Philosophie und Theologie in Erfurt und wurde dort am 8. April 1962 zum Diakon und am 22. Dezember 1962 durch den damaligen Fuldaer Weihbischof Joseph Freusberg zum Priester geweiht. Er war Kaplan in Heiligenstadt und Erfurt, danach Rektor des Erfurter Caritasverbandes. 1969 wurde er von der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom zum Dr. theol. promoviert. Bischof Joachim Meisner (rechts) mit dem DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker, 1987 Weihbischof in Erfurt Am 17. März 1975 wurde er zum Titularbischof von Vina und Weihbischof des Bischöflichen Amtes Erfurt-Meiningen ernannt und am 17. Mai 1975 vom Apostolischen Administrator von Erfurt Hugo Aufderbeck zum Bischof geweiht. Mitkonsekratoren waren die Bischöfe Johannes Braun und Georg Weinhold. Meisners Wahlspruch lautete Spes nostra firma est pro vobis (?Unsere Hoffnung für euch steht fest?, nach der Erhebung zum Kardinal auf Spes nostra firma verkürzt) und entstammt dem 2. Korintherbrief (2 Kor 1,7 EU). Zum Bischöflichen Amt gehörte unter anderem das Eichsfeld, das eine katholische Enklave innerhalb der traditionell protestantisch und seit DDR-Zeiten atheistisch geprägten Glaubenslandschaft ist. Dort fand Meisner ein ähnlich intensives katholisches Gemeindeleben wie in seiner schlesischen Heimat vor. Bischof von Berlin Joachim Meisner, rechts, mit (v.l.) Bischof Karl Lehmann, Bischof Gerhard Schaffran und dem Kardinal Joseph Ratzinger auf dem Dresdner Katholikentreffen 1987 Am 22. April 1980 ernannte ihn Papst Johannes Paul II., den er seit Jahren persönlich kannte, zum Bischof von Berlin. In dieses Amt wurde er am 17. Mai 1980 eingeführt. Das Bistum Berlin mit seinen Ost- und Westteilen galt in der Zeit der Deutschen Teilung als eines der kirchenpolitisch schwierigsten europäischen Bistümer. 1984 weihte Bischof Meisner den in Berlin neu errichteten Karmel Regina Martyrum. Von 1982 bis 1989 stand Meisner der Berliner Bischofskonferenz vor. In dieser Funktion organisierte Meisner im Jahre 1987 das erste und einzige DDR-weite Katholikentreffen,[1] das mit über 100.000 Teilnehmern (bei weniger als 800.000 Katholiken in der DDR) ein großer Erfolg war.[2] Beim Abschlussgottesdienst sagte Meisner mit Anspielung auf die allgegenwärtigen Sowjetsterne (in Anwesenheit der staatlichen Vertreter), dass ?.die Christen in unserem Land keinem anderen Stern folgen möchten . als dem von Betlehem.?[3] Am 2. Februar 1983 nahm ihn Johannes Paul II. als Kardinalpriester mit der Titelkirche Santa Pudenziana in das Kardinalskollegium auf. Erzbischof von Köln Kontroverse um die Ernennung Nach dem Tod Joseph Kardinal Höffners im Jahr 1987 war das Amt des Kölner Erzbischofs neu zu besetzen. Traditionell besitzt das Kölner Domkapitel seit dem Jahr 1200 das Recht zur Wahl des Erzbischofs. Gemäß dem Staatskirchenvertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Preußen aus dem Jahr 1929 hat das Kapitel eine Liste von ?kanonisch geeigneten Kandidaten? bei der Bischofskongregation in Rom einzureichen, um auf diese Weise die Mitsprache der römischen Kurie und des Papstes sicherzustellen. Ebenso können die Bischöfe auf dem Gebiet des ehemaligen Preußen Vorschläge nach Rom schicken. Gemäß den Bestimmungen des preußischen Konkordates stellt der Papst ?unter Würdigung dieser Listen? einen Dreiervorschlag (Terna) zusammen, aus dem dann das Domkapitel einen Kandidaten zu wählen hat.[4] Freilich ist der Papst danach nicht an die eingereichten Vorschläge gebunden. Aufgrund des Dreiervorschlages aus Rom gelang dem Kölner Domkapitel keine Einigung, da nach den Statuten des Kölner Domkapitels eine absolute Mehrheit der Mitglieder des Kapitels für einen neuen Erzbischof stimmen musste. Nachdem Dompropst Bernard Henrichs dem päpstlichen Nuntius die nicht erfolgte Wahl mitgeteilt hatte, stellte sich Rom auf den Standpunkt des im Kirchenrecht vorgesehenen Devolutionsrechts, das besagt, dass die Entscheidung an die nächsthöhere Ebene fällt, wenn eine untere Ebene zu keiner Entscheidung kommt. Diesen Standpunkt vertrat der Heilige Stuhl auch gegenüber den Konkordatspartnern, den Ländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Ministerpräsidenten Johannes Rau und Bernhard Vogel waren dagegen der Auffassung, dass das Preußen-Konkordat zwingend eine Wahl vorschreibe und dass der völkerrechtliche Vertrag Vorrang vor dem kirchlichen Eigenrecht habe. Erst auf Druck der Ministerpräsidenten lenkte der Vatikan ein und ließ das Kapitel neuerlich wählen. Dazu änderte Papst Johannes Paul II. die Kölner Wahlordnung gemäß den Regeln des allgemeinen Kirchenrechts, wonach im dritten Wahlgang nur noch eine relative Mehrheit der Stimmen erforderlich war. Mit sechs Ja-Stimmen bei zehn Enthaltungen wurde Meisner schließlich gewählt und am 20. Dezember 1988 vom Papst zum Erzbischof von Köln ernannt. Am 12. Februar 1989 wurde er in sein neues Amt eingeführt. Theologen aus ganz Deutschland protestierten gegen das Vorgehe.
-
Original Autogramm Günter Gaus (1929-2004) /// Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 25,00
Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Schwarzweiss-Postkarte von Günter Gaus bildseitig mit blauem Kuli signiert, Knicke /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Günter Kurt Willi Gaus (* 23. November 1929 in Braunschweig; ? 14. Mai 2004 in Hamburg-Altona) war ein deutscher Journalist, Publizist, Diplomat und Politiker. Bekannt war er vor allem durch die Fernsehreihe Zur Person, in der er Prominente, insbesondere Politiker, interviewte. Günter Gaus wuchs als Sohn des Kaufmanns Willi Gaus und dessen Ehefrau Hedwig in Braunschweig auf.[1] Seine Eltern betrieben einen Laden für Gemüse und Südfrüchte.[2] Bombennächte in Luftschutzbunkern und der verheerende Bombenangriff vom 15. Oktober 1944 prägten den jungen Gaus nachhaltig.[3] Gaus besuchte die nahe dem Elternhaus gelegene Gaußschule, wo er 1949 das Abitur ablegte. Während der letzten Jahre seiner Schulzeit war er ab 1947 Chefredakteur und Mitherausgeber von Der Punkt, einer der ersten Schülerzeitungen der Nachkriegszeit in Deutschland.[4] Zu dieser Zeit wollte er bereits Journalist werden und hospitierte bei der Braunschweiger Zeitung.[5] Anschließend studierte er Germanistik und Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Schon während des Studiums war er journalistisch tätig. In den 1950er und 1960er Jahren arbeitete Gaus bei verschiedenen Tages- und Wochenzeitungen, darunter Der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung, wo er von 1961 bis 1965 politischer Redakteur war. Bekannt wurde seine Sendereihe Zur Person, die zum ersten Mal am 10. April 1963 im ZDF ausgestrahlt wurde. Hierin stellte Gaus jeweils einen Gast in Form eines Interviews vor. Die so entstandenen Porträts von Politikern, Wissenschaftlern und Künstlern gelten als Klassiker und werden im Fernsehen wiederholt. Gaus war in den Sendungen meist nur zu hören und führte die Reihe (teilweise unter anderem Titel) auf verschiedenen dritten Programmen über Jahrzehnte fort, zeitweise auch für dctp bei Sat.1. Von 1965 bis 1968 war er Programmdirektor für Hörfunk und Fernsehen beim Südwestfunk, 1966 auch Leiter des politischen TV-Magazins Report Baden-Baden. Nachdem er Mitte der 1960er Jahre in Büchern zur aktuellen politischen Lage in der Bundesrepublik Stellung genommen hatte, wurde er 1969 Chefredakteur des Wochenmagazins Der Spiegel. Der Spiegel und Gaus unterstützten die Ostpolitik der sozialliberalen Koalition. 1971 hatte er einen schauspielerischen Gastauftritt in der Tatort-Folge AE612 ohne Landeerlaubnis, in der er den Chef der Flugsicherung darstellte.[6] Günter Gaus als Ständiger Vertreter der Bundesrepublik 1974 im Gespräch mit Erich Honecker 1973 wechselte Gaus in die Politik und wurde Staatssekretär im Bundeskanzleramt. Er war als erster Leiter der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der DDR vorgesehen und übernahm dieses Amt auch nach Inkrafttreten des Grundlagenvertrages und der Einrichtung der Ständigen Vertretung im Jahr 1974. In dieser Position, die er bis 1981 innehatte, konnte er als ?Chefunterhändler? mit der DDR-Regierung viele humanitäre Erleichterungen für deutsch-deutsche Kontakte aushandeln. Zu seinen Verdiensten zählen unter anderem 17 Abkommen, die beispielsweise den Bau der Autobahn Hamburg-Berlin und Erleichterungen im Transitverkehr ermöglichten. 1976 trat Gaus in die SPD ein. 1981 gab er das Amt des Ständigen Vertreters an Klaus Bölling ab und wurde für kurze Zeit Senator für Wissenschaft und Kunst in Berlin. Nach der Wahlniederlage der SPD bei der Abgeordnetenhauswahl 1981 wandte er sich wieder der journalistischen Tätigkeit zu. In den 1980er Jahren verfasste er mehrere Bücher zur Lage der Bundesrepublik und der deutsch-deutschen Beziehungen sowie zur Sicherheitspolitik. Für sein journalistisches Schaffen erhielt er mehrere Auszeichnungen. Seit 1990 war er Mitherausgeber der linken Wochenzeitung Freitag. Er war auch Mitherausgeber der politisch-wissenschaftlichen Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Die deutsche Wiedervereinigung begleitete er kritisch, vor allem problematisierte er immer wieder eine mangelnde ?innere Einheit? Er war einer der ersten, der den ostdeutschen Umbruch als vorgezogene Systemveränderung im Westen wertete, weg vom gezügelten Rheinischen Kapitalismus, hin zum maßlosen, offensiv und aggressiv agierenden.[7] 2001 trat Gaus wegen der Erklärung von Bundeskanzler Gerhard Schröder zur ?uneingeschränkten Solidarität? mit der US-Regierung aus der SPD aus. Gaus? Ehrengrab in Berlin 1955 heiratete er in München Erika Butzengeiger, geboren 1931, Tochter des Bankmanagers Karl Butzengeiger. 1956 kam ihre Tochter Bettina Gaus zur Welt. Sie wurde ebenfalls Journalistin; als politische Korrespondentin arbeitete sie bei der überregionalen tageszeitung in Berlin, später schrieb sie für den Spiegel Kolumnen. Von 1969 bis zu seinem Tod 2004 lebte das Ehepaar, von berufsbedingten Umzügen unterbrochen, in Reinbek bei Hamburg. Im Alter von 74 Jahren erlag Gaus einem langen Krebsleiden.[8] Das Grab von Günter Gaus befindet sich auf dem Dorotheenstädtisch-Friedrichswerderschen Friedhof in Berlin-Mitte, nur wenige Schritte von der ehemaligen ?Ständigen Vertretung? entfernt (Hannoversche Straße 28-30).[9] Seit November 2010 ist es ein Ehrengrab des Landes Berlin. Seine - unvollendeten - Erinnerungen Widersprüche erschienen nach seinem Tod im selben Jahr.[8] /// Standort Wimregal GAD-10.240 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.
-
Original Autogramm Hans-Dieter Schütt Brief und Beilagen FDJ 1989 /// Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 25,00
Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbBlatt. Zustand: Gut. Konvolut 1 Brief mit Briefkopf JFJ mit blauer Tinte von Hans-Dieter Schütt signiert, dabei Sportler-Umfrage DDR 40 der Jungen Welt und der Briefumschlag mit dem Freistempler der Jungen Welt.- /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Hans-Dieter Schütt (* 16. August 1948 in Ohrdruf) ist ein deutscher Journalist. Von 1984 bis zur Wende und friedlichen Revolution im Herbst 1989 war er Chefredakteur des FDJ-Zentralorgans Junge Welt. Von 1992 bis 2012 war er Feuilletonredakteur beim Neuen Deutschland.[1] Hans-Dieter Schütt wurde 1948 im thüringischen Ohrdruf geboren und trat 1963 mit 15 Jahren der FDJ bei. Er absolvierte eine Berufsausbildung mit Abitur und arbeitete von 1967 bis 1969 als Gummifacharbeiter. Nach einer Zwischenstation als Buchhändlerlehrling studierte er von 1969 bis 1973 Dramaturgie und Theaterwissenschaften an der Theaterhochschule ?Hans Otto? in Leipzig. Ab 1973 arbeitete er als Filmkritiker für das FDJ-Zentralorgan Junge Welt (JW), damals mit einer täglichen Auflage von ca. einer Million Exemplare nach dem SED-Zentralorgan Neuen Deutschland die auflagenstärkste Tageszeitung der DDR. 1976 trat Schütt in die SED ein. 1984 wurde Schütt nach Stationen als stellvertretender Leiter der Kulturabteilung und als stellvertretender Chefredakteur als Nachfolger von Dieter Langguth Chefredakteur der Jungen Welt. Von 1981 bis 1989 war Schütt außerdem Abteilungsleiter, später auch Sekretär im Zentralrat der FDJ.[2] Als JW-Chefredakteur und mit seiner Kolumne So sehe ich das galt Schütt als ausgesprochener Hardliner und Demagoge. Bei oppositionellen Jugendlichen in den 1980er Jahren war er verhasst, eine ähnlich starke emotionale Ablehnung riefen sonst nur Margot Honecker (nicht aber ihr Ehemann Erich Honecker, dem in den 1980er Jahren eher Mitleid galt), Kurt Hager, Erich Mielke und Karl-Eduard von Schnitzler hervor.[3] Besonderes Aufsehen erregte Schütts Verriss des anti-stalinistischen Films Die Reue aus der Sowjetunion,[4] der im Oktober 1987 im ZDF ausgestrahlt worden war. Schütts Artikel vom 28. Oktober 1987 wurde weithin als deutliches Zeichen der Abkopplung von Perestroika und Glasnost durch die DDR-Führung gesehen und resultierte in zahlreichen Protesten besonders in der Kulturszene. Später wurde bekannt, dass Erich Honecker selbst den Artikel verschärfend schlussredigiert hatte.[5] Eine ähnliche Signalwirkung entfaltete vorher nur Kurt Hagers ?Tapeten-Vergleich? im April 1987, später auch das faktische Sputnik-Verbot im November 1988. In einer Kolumne im Dezember 1987 setzte Schütt Teilnehmer einer Mahnwache an der Ost-Berliner Zionskirche, die im November 1987 gegen die Verhaftungen von Mitgliedern der Umwelt-Bibliothek protestiert hatten, mit Neonazis gleich:[6] ?Der Feind, ob er nun mit missionarischem Eifer junge Literaten gegen uns losschickt, ob er nun in der Pose des Mahnwächters, stets pünktlich auf Bestellung mit Fernsehkameras, vor Kirchentore zieht, oder ob er Rowdys mit faschistischem Vokabular und Schlagwaffen ausrüstet - er hat bei uns keine Chance.? - Hans-Dieter Schütt: Junge Welt vom 12./13. Dezember 1987 Der Vergleich erlangte seine besondere Brisanz durch einen vorhergegangenen Überfall von Skinheads auf links-alternative Besucher eines Element-of-Crime-Konzerts in der Zionskirche vom 17. Oktober 1987, bei dem die Volkspolizei lange tatenlos zugesehen hatte. Gegen Schütts Artikel gab es zahlreiche Protestbriefe, auch von kirchenoffizieller Seite.[6] Die DDR-Oppositionelle Vera Wollenberger stellte im Dezember 1987 wegen des Artikels Strafanzeige wegen Beleidigung und Verleumdung gegen Schütt. Nachdem Wollenberger bald darauf im Zusammenhang mit einer Demonstration verhaftet und in den Westen abgeschoben wurde, verlief die Klage im Sand.[7][8] Schütt wurde am 21. November 1989 als JW-Chefredakteur abgelöst.[9] Als Autor, Interviewer und Herausgeber verfasste Schütt nach 1990 zahlreiche Bücher, darunter seine Autobiographie Glücklich beschädigt von 2009. Kritiker sahen in dem Buch einen ehrlichen und schonungslosen Versuch der Abrechnung mit seiner Rolle im System der DDR.[10] Uwe Stolzmann beschrieb im Deutschlandradio Kultur Schütt als in den letzten Jahren der DDR brillanten Autor, Feingeist und Scharfmacher, ?kurz: ein Demagoge?.[11] Seit 2013 ist er im Ruhestand, veröffentlicht aber gelegentlich als freier Mitarbeiter weiter Artikel im neuen deutschland. Außerdem ist er in neuerer Zeit als Filmregisseur tätig. Gregor Gysi hat seine 2017 veröffentlichte Autobiografie (Ein Leben ist zu wenig) unter Mitarbeit von Hans-Dieter Schütt verfasst. /// Standort Wimregal Ill-Umschl2024-12 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.
-
Urkunde 269 für Werner Kühn zur Alblegung der Prüfung für das Abzeichen für gutes Wissen in Gold mit eigenhändiger Unterschrift von Erich Honecker (Berlin, den 03.08.1950).
Verlag: Berlin., FDJ, 1950
Anbieter: Rotes Antiquariat, Berlin, Deutschland
Signiert
EUR 100,00
Währung umrechnenEUR 3,50 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den Warenkorb1 Bl. 4°. FDJ-Urkunde des ehemaligen Sekretärs des Rates für Kultur der DDR Werner Kühn mit eigenhändiger Unterschrift des damaligen FDJ Vorsitzenden Erich Honecker (1912 ? 1994). - Guter Zustand. 1050 gr.