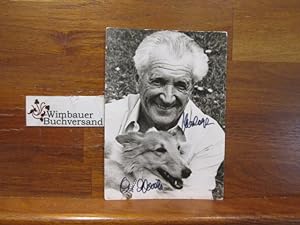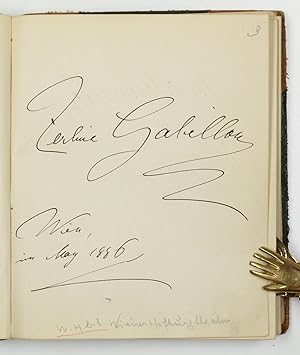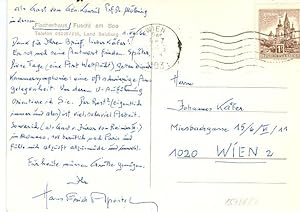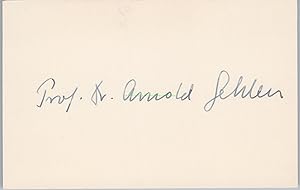Manuskripte & Papierantiquitäten, arnold hans das (30 Ergebnisse)
FeedbackSuchfilter
Produktart
- Alle Product Types
- Bücher (1.624)
- Magazine & Zeitschriften (41)
- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Noten (3)
- Kunst, Grafik & Poster (1)
- Fotografien (7)
- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Manuskripte & Papierantiquitäten (30)
Zustand
- Alle
- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Antiquarisch (30)
Einband
Weitere Eigenschaften
Sprache (2)
Gratisversand
- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
Land des Verkäufers
Verkäuferbewertung
-
Postkarte Bildnis Hans Thoma von Karl Bauer
Verlag: Berlin: Heyder
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität
EUR 10,00
Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Nicht postgelaufen /// Hans Thoma (* 2. Oktober 1839 in Oberlehen, Bernau im Schwarzwald, heute Landkreis Waldshut; ? 7. November 1924 in Karlsruhe) war ein deutscher Maler und Grafiker. Hans Thoma stammte aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater Franz Joseph Thoma (1794-1855) war ein gelernter Müller und arbeitete als Holzarbeiter im Schwarzwald. Seine Mutter Rosa Thoma (1804-1897), geborene Mayer, stammte aus einer Kunsthandwerkerfamilie. Ihr Großvater stammte aus Menzenschwand und war ein Bruder des Großvaters von Franz Xaver und Hermann Winterhalter.[1][2] Die begonnenen Lehren, zuerst als Lithograph und Anstreicher in Basel, dann als Uhrenschildmaler in Furtwangen, brach er ab. Er betrieb autodidaktische Mal- und Zeichenstudien, bevor er 1859 von der Großherzoglichen Kunstschule in Karlsruhe aufgenommen wurde, wo er u. a. Schüler von Johann Wilhelm Schirmer und Ludwig Des Coudres war. 1866 beendete Thoma sein Studium. Wanderjahre Auf einer Waldwiese, 1876, Hamburger Kunsthalle. Thomas Braut Cella war das Modell der weiblichen Figur im Bild Nach Aufenthalten in Basel und Düsseldorf (1867-1868)[3] ging er zusammen mit Otto Scholderer 1868 nach Paris, wo ihn besonders die Werke Gustave Courbets und der Schule von Barbizon beeindruckten. Thoma ging schließlich nach München, die damalige Kunsthauptstadt Deutschlands. Er lebte dort von 1870 bis 1876. 1874 reiste er erstmals nach Italien. 1877 heiratete Thoma die Blumen- und Stilllebenmalerin Cella Berteneder. Eine zweite Italienreise folgte 1880, nachdem er 1879 England bereist hatte und dort 1884 im Art Club Liverpool ausstellen sollte. Er war mit Arnold Böcklin befreundet und stand dem Leibl-Kreis nahe. Frankfurt und Kronberg Interieur des Palais Pringsheim Seit 1878 lebte Thoma im Frankfurter Westend, Haus an Haus mit dem Malerfreund Wilhelm Steinhausen, und in gemeinsamem Haushalt mit seiner Ehefrau, seiner Schwester Agathe und mit Ella, der 1878 adoptierten Nichte seiner Frau. Dort traf er unter anderem auf den in der Nachbarschaft (Mendelssohnstraße 69) lebenden SDAP-Politiker, Ex-Internatsdirektor und Privatgelehrten Samuel Spier und seine Frau, die Schriftstellerin und Kunstkritikerin Anna Spier. Die Spiers wie auch andere Bekannte Steinhausens unterstützten Thoma mit Aufträgen. Anna Spier schrieb Artikel und ein Porträt in Buchform über ihn; Thoma schuf für sie ein Exlibris und malte ein Porträt, das sich heute im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg befindet. Von 1886 bis 1899 lebte er in der Frankfurter Wolfsgangstraße 150 und von 1896 bis 1898 zugleich auch in Oberursel in der Taunusstraße 20 (heute Altkönigstr. 20). Inschriften an beiden Häusern weisen darauf hin. Während dieser Zeit entstand auch der Fries mit mythologischen Szenen im Palais Pringsheim in München. Zeitweise beherbergte er den Schriftsteller Julius Langbehn. Der Erbauer des Wohnhauses der Thomas, Simon Ravenstein, unterstützte Thoma mit zahlreichen Aufträgen, deren erster 1882 die Ausmalung des Hauses des Architekten selbst war. Thoma stand den Malern der Kronberger Malerkolonie nahe. 1899 bezog die vierköpfige Familie in Kronberg im Taunus eine Wohnung mit Atelier neben dem Friedrichshof, was Thoma als sichtbaren Ausdruck der lang ersehnten Anerkennung als Maler empfand. Karlsruhe Selbstporträt mit Blume, 1919, National Gallery of Art Hermann Dumler: Hans Thoma auf dem Totenbett 1899 wurde Hans Thoma zum Professor an der Großherzoglichen Kunstschule in Karlsruhe und zum Direktor der Kunsthalle Karlsruhe ernannt. Dieses Amt übte er bis 1920 aus.[4] In der Kunsthalle stattete er die Thoma-Kapelle aus, die noch heute dort zu besichtigen ist; zu seinem 70. Geburtstag eröffnete ein Anbau mit Thoma-Museum. Die Karlsruher Zeit wurde überschattet durch den Tod seiner Frau Cella 1901, der Thoma jahrelang depressiv stimmte. Thoma wohnte nunmehr mit seiner Schwester in Karlsruhe. Seit seiner Ausstellung im Münchner Kunstverein 1890 wurde er allgemein in Deutschland anerkannt. Thoma gehörte bis um etwa 1910 zu den angesehensten Malern Deutschlands. Meyers Großes Konversations-Lexikon hielt 1909 fest, er sei ?einer der Lieblingsmaler des deutschen Volkes geworden?,[5] eine Bezeichnung, die 2013 vom Frankfurter Städel-Museum mit der Ausstellung Hans Thoma. ?Lieblingsmaler des deutschen Volkes? aufgegriffen wurde.[6] Von 1905 bis 1918 war Thoma vom Großherzog ernanntes Mitglied der Ersten Kammer des Badischen Landtags. Im Oktober 1914 gehörte er zu den Unterzeichnern des Manifestes der 93, dessen Text zu Beginn des Ersten Weltkrieges den deutschen Militarismus zu verteidigen versuchte und bestritt, dass Kriegsgräuel in Belgien stattgefunden hatten.[7] 1919 organisierten Ernst Oppler und Lovis Corinth eine Geburtstagsfeier anlässlich seines 80.[8] Hans Thoma starb im November 1924 mit 85 Jahren in Karlsruhe. Künstlerische Entwicklung und Bedeutung Der Rhein bei Säckingen, 1873, Alte Nationalgalerie Mainebene, 1875, Museum für Franken Acht tanzende Frauen in Vogelkörpern, 1886 Thomas Frühwerke sind von einem lyrischen Pantheismus geprägt. In seiner Münchner Zeit malte er vor allem Landschaften. In Frankfurt standen Arbeiten mit erzählerischem oder allegorischem Inhalt im Mittelpunkt seines Schaffens. Im Alter arbeitete er intensiv an seiner ?Thoma-Kapelle?, die er mit Szenen aus dem Leben und Wirken Jesu Christi ausschmückte. Als seine besten und authentischsten Werke gelten noch heute seine Landschaften (Schwarzwald, Oberrheinebene und Taunus) und die Porträts seiner Freunde und Angehörigen wie auch seine Selbstporträts. Weniger überzeugen können heute oft grotesk überzeichnete, realistische, mythologisch-religiöse Darstellungen, die stark von Arnold Böcklin beeinflusst sind. Er gehörte zur bevorzugten Auswahl zeitgenössischer Künstler, die das Komité zur Beschaffung und Bewertung von Stollwerckbildern dem Kölner Schokoladeproduzent Ludwig Stollwerck zur Beauftragung für Entwürfe vorschlug.[9] Der Kunsthistoriker Henry Thode stilisierte Thomas Werk zu einer Verkörperung n.
-
Original Autogramm Carl-Heinz Schroth (1902-1989) /// Autogramm Autograph signiert signed signee
Verlag: Rüdel
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 10,00
Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 3 verfügbar
In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Carl-Heinz Schroth mit Hund im Arm bildseitig mit schwarzem Stift signiert, ggf. mit eigenhändigem Zusatz "Herzlichst" oder "Für Christa herzlichst" /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Carl-Heinz Schroth (auch: Karl-Heinz, Carl Heinz oder Karl Heinz; * 29. Juni 1902 in Innsbruck; ? 19. Juli 1989 in München) war ein österreichisch-deutscher Schauspieler, Regisseur, Hörspiel- und Synchronsprecher. Carl-Heinz Schroth wuchs in einer Künstlerfamilie auf: Seine Mutter Else Ruttersheim war Schauspielerin in Wien, sein Vater Heinrich Schroth ein bekannter Bühnendarsteller und Dandy aus Pirmasens, der in Berlin Karriere gemacht hat. Schroths Stiefmutter war die berühmte Schauspielerin Käthe Haack, seine Halbschwester die später ebenfalls als Darstellerin erfolgreiche Hannelore Schroth. Schroths Eltern trennten sich früh, und er verlebte seine Schulzeit bei einer Tante, einer Opernsängerin, in Bozen (damals Österreich-Ungarn). Schroth studierte Rechts-, Literatur- und Theaterwissenschaften in München und nahm Schauspielunterricht bei Arnold Marlé. 1922 erhielt er ein erstes Engagement in Frankfurt/Oder, wo er einerseits in Stücken wie Schillers Fiesko, aber auch in Peterchens Mondfahrt zu sehen war. Danach verdingte er sich zunächst zeitweise bei Wanderbühnen und spielte in den folgenden Jahren an Theatern in Brünn, Düsseldorf, Hamburg, Wien und Berlin. Klein von Statur und als junger Mann von koboldartigem Aussehen, verkörperte er bereits früh ältere Personen und Chargenrollen. Gelegentlich übernahm er auch kleinere Regiearbeiten. 1927 kam er durch Vermittlung der renommierten Schauspielerin Mirjam Horwitz an die jungen Hamburger Kammerspiele und übernahm die Titelrolle in Der Revisor von Nikolai Gogol, die nach eigenem Bekunden eine der wichtigsten Rollen seines Lebens blieb. Bereits eine tragende Rolle spielte er 1931 in der Filmoperette Der Kongreß tanzt (1931, Regie: Erik Charell) als Pepi neben Lilian Harvey und Willy Fritsch. Auch während der Zeit des Nationalsozialismus war Schroth weiterhin in Deutschland und Österreich als Schauspieler tätig. Ab 1937 spielte er abwechselnd an den Münchner Kammerspielen und am Deutschen Theater in Berlin. Er drehte eine Handvoll Filme und wirkte 1945 vor Kriegsende in der letzten Produktion der von Joseph Goebbels 1942 gleichgeschalteten deutschen Filmwirtschaft überhaupt mit: Shiva und die Galgenblume (Regie: Hans Steinhoff mit Hans Albers in der Hauptrolle, hergestellt in Prag, blieb unvollendet). Schroth war allerdings kein Nationalsozialist und distanzierte sich in seinen Memoiren später von diesen Tätigkeiten. Nach dem Krieg lebte Schroth zunächst unter schwierigen Bedingungen mit seiner Frau Ruth Hausmeister und Kind bei Käthe Haack und Hannelore Schroth in einem Keller und schlug sich mit seiner Familie in Berlin als Schwarzmarkthändler durch. Ein erstes Theaterengagement verschaffte ihm sein langjähriger Kollege Viktor de Kowa an dessen neu gegründetem Boulevardtheater in der Tribüne. Dem Boulevard blieb der Schauspieler in den folgenden vier Jahrzehnten seiner Karriere treu. Während der späten 1940er- und 1950er-Jahre spielte Carl-Heinz Schroth in einigen recht erfolgreichen Filmen kleinere Rollen, aber auch ausgebaute Nebenrollen wie Diener, Sekretäre, Hausfreunde, Kleinganoven und Zirkusleute mit Humor und Herz. Sein bekanntester Film aus dieser Zeit ist Wenn der Vater mit dem Sohne (1955, Regie: Hans Quest) mit Heinz Rühmann und Oliver Grimm; Schroth spielt darin den Clown Peepe. Nach 1960 drehte Schroth keine Kinofilme mehr. Als Hörspielsprecher war er in einer großen Anzahl von Produktionen unterschiedlicher Genres zu hören. Ende der 1950er-Jahre hatte Schroth großen Erfolg mit der 51 Folgen umfassenden Reihe um den ?größten Verbrecher seit der Erfindung Chicagos? Dickie Dick Dickens des Bayerischen Rundfunks unter der Regie von Walter Netzsch, nach den Romanen von Rolf und Alexandra Becker, ebenso wie mit der Hörspielreihe Gestatten, mein Name ist Cox, in dem er ebenfalls die Hauptrolle sprach. Die ersten beiden Staffeln, die 1952 und 1954 vom NWDR Hamburg unter der Regie von Hans Gertberg produziert wurden, gehörten zu den ersten Straßenfegern im deutschen Rundfunk. In den 1950er- und 1960er-Jahren führte der Schauspieler auch gelegentlich Regie bei deutschen Film- und Fernsehproduktionen. Zu seinen bekanntesten Regiearbeiten zählt der Film Fräulein vom Amt (1954) mit Renate Holm und Georg Thomalla nach einer literarischen Vorlage von Curth Flatow; das Drehbuch 1954 verfasste Schroths dritte Ehefrau und Kollegin Karin Jacobsen. Sein Bekanntheitsgrad erhöhte sich durch verschiedene Fernsehproduktionen, so durch die frühe Satire Orden für die Wunderkinder von Rainer Erler (1963) mit Edith Heerdegen, in der die Orden-Sucht der Deutschen satirisch thematisiert wurde. Schroth und Heerdegen traten darüber hinaus verschiedentlich in gemeinsamen Filmen auf. So entstand aus der Special-Reihe Die Alten kommen des ZDF, in der Schroth und Heerdegen Charaktere älterer Menschen mit seltener Komik spielten, die genannte Serie Jakob und Adele. Erst nach Heerdegens Tod zu Beginn der Produktion und somit vor Erstausstrahlung der Reihe ging das Angebot für die weibliche Hauptrolle an Brigitte Horney. Ein Star mit hohem Bekanntheitsgrad wurde Carl-Heinz Schroth erst im Alter. Verschmitzt und mit hintergründigem Humor wurde er über Jahre zum Inbild des vitalen, humorvollen Seniors und eine feste Größe auf dem deutschen Fernsehbildschirm. Seit Ende der 1950er-Jahre war er in Familiengeschichten, Kriminalkomödien, aber auch ernsthaften Fernsehinszenierungen wie Der Strafverteidiger (1961, Regie: Franz Josef Wild) neben Eric Pohlmann und Barbara Rütting zu sehen. In späteren Jahren trat er auch häufiger in Serien wie Derrick oder Die Schwarzwaldklinik auf. Als Gastgeber führte er durch die Reihe Meine schwarze Stunde, in der er Grusel- und Schauergeschichten präsentierte. Von den Ferns.
-
Postkarte Selbstbildnis
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität
EUR 10,00
Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbUmschlag. Zustand: Gut. Kanten berieben, 1955 beschrieben, aber nicht postgelaufen /// Hans Thoma (* 2. Oktober 1839 in Oberlehen, Bernau im Schwarzwald, heute Landkreis Waldshut; ? 7. November 1924 in Karlsruhe) war ein deutscher Maler und Grafiker. Hans Thoma stammte aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater Franz Joseph Thoma (1794-1855) war ein gelernter Müller und arbeitete als Holzarbeiter im Schwarzwald. Seine Mutter Rosa Thoma (1804-1897), geborene Mayer, stammte aus einer Kunsthandwerkerfamilie. Ihr Großvater stammte aus Menzenschwand und war ein Bruder des Großvaters von Franz Xaver und Hermann Winterhalter.[1][2] Die begonnenen Lehren, zuerst als Lithograph und Anstreicher in Basel, dann als Uhrenschildmaler in Furtwangen, brach er ab. Er betrieb autodidaktische Mal- und Zeichenstudien, bevor er 1859 von der Großherzoglichen Kunstschule in Karlsruhe aufgenommen wurde, wo er u. a. Schüler von Johann Wilhelm Schirmer und Ludwig Des Coudres war. 1866 beendete Thoma sein Studium. Wanderjahre Auf einer Waldwiese, 1876, Hamburger Kunsthalle. Thomas Braut Cella war das Modell der weiblichen Figur im Bild Nach Aufenthalten in Basel und Düsseldorf (1867-1868)[3] ging er zusammen mit Otto Scholderer 1868 nach Paris, wo ihn besonders die Werke Gustave Courbets und der Schule von Barbizon beeindruckten. Thoma ging schließlich nach München, die damalige Kunsthauptstadt Deutschlands. Er lebte dort von 1870 bis 1876. 1874 reiste er erstmals nach Italien. 1877 heiratete Thoma die Blumen- und Stilllebenmalerin Cella Berteneder. Eine zweite Italienreise folgte 1880, nachdem er 1879 England bereist hatte und dort 1884 im Art Club Liverpool ausstellen sollte. Er war mit Arnold Böcklin befreundet und stand dem Leibl-Kreis nahe. Frankfurt und Kronberg Interieur des Palais Pringsheim Seit 1878 lebte Thoma im Frankfurter Westend, Haus an Haus mit dem Malerfreund Wilhelm Steinhausen, und in gemeinsamem Haushalt mit seiner Ehefrau, seiner Schwester Agathe und mit Ella, der 1878 adoptierten Nichte seiner Frau. Dort traf er unter anderem auf den in der Nachbarschaft (Mendelssohnstraße 69) lebenden SDAP-Politiker, Ex-Internatsdirektor und Privatgelehrten Samuel Spier und seine Frau, die Schriftstellerin und Kunstkritikerin Anna Spier. Die Spiers wie auch andere Bekannte Steinhausens unterstützten Thoma mit Aufträgen. Anna Spier schrieb Artikel und ein Porträt in Buchform über ihn; Thoma schuf für sie ein Exlibris und malte ein Porträt, das sich heute im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg befindet. Von 1886 bis 1899 lebte er in der Frankfurter Wolfsgangstraße 150 und von 1896 bis 1898 zugleich auch in Oberursel in der Taunusstraße 20 (heute Altkönigstr. 20). Inschriften an beiden Häusern weisen darauf hin. Während dieser Zeit entstand auch der Fries mit mythologischen Szenen im Palais Pringsheim in München. Zeitweise beherbergte er den Schriftsteller Julius Langbehn. Der Erbauer des Wohnhauses der Thomas, Simon Ravenstein, unterstützte Thoma mit zahlreichen Aufträgen, deren erster 1882 die Ausmalung des Hauses des Architekten selbst war. Thoma stand den Malern der Kronberger Malerkolonie nahe. 1899 bezog die vierköpfige Familie in Kronberg im Taunus eine Wohnung mit Atelier neben dem Friedrichshof, was Thoma als sichtbaren Ausdruck der lang ersehnten Anerkennung als Maler empfand. Karlsruhe Selbstporträt mit Blume, 1919, National Gallery of Art Hermann Dumler: Hans Thoma auf dem Totenbett 1899 wurde Hans Thoma zum Professor an der Großherzoglichen Kunstschule in Karlsruhe und zum Direktor der Kunsthalle Karlsruhe ernannt. Dieses Amt übte er bis 1920 aus.[4] In der Kunsthalle stattete er die Thoma-Kapelle aus, die noch heute dort zu besichtigen ist; zu seinem 70. Geburtstag eröffnete ein Anbau mit Thoma-Museum. Die Karlsruher Zeit wurde überschattet durch den Tod seiner Frau Cella 1901, der Thoma jahrelang depressiv stimmte. Thoma wohnte nunmehr mit seiner Schwester in Karlsruhe. Seit seiner Ausstellung im Münchner Kunstverein 1890 wurde er allgemein in Deutschland anerkannt. Thoma gehörte bis um etwa 1910 zu den angesehensten Malern Deutschlands. Meyers Großes Konversations-Lexikon hielt 1909 fest, er sei ?einer der Lieblingsmaler des deutschen Volkes geworden?,[5] eine Bezeichnung, die 2013 vom Frankfurter Städel-Museum mit der Ausstellung Hans Thoma. ?Lieblingsmaler des deutschen Volkes? aufgegriffen wurde.[6] Von 1905 bis 1918 war Thoma vom Großherzog ernanntes Mitglied der Ersten Kammer des Badischen Landtags. Im Oktober 1914 gehörte er zu den Unterzeichnern des Manifestes der 93, dessen Text zu Beginn des Ersten Weltkrieges den deutschen Militarismus zu verteidigen versuchte und bestritt, dass Kriegsgräuel in Belgien stattgefunden hatten.[7] 1919 organisierten Ernst Oppler und Lovis Corinth eine Geburtstagsfeier anlässlich seines 80.[8] Hans Thoma starb im November 1924 mit 85 Jahren in Karlsruhe. Künstlerische Entwicklung und Bedeutung Der Rhein bei Säckingen, 1873, Alte Nationalgalerie Mainebene, 1875, Museum für Franken Acht tanzende Frauen in Vogelkörpern, 1886 Thomas Frühwerke sind von einem lyrischen Pantheismus geprägt. In seiner Münchner Zeit malte er vor allem Landschaften. In Frankfurt standen Arbeiten mit erzählerischem oder allegorischem Inhalt im Mittelpunkt seines Schaffens. Im Alter arbeitete er intensiv an seiner ?Thoma-Kapelle?, die er mit Szenen aus dem Leben und Wirken Jesu Christi ausschmückte. Als seine besten und authentischsten Werke gelten noch heute seine Landschaften (Schwarzwald, Oberrheinebene und Taunus) und die Porträts seiner Freunde und Angehörigen wie auch seine Selbstporträts. Weniger überzeugen können heute oft grotesk überzeichnete, realistische, mythologisch-religiöse Darstellungen, die stark von Arnold Böcklin beeinflusst sind. Er gehörte zur bevorzugten Auswahl zeitgenössischer Künstler, die das Komité zur Beschaffung und Bewertung von Stollwerckbildern dem Kölner Schokoladeproduzent Ludwig Stollwerck zur Beauftragung für Entwürfe vorschlug.[9] Der Kunsthistoriker Henry Thode stilisi.
-
Original Autogramm Carl-Heinz Schroth (1902-1989) /// Autogramm Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 10,00
Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Carl-Heinz Schroth bildseitig mit schwarzem Stift signiert mit eigenhändigem Zusatz /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Carl-Heinz Schroth (auch: Karl-Heinz, Carl Heinz oder Karl Heinz; * 29. Juni 1902 in Innsbruck; ? 19. Juli 1989 in München) war ein österreichisch-deutscher Schauspieler, Regisseur, Hörspiel- und Synchronsprecher. Carl-Heinz Schroth wuchs in einer Künstlerfamilie auf: Seine Mutter Else Ruttersheim war Schauspielerin in Wien, sein Vater Heinrich Schroth ein bekannter Bühnendarsteller und Dandy aus Pirmasens, der in Berlin Karriere gemacht hat. Schroths Stiefmutter war die berühmte Schauspielerin Käthe Haack, seine Halbschwester die später ebenfalls als Darstellerin erfolgreiche Hannelore Schroth. Schroths Eltern trennten sich früh, und er verlebte seine Schulzeit bei einer Tante, einer Opernsängerin, in Bozen (damals Österreich-Ungarn). Schroth studierte Rechts-, Literatur- und Theaterwissenschaften in München und nahm Schauspielunterricht bei Arnold Marlé. 1922 erhielt er ein erstes Engagement in Frankfurt/Oder, wo er einerseits in Stücken wie Schillers Fiesko, aber auch in Peterchens Mondfahrt zu sehen war. Danach verdingte er sich zunächst zeitweise bei Wanderbühnen und spielte in den folgenden Jahren an Theatern in Brünn, Düsseldorf, Hamburg, Wien und Berlin. Klein von Statur und als junger Mann von koboldartigem Aussehen, verkörperte er bereits früh ältere Personen und Chargenrollen. Gelegentlich übernahm er auch kleinere Regiearbeiten. 1927 kam er durch Vermittlung der renommierten Schauspielerin Mirjam Horwitz an die jungen Hamburger Kammerspiele und übernahm die Titelrolle in Der Revisor von Nikolai Gogol, die nach eigenem Bekunden eine der wichtigsten Rollen seines Lebens blieb. Bereits eine tragende Rolle spielte er 1931 in der Filmoperette Der Kongreß tanzt (1931, Regie: Erik Charell) als Pepi neben Lilian Harvey und Willy Fritsch. Auch während der Zeit des Nationalsozialismus war Schroth weiterhin in Deutschland und Österreich als Schauspieler tätig. Ab 1937 spielte er abwechselnd an den Münchner Kammerspielen und am Deutschen Theater in Berlin. Er drehte eine Handvoll Filme und wirkte 1945 vor Kriegsende in der letzten Produktion der von Joseph Goebbels 1942 gleichgeschalteten deutschen Filmwirtschaft überhaupt mit: Shiva und die Galgenblume (Regie: Hans Steinhoff mit Hans Albers in der Hauptrolle, hergestellt in Prag, blieb unvollendet). Schroth war allerdings kein Nationalsozialist und distanzierte sich in seinen Memoiren später von diesen Tätigkeiten. Nach dem Krieg lebte Schroth zunächst unter schwierigen Bedingungen mit seiner Frau Ruth Hausmeister und Kind bei Käthe Haack und Hannelore Schroth in einem Keller und schlug sich mit seiner Familie in Berlin als Schwarzmarkthändler durch. Ein erstes Theaterengagement verschaffte ihm sein langjähriger Kollege Viktor de Kowa an dessen neu gegründetem Boulevardtheater in der Tribüne. Dem Boulevard blieb der Schauspieler in den folgenden vier Jahrzehnten seiner Karriere treu. Während der späten 1940er- und 1950er-Jahre spielte Carl-Heinz Schroth in einigen recht erfolgreichen Filmen kleinere Rollen, aber auch ausgebaute Nebenrollen wie Diener, Sekretäre, Hausfreunde, Kleinganoven und Zirkusleute mit Humor und Herz. Sein bekanntester Film aus dieser Zeit ist Wenn der Vater mit dem Sohne (1955, Regie: Hans Quest) mit Heinz Rühmann und Oliver Grimm; Schroth spielt darin den Clown Peepe. Nach 1960 drehte Schroth keine Kinofilme mehr. Als Hörspielsprecher war er in einer großen Anzahl von Produktionen unterschiedlicher Genres zu hören. Ende der 1950er-Jahre hatte Schroth großen Erfolg mit der 51 Folgen umfassenden Reihe um den ?größten Verbrecher seit der Erfindung Chicagos? Dickie Dick Dickens des Bayerischen Rundfunks unter der Regie von Walter Netzsch, nach den Romanen von Rolf und Alexandra Becker, ebenso wie mit der Hörspielreihe Gestatten, mein Name ist Cox, in dem er ebenfalls die Hauptrolle sprach. Die ersten beiden Staffeln, die 1952 und 1954 vom NWDR Hamburg unter der Regie von Hans Gertberg produziert wurden, gehörten zu den ersten Straßenfegern im deutschen Rundfunk. In den 1950er- und 1960er-Jahren führte der Schauspieler auch gelegentlich Regie bei deutschen Film- und Fernsehproduktionen. Zu seinen bekanntesten Regiearbeiten zählt der Film Fräulein vom Amt (1954) mit Renate Holm und Georg Thomalla nach einer literarischen Vorlage von Curth Flatow; das Drehbuch 1954 verfasste Schroths dritte Ehefrau und Kollegin Karin Jacobsen. Sein Bekanntheitsgrad erhöhte sich durch verschiedene Fernsehproduktionen, so durch die frühe Satire Orden für die Wunderkinder von Rainer Erler (1963) mit Edith Heerdegen, in der die Orden-Sucht der Deutschen satirisch thematisiert wurde. Schroth und Heerdegen traten darüber hinaus verschiedentlich in gemeinsamen Filmen auf. So entstand aus der Special-Reihe Die Alten kommen des ZDF, in der Schroth und Heerdegen Charaktere älterer Menschen mit seltener Komik spielten, die genannte Serie Jakob und Adele. Erst nach Heerdegens Tod zu Beginn der Produktion und somit vor Erstausstrahlung der Reihe ging das Angebot für die weibliche Hauptrolle an Brigitte Horney. Ein Star mit hohem Bekanntheitsgrad wurde Carl-Heinz Schroth erst im Alter. Verschmitzt und mit hintergründigem Humor wurde er über Jahre zum Inbild des vitalen, humorvollen Seniors und eine feste Größe auf dem deutschen Fernsehbildschirm. Seit Ende der 1950er-Jahre war er in Familiengeschichten, Kriminalkomödien, aber auch ernsthaften Fernsehinszenierungen wie Der Strafverteidiger (1961, Regie: Franz Josef Wild) neben Eric Pohlmann und Barbara Rütting zu sehen. In späteren Jahren trat er auch häufiger in Serien wie Derrick oder Die Schwarzwaldklinik auf. Als Gastgeber führte er durch die Reihe Meine schwarze Stunde, in der er Grusel- und Schauergeschichten präsentierte. Von den Fernsehproduktionen seiner späteren Jahre bleibt die Aufzeichnung von Harold Pinters Theaterstück Niemandsland unter der.
-
Original Autogramm Peter Thom (1935-2005) /// Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 10,00
Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. SW-Postkarte von Peter Thom bildseitig mit hellschwarzem Edding signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Peter Thom (* 6. Februar 1935 in Berlin; ? 23. September 2005 in München) war ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Peter Thom wuchs in Berlin und Hannover auf. Nach dem Erreichen der Mittleren Reife begann er 1952 eine Bäckerlehre, die er aber nach einem halben Jahr abbrach, um die Schauspielschule Hannover zu besuchen. Sein erstes Engagement erhielt er 1954 an der Landesbühne Hannover. Von 1957 bis 1958 trat er am Niedersächsischen Staatstheater Hannover auf. Anschließend war er in seiner Geburtsstadt Berlin tätig. Zunächst an der Tribüne Berlin (1959) und von 1962 bis 1969 an der Schaubühne am Halleschen Ufer. Ab 1979 war er am Bayerischen Staatsschauspiel in München unter Vertrag und ab 1983 zudem am Münchener Volkstheater. Er spielte u. a. in: Nächstes Jahr in Jerusalem von Arnold Wesker, Antigone von Bertolt Brecht, Alle meine Söhne von Arthur Miller (Tournee von 1974 mit René Deltgen), Mutter Courage und ihre Kinder von Bertolt Brecht, mit Ruth Drexel und Der Hauptmann von Köpenick (als Kalle) von Carl Zuckmayer, mit Hans Jürgen Diedrich, unter der Regie von Horst Sachtleben. Zum Film kam er Ende der 1950er Jahre. Schon 1959 konnte man ihn in seiner ersten Hauptrolle erleben. Er spielte den Esel in dem Märchenfilm Die Bremer Stadtmusikanten. Weitere Filme folgten, wie Der Jugendrichter mit Heinz Rühmann, Die junge Sünderin mit Karin Baal und Heute kündigt mir mein Mann mit Gert Fröbe. Auch beim Fernsehen konnte er schnell Fuß fassen. Seine erste größere Rolle spielte er in zwei Folgen des fünfteiligen Straßenfegers Am grünen Strand der Spree nach dem Buch von Hans Scholz. Er verkörperte den noch minderjährigen Hans Wratislaw von Zehdenitz, der im August 1939 die Chance dem drohenden Krieg zu entkommen nicht wahrnimmt und im April 1945 kurz vor Berlin fällt. In dem dreiteiligen Krimi-Klassiker Die Schlüssel von Francis Durbridge spielte er das Mordopfer Phil Martin. Daneben sah man ihn in vielen Fernsehserien wie Kommissar Freytag, Das Kriminalmuseum und Hamburg Transit, sowie in Fernsehspielen wie Brille und Bombe - Bei uns liegen Sie richtig und Der Tod des Handlungsreisenden. Auch als Hörspielsprecher war Thom tätig. In den ersten Jahren sprach er meistens Hauptrollen, wie 1960 in Durchgebrannt, 1972 in Zeitklippe oder 1971 in Horst M.: Lebenslänglich. Als viel beschäftigten Synchronsprecher kennt man seine Stimme aus vielen ausländischen Fernsehserien, darunter Die Simpsons, Task Force Police und Muppet Show. Häufig sprach er auch kleinere Nebenrollen, wie in der Synchronfassung des Spielfilms Casablanca von 1975 mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman. Wegen gesundheitlicher Probleme wurden seine Rollen in den späteren Jahren zunehmend kleiner. Um 1998 gab er seine Arbeit vor der Kamera auf, etwa drei Jahre später auch seine Synchrontätigkeit. Thom, der seit vielen Jahren in München lebte, war seit 1958 verheiratet und hatte eine Tochter. Am 23. September 2005 nahm er sich mit einem Sprung aus dem 9. Stockwerk seines Wohnhauses das Leben. Er soll anonym auf dem Münchner Waldfriedhof beerdigt worden sein. /// Standort Wimregal Pkis-Box49-U005 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.
-
Original Autogramm Ulrike Arnold // Autogramm Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 20,00
Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 3 verfügbar
In den WarenkorbEchtfoto. Zustand: Sehr gut. Schönes Farbfoto von Ulrike Arnold bildseitig mit weissem Stift signiert mit eigenhändigem Zusatz "Herzlichst" (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Ulrike Arnold (* 1965 in Worms) ist eine deutsche Theaterregisseurin, Schauspielerin und Schauspieldozentin. Ulrike Arnold wuchs in München auf und wurde an der Theaterakademie Ulm zur Schauspielerin ausgebildet. Engagements als Schauspielerin führten sie an die Bayerische Staatsoper, die Münchner Kammerspiele, das Teamtheater München, das Theater am Sozialamt TamS, das Metropoltheater München und an das Düsseldorfer Schauspielhaus. Von 2002 bis 2009 war sie festes Ensemblemitglied des Bayerischen Staatsschauspiels, wo sie unter anderem mit den Regisseuren Dieter Dorn, Tina Lanik und Hans-Ulrich Becker arbeitete. Seither ist sie dem Haus regelmäßig als Gast verbunden. Seit 2006 ist sie Dozentin für Rollen- und Szenenarbeit an der Theaterakademie August Everding , seit 2011 arbeitet sie als Schauspieldozentin am Mozarteum in Salzburg.[2] Ulrike Arnold lebt in München und ist mit dem Schweizer Schriftsteller Jonas Lüscher verheiratet.[3] // Autogramm Autograph signiert signed signee /// Standort Wimregal PKis-Box9-U011ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.
-
Original Autogramm Ulrike Arnold // Autogramm Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 20,00
Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 2 verfügbar
In den WarenkorbEchtfoto. Zustand: Sehr gut. Schönes Farbfoto von Ulrike Arnold bildseitig mit weissem Stift signiert mit eigenhändigem Zusatz "Herzlichst" (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Ulrike Arnold (* 1965 in Worms) ist eine deutsche Theaterregisseurin, Schauspielerin und Schauspieldozentin. Ulrike Arnold wuchs in München auf und wurde an der Theaterakademie Ulm zur Schauspielerin ausgebildet. Engagements als Schauspielerin führten sie an die Bayerische Staatsoper, die Münchner Kammerspiele, das Teamtheater München, das Theater am Sozialamt TamS, das Metropoltheater München und an das Düsseldorfer Schauspielhaus. Von 2002 bis 2009 war sie festes Ensemblemitglied des Bayerischen Staatsschauspiels, wo sie unter anderem mit den Regisseuren Dieter Dorn, Tina Lanik und Hans-Ulrich Becker arbeitete. Seither ist sie dem Haus regelmäßig als Gast verbunden. Seit 2006 ist sie Dozentin für Rollen- und Szenenarbeit an der Theaterakademie August Everding , seit 2011 arbeitet sie als Schauspieldozentin am Mozarteum in Salzburg.[2] Ulrike Arnold lebt in München und ist mit dem Schweizer Schriftsteller Jonas Lüscher verheiratet.[3] // Autogramm Autograph signiert signed signee /// Standort Wimregal PKis-Box7-U034ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.
-
Original Autogramm Willi Weyer (1917-1987) Minister Sportfunktionär /// Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 22,00
Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbBlatt. Zustand: Gut. Alte Notizbuchseite A6 von Willi Weyer bildseitig mit schwarzem Stift signiert mit eigenhändigem Zusatz "20.05.77" /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Willi Weyer (* 16. Februar 1917 in Hagen; ? 25. August 1987 auf Juist) war ein deutscher Politiker (FDP) und ein Sportfunktionär. Er war in Nordrhein-Westfalen von 1954 bis 1956 Minister für Wiederaufbau, von 1956 bis 1958 Finanzminister, von 1962 bis 1975 Innenminister sowie von 1956 bis 1958 und von 1962 bis 1975 Stellvertreter des Ministerpräsidenten. Von 1956 bis 1972 war er Landesvorsitzender der FDP Nordrhein-Westfalen. Nach seiner politischen Karriere war Weyer von 1974 bis 1986 Präsident des Deutschen Sportbundes. Nach dem Abitur absolvierte Weyer in Bonn, Jena und München ein Studium der Rechtswissenschaft, welches er nach dem Referendariat in Hagen 1940 mit beiden juristischen Staatsexamina beendete. Bis 1942 war er Assistent an der nationalsozialistischen Akademie für Deutsches Recht unter Hans Frank, danach bis 1945 im Kriegseinsatz, zuletzt als Unteroffizier der Flak.[1] Bis zu seinem Tod war Weyer auch Aufsichtsratsvorsitzender der Bavaria Film GmbH. Familie Schon Weyers Großvater und Vater, der Anwalt Wilhelm Weyer, hatten sich im liberalen Sinne engagiert: Der Großvater als Freisinniger und Anhänger von Eugen Richter, der Vater Wilhelm war während der Weimarer Republik für die DDP Mitglied der Stadtvertretung in Hagen. Weyer war verheiratet und hatte drei Kinder. Parteitätigkeiten Olympische Spiele München 1972: Weyer (rechts) mit Bundesinnenminister Genscher Weyer beantragte am 18. Oktober 1937 die Aufnahme in die NSDAP und wurde rückwirkend zum 1. Mai desselben Jahres aufgenommen (Mitgliedsnummer 4.971.711).[2] Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges trat er der FDP bei und engagierte sich bei den Jungdemokraten, deren Landesvorsitz er schon 1946 übernahm. 1950 wurde er stellvertretender Landesvorsitzender der nordrhein-westfälischen FDP, von 1956 bis 1972 stand er an der Spitze des Landesverbandes. Anfang 1956 gehörte Weyer zusammen mit Wolfgang Döring und Walter Scheel zu den sogenannten Jungtürken, die den Koalitionswechsel der FDP in Nordrhein-Westfalen von der CDU zur SPD einleiteten und damit die Abspaltung der Euler-Gruppe und die Gründung der kurzlebigen Freien Volkspartei (FVP) provozierten. Von 1963 bis 1967 war Weyer stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP und von 1954 bis 1972 Mitglied im FDP-Bundesvorstand. Abgeordneter Weyer war von 1950 bis 1975 Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen.[3] Von 1953 bis zum 17. September 1954 gehörte Weyer außerdem dem Deutschen Bundestag an. Öffentliche Ämter Empfang des belgischen Königspaares im Düsseldorfer Schloss Benrath 1971. Weyer schüttelt König Baudouin die Hand, links daneben Königin Fabiola, rechts Ministerpräsident Heinz Kühn Weyer wurde am 27. Juli 1954 als Minister für Wiederaufbau in die von Ministerpräsident Karl Arnold (CDU) geleitete Landesregierung von Nordrhein-Westfalen berufen. Nachdem über ein konstruktives Misstrauensvotum Fritz Steinhoff (SPD) mit den Stimmen der FDP-Abgeordneten zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden war, wurde Weyer am 28. Februar 1956 zum Finanzminister und Stellvertreter des Ministerpräsidenten ernannt. Als die CDU bei der darauf folgenden Landtagswahl 1958 die absolute Mehrheit erringen konnte, schied Weyer am 24. Juli 1958 aus der Landesregierung aus. In seiner Funktion als Finanzminister verbot er den nordrhein-westfälischen Finanzämtern, Berliner Forderungen aus Entnazifizierungsverfahren einzutreiben.[4] Diese Maßnahme schützte politisch belastete Personen der NS-Zeit vor der Vollstreckung von Geldstrafen, die die unter alliierter Aufsicht deutlich strenger agierenden West-Berliner Spruchkammerverfahren im Zuge der Entnazifizierung verhängten. Nach der Landtagswahl 1962 kam es unter dem Ministerpräsidenten Franz Meyers erneut zu einer Koalition aus CDU und FDP und Weyer wurde am 26. Juli 1962 zum Innenminister und Stellvertreter des Ministerpräsidenten ernannt. Innenministerkonferenz der Länder in Bonn, 1973. Weyer links neben dem Vorsitzenden Heinz Schwarz (Rheinland-Pfalz) Zum 1. Dezember 1966 entließ Meyers die beiden FDP-Minister Weyer und Gerhard Kienbaum, um mit der SPD Verhandlungen über eine Große Koalition nach Bonner Vorbild zu führen. Die SPD ging stattdessen jedoch mit der FDP eine Koalition ein und wählte am 8. Dezember 1966 Heinz Kühn zum Ministerpräsidenten. Weyer wurde daher schon am 8. Dezember 1966 erneut zum Innenminister und Stellvertreter des Ministerpräsidenten ernannt. Nach der Landtagswahl 1975 schied Weyer am 4. Juni 1975 endgültig aus der Landesregierung aus. In seiner Zeit als Innenminister setzte Weyer die erstmalige Aufnahme von Verkehrsnachrichten in das Rundfunkprogramm des WDR durch und richtete die ersten Wachen der Autobahnpolizei ein. Sport Von 1957 bis zu seinem Tode war Weyer Präsident des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen. 1972 war er Mitglied des Organisationskomitees für die Olympischen Sommerspiele in München. Von 1974 bis 1986 war Weyer Präsident des Deutschen Sportbundes (DSB), nachdem er bereits bei der Präsidentschaftswahl 1970 gegen Wilhelm Kregel den Präsidenten des Deutschen Turner-Bundes unterlegen war. Es gelang ihm, die Zuschussregeln des Bundesministeriums des Innern ändern zu lassen, wodurch die Eigenmittel des DSB für eigene Belange anerkannt wurden. Hiervon profitierte zunächst er selbst (Dienstwagen wie vorher als Minister, persönlicher Referent, eigenes Büro in Hagen etc.), er schaffte so aber für den DSB eine größere Autonomie.[5] Als Sportfunktionär setzte er sich, im Gegensatz zum NOK-Präsidenten Willi Daume, für den Boykott der Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau ein. Ehrungen 1964 bekam Weyer den Dieselring verliehen, der vom Verband der Motorjournalisten e.V. (VdM) an Personen verliehen wird, die sich besondere Verdienste um die ?Hebung der Verkehrssicherheit und die Minderung von Unfallfolgen? erworben haben. 1965 erhielt e.
-
Original Autogramm Willi Weyer (1917-1987) Minister Sportfunktionär /// Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 22,00
Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbEchtfoto. Zustand: Gut. Schwarzweissfoto Farbfoto von Willi Weyer bildseitig mit blauem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Willi Weyer (* 16. Februar 1917 in Hagen; 25. August 1987 auf Juist) war ein deutscher Politiker (FDP) und ein Sportfunktionär. Er war in Nordrhein-Westfalen von 1954 bis 1956 Minister für Wiederaufbau, von 1956 bis 1958 Finanzminister, von 1962 bis 1975 Innenminister sowie von 1956 bis 1958 und von 1962 bis 1975 Stellvertreter des Ministerpräsidenten. Von 1956 bis 1972 war er Landesvorsitzender der FDP Nordrhein-Westfalen. Nach seiner politischen Karriere war Weyer von 1974 bis 1986 Präsident des Deutschen Sportbundes. Nach dem Abitur absolvierte Weyer in Bonn, Jena und München ein Studium der Rechtswissenschaft, welches er nach dem Referendariat in Hagen 1940 mit beiden juristischen Staatsexamina beendete. Bis 1942 war er Assistent an der nationalsozialistischen Akademie für Deutsches Recht unter Hans Frank, danach bis 1945 im Kriegseinsatz, zuletzt als Unteroffizier der Flak.[1] Bis zu seinem Tod war Weyer auch Aufsichtsratsvorsitzender der Bavaria Film GmbH. Familie Schon Weyers Großvater und Vater, der Anwalt Wilhelm Weyer, hatten sich im liberalen Sinne engagiert: Der Großvater als Freisinniger und Anhänger von Eugen Richter, der Vater Wilhelm war während der Weimarer Republik für die DDP Mitglied der Stadtvertretung in Hagen. Weyer war verheiratet und hatte drei Kinder. Parteitätigkeiten Olympische Spiele München 1972: Weyer (rechts) mit Bundesinnenminister Genscher Weyer beantragte am 18. Oktober 1937 die Aufnahme in die NSDAP und wurde rückwirkend zum 1. Mai desselben Jahres aufgenommen (Mitgliedsnummer 4.971.711).[2] Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges trat er der FDP bei und engagierte sich bei den Jungdemokraten, deren Landesvorsitz er schon 1946 übernahm. 1950 wurde er stellvertretender Landesvorsitzender der nordrhein-westfälischen FDP, von 1956 bis 1972 stand er an der Spitze des Landesverbandes. Anfang 1956 gehörte Weyer zusammen mit Wolfgang Döring und Walter Scheel zu den sogenannten Jungtürken, die den Koalitionswechsel der FDP in Nordrhein-Westfalen von der CDU zur SPD einleiteten und damit die Abspaltung der Euler-Gruppe und die Gründung der kurzlebigen Freien Volkspartei (FVP) provozierten. Von 1963 bis 1967 war Weyer stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP und von 1954 bis 1972 Mitglied im FDP-Bundesvorstand. Abgeordneter Weyer war von 1950 bis 1975 Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen.[3] Von 1953 bis zum 17. September 1954 gehörte Weyer außerdem dem Deutschen Bundestag an. Öffentliche Ämter Empfang des belgischen Königspaares im Düsseldorfer Schloss Benrath 1971. Weyer schüttelt König Baudouin die Hand, links daneben Königin Fabiola, rechts Ministerpräsident Heinz Kühn Weyer wurde am 27. Juli 1954 als Minister für Wiederaufbau in die von Ministerpräsident Karl Arnold (CDU) geleitete Landesregierung von Nordrhein-Westfalen berufen. Nachdem über ein konstruktives Misstrauensvotum Fritz Steinhoff (SPD) mit den Stimmen der FDP-Abgeordneten zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden war, wurde Weyer am 28. Februar 1956 zum Finanzminister und Stellvertreter des Ministerpräsidenten ernannt. Als die CDU bei der darauf folgenden Landtagswahl 1958 die absolute Mehrheit erringen konnte, schied Weyer am 24. Juli 1958 aus der Landesregierung aus. In seiner Funktion als Finanzminister verbot er den nordrhein-westfälischen Finanzämtern, Berliner Forderungen aus Entnazifizierungsverfahren einzutreiben.[4] Diese Maßnahme schützte politisch belastete Personen der NS-Zeit vor der Vollstreckung von Geldstrafen, die die unter alliierter Aufsicht deutlich strenger agierenden West-Berliner Spruchkammerverfahren im Zuge der Entnazifizierung verhängten. Nach der Landtagswahl 1962 kam es unter dem Ministerpräsidenten Franz Meyers erneut zu einer Koalition aus CDU und FDP und Weyer wurde am 26. Juli 1962 zum Innenminister und Stellvertreter des Ministerpräsidenten ernannt. Innenministerkonferenz der Länder in Bonn, 1973. Weyer links neben dem Vorsitzenden Heinz Schwarz (Rheinland-Pfalz) Zum 1. Dezember 1966 entließ Meyers die beiden FDP-Minister Weyer und Gerhard Kienbaum, um mit der SPD Verhandlungen über eine Große Koalition nach Bonner Vorbild zu führen. Die SPD ging stattdessen jedoch mit der FDP eine Koalition ein und wählte am 8. Dezember 1966 Heinz Kühn zum Ministerpräsidenten. Weyer wurde daher schon am 8. Dezember 1966 erneut zum Innenminister und Stellvertreter des Ministerpräsidenten ernannt. Nach der Landtagswahl 1975 schied Weyer am 4. Juni 1975 endgültig aus der Landesregierung aus. In seiner Zeit als Innenminister setzte Weyer die erstmalige Aufnahme von Verkehrsnachrichten in das Rundfunkprogramm des WDR durch und richtete die ersten Wachen der Autobahnpolizei ein. Sport Von 1957 bis zu seinem Tode war Weyer Präsident des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen. 1972 war er Mitglied des Organisationskomitees für die Olympischen Sommerspiele in München. Von 1974 bis 1986 war Weyer Präsident des Deutschen Sportbundes (DSB), nachdem er bereits bei der Präsidentschaftswahl 1970 gegen Wilhelm Kregel den Präsidenten des Deutschen Turner-Bundes unterlegen war. Es gelang ihm, die Zuschussregeln des Bundesministeriums des Innern ändern zu lassen, wodurch die Eigenmittel des DSB für eigene Belange anerkannt wurden. Hiervon profitierte zunächst er selbst (Dienstwagen wie vorher als Minister, persönlicher Referent, eigenes Büro in Hagen etc.), er schaffte so aber für den DSB eine größere Autonomie.[5] Als Sportfunktionär setzte er sich, im Gegensatz zum NOK-Präsidenten Willi Daume, für den Boykott der Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau ein. Ehrungen 1964 bekam Weyer den Dieselring verliehen, der vom Verband der Motorjournalisten e.V. (VdM) an Personen verliehen wird, die sich besondere Verdienste um die Hebung der Verkehrssicherheit und die Minderung von Unfallfolgen" erworben haben. 1965 erhielt er die Wolfgang-Döring-Medaille der F.
-
2 eigenh. Briefe mit U.
Verlag: Baden und Wien, 27. X. und 24. XI. 1910., 1910
Anbieter: Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH, Vienna, A, Österreich
Manuskript / Papierantiquität
EUR 90,00
Währung umrechnenEUR 30,00 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbZusammen 4½ SS. 8vo. An den Wiener Kulturstadtrat Hans Arnold Schwer (1856-1931): "Nachdem Sie mir bis heute mein Ihnen für den Schöffelprozeß geliehenes Material nicht zurückgesendet haben und mein wiederholtes Ansuchen um die Rückstellung desselben unbeantwortet ließen, erlaube ich mir noch einmal Sie zu ersuchen das Material, dessen Verzeichnis ich Ihnen mit dem letzten Ersuchschreiben bekannt gegeben habe bis längstens zum 1. Dezember d. Jahres an Herrn Georg Dabner [.] zu übersenden [.]" (Br. v. 24. XI. 1910). - Vgl. Thieme/B. XXIV, 29. - Im linken Rand gelocht. - In altem Sammlungsumschlag.
-
Original Autogramm Christian Thielemann /// Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 50,00
Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. A5 Postkarte, etwas größer, von Christian Thielemann bildseitig mit schwarzem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Christian Thielemann (* 1. April 1959 in West-Berlin) ist ein deutscher Dirigent. Seit September 2024 ist er Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden in Berlin. Von 2012 bis 2024 war er Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden.[1] Thielemann war von 2013 bis 2022 künstlerischer Leiter der Osterfestspiele Salzburg[2] und von 2015 bis 2020 Musikdirektor der Bayreuther Festspiele.[3] Dort hat er in den Jahren von 2000 bis 2022 alle zehn Werke von Richard Wagner, die bei den Festspielen aufgeführt werden, dirigiert,[4] was vor ihm nur Felix Mottl gelang. Er gastiert regelmäßig bei den Wiener Philharmonikern und den Berliner Philharmonikern. Im Jahr 2020 wurde Thielemann zum Honorarprofessor der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber in Dresden ernannt.[5] Er dirigierte 2019 das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker sowie erneut 2024. Christian Thielemann wurde als einziges Kind von Hans und Sybille Thielemann in Berlin-Wilmersdorf geboren und wuchs in Berlin-Schlachtensee auf. Der Vater war Geschäftsführer der Berliner Vertretung der Otto Wolff AG, eines westdeutschen Eisenhandelsunternehmens; seine Mutter, aus einer pommerschen Offiziersfamilie stammend, war Apothekerin.[6][7] Thielemanns Großvater Georg Thielemann war vor dem Ersten Weltkrieg als Konditormeister von Leipzig nach Berlin gekommen und arbeitete während des Krieges als Kulissenschieber in der Hofoper Unter den Linden.[8] Thielemann nahm mit fünf Jahren Klavierunterricht und studierte Bratsche.[9] Seine Karriere begann er mit neunzehn Jahren als Korrepetitor an der Deutschen Oper Berlin und gleichzeitig als Assistent von Herbert von Karajan in Berlin. 1985 wurde er Erster Kapellmeister an der Düsseldorfer Rheinoper und wechselte 1988 als Generalmusikdirektor (GMD) ans Staatstheater Nürnberg. Dort gelang dem damals jüngsten GMD Deutschlands mit einer Aufführung des Tristan und Isolde der künstlerische Durchbruch. 1997 erhielt er einen Ruf an die Deutsche Oper Berlin. Seinen dortigen Vertrag als Generalmusikdirektor kündigte er im Sommer 2004. Im September 2004 wurde er Generalmusikdirektor der Münchner Philharmoniker. Im Jahr 2012 wechselte er als Chefdirigent zur Sächsischen Staatskapelle Dresden.[10] International war Thielemann besonders am Anfang seiner Karriere oft in Italien tätig, beispielsweise wurde er 1993 erster Gastdirigent am Teatro Comunale di Bologna. 1987 debütierte er mit Wolfgang Amadeus Mozarts Così fan tutte an der Wiener Staatsoper. Am Londoner Opernhaus Covent Garden dirigierte er Jenufa, Elektra, Der Rosenkavalier, Die ägyptische Helena sowie Hans Pfitzners Palestrina - eine Produktion, die er anschließend auch im Rahmen des ersten Gastspiels von Covent Garden an der New Yorker Met leitete. An der Met dirigierte er Der Rosenkavalier, Die Frau ohne Schatten und Arabella, an der Lyric Opera of Chicago eine Neuproduktion von Die Meistersinger von Nürnberg. Thielemann konzentrierte sich zuletzt auf ausgewählte Orchester und wenige Opernhäuser. Nicht zuletzt aufgrund zahlreicher erfolgreicher Aufführungen der Werke Richard Wagners sowie seines Richard-Strauss-Repertoires gilt Thielemann als ein gefragter Dirigent. In der Opernliteratur reicht seine Bandbreite bis zu Arnold Schönbergs Moses und Aron und Hans Werner Henzes Der Prinz von Homburg. Bei den Bayreuther Festspielen debütierte Thielemann im Jahr 2000 mit Wagners Die Meistersinger von Nürnberg. 2001 dirigierte er Parsifal, 2002 eine Neuproduktion des Tannhäuser. Von 2006 bis 2010 leitete er den Bayreuther Ring (Regie Tankred Dorst), und 2012 dirigierte er den Fliegenden Holländer. 2015 übernahm er in Bayreuth die musikalische Leitung für Tristan und Isolde[11] und ab 2018 Lohengrin.[12] Am 29. Juni 2015 wurde bekannt, dass Thielemann bereits am 15. März 2015 und mit Wirkung bis zum Jahre 2020 zum Musikdirektor der Bayreuther Festspiele berufen wurde, eine Position, die es bislang noch nicht gegeben hatte.[13] Bereits zuvor war Thielemann nach dem Tod des langjährigen Festspielleiters Wolfgang Wagner musikalischer Berater der Festspielleitung. Im Jahr 2020 lief sein Vertrag als Musikdirektor aus.[14] Thielemann dirigierte das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2019[15] und 2024. Am 10. Mai 2021 gab die Sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus Barbara Klepsch bekannt, dass der Vertrag mit Christian Thielemann als Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle zum Ende der Spielzeit 2023/24 ausläuft und nicht verlängert wird.[16] Am 27. September 2023 wurde bei einer Pressekonferenz der Staatsoper Unter den Linden bekanntgegeben, dass er ab der Spielzeit 2024/25 den Posten als Generalmusikdirektor erhalten und die Nachfolge von Daniel Barenboim antreten wird. Thielemann lebt in Potsdam-Babelsberg.[17] Rezeption durch die Musikkritik Nach Aussage von Peter Jungblut gilt er als ?genialer Wagner-Dirigent? Er stehe ?auch im Ruf, besonders selbstbewusst und schwierig im Umgang zu sein? Im Laufe seiner Karriere sei er mehrfach aus Opernhäusern ?im Unfrieden? ausgeschieden.[18][19] /// Standort Wimregal Ill-Umschl2025-165 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.
-
Original Autogramm Christian Thielemann /// Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 50,00
Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Christian Thielemann bildseitig mit silbernem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Christian Thielemann (* 1. April 1959 in West-Berlin) ist ein deutscher Dirigent. Seit September 2024 ist er Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden in Berlin. Von 2012 bis 2024 war er Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden.[1] Thielemann war von 2013 bis 2022 künstlerischer Leiter der Osterfestspiele Salzburg[2] und von 2015 bis 2020 Musikdirektor der Bayreuther Festspiele.[3] Dort hat er in den Jahren von 2000 bis 2022 alle zehn Werke von Richard Wagner, die bei den Festspielen aufgeführt werden, dirigiert,[4] was vor ihm nur Felix Mottl gelang. Er gastiert regelmäßig bei den Wiener Philharmonikern und den Berliner Philharmonikern. Im Jahr 2020 wurde Thielemann zum Honorarprofessor der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber in Dresden ernannt.[5] Er dirigierte 2019 das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker sowie erneut 2024. Christian Thielemann wurde als einziges Kind von Hans und Sybille Thielemann in Berlin-Wilmersdorf geboren und wuchs in Berlin-Schlachtensee auf. Der Vater war Geschäftsführer der Berliner Vertretung der Otto Wolff AG, eines westdeutschen Eisenhandelsunternehmens; seine Mutter, aus einer pommerschen Offiziersfamilie stammend, war Apothekerin.[6][7] Thielemanns Großvater Georg Thielemann war vor dem Ersten Weltkrieg als Konditormeister von Leipzig nach Berlin gekommen und arbeitete während des Krieges als Kulissenschieber in der Hofoper Unter den Linden.[8] Thielemann nahm mit fünf Jahren Klavierunterricht und studierte Bratsche.[9] Seine Karriere begann er mit neunzehn Jahren als Korrepetitor an der Deutschen Oper Berlin und gleichzeitig als Assistent von Herbert von Karajan in Berlin. 1985 wurde er Erster Kapellmeister an der Düsseldorfer Rheinoper und wechselte 1988 als Generalmusikdirektor (GMD) ans Staatstheater Nürnberg. Dort gelang dem damals jüngsten GMD Deutschlands mit einer Aufführung des Tristan und Isolde der künstlerische Durchbruch. 1997 erhielt er einen Ruf an die Deutsche Oper Berlin. Seinen dortigen Vertrag als Generalmusikdirektor kündigte er im Sommer 2004. Im September 2004 wurde er Generalmusikdirektor der Münchner Philharmoniker. Im Jahr 2012 wechselte er als Chefdirigent zur Sächsischen Staatskapelle Dresden.[10] International war Thielemann besonders am Anfang seiner Karriere oft in Italien tätig, beispielsweise wurde er 1993 erster Gastdirigent am Teatro Comunale di Bologna. 1987 debütierte er mit Wolfgang Amadeus Mozarts Così fan tutte an der Wiener Staatsoper. Am Londoner Opernhaus Covent Garden dirigierte er Jenufa, Elektra, Der Rosenkavalier, Die ägyptische Helena sowie Hans Pfitzners Palestrina - eine Produktion, die er anschließend auch im Rahmen des ersten Gastspiels von Covent Garden an der New Yorker Met leitete. An der Met dirigierte er Der Rosenkavalier, Die Frau ohne Schatten und Arabella, an der Lyric Opera of Chicago eine Neuproduktion von Die Meistersinger von Nürnberg. Thielemann konzentrierte sich zuletzt auf ausgewählte Orchester und wenige Opernhäuser. Nicht zuletzt aufgrund zahlreicher erfolgreicher Aufführungen der Werke Richard Wagners sowie seines Richard-Strauss-Repertoires gilt Thielemann als ein gefragter Dirigent. In der Opernliteratur reicht seine Bandbreite bis zu Arnold Schönbergs Moses und Aron und Hans Werner Henzes Der Prinz von Homburg. Bei den Bayreuther Festspielen debütierte Thielemann im Jahr 2000 mit Wagners Die Meistersinger von Nürnberg. 2001 dirigierte er Parsifal, 2002 eine Neuproduktion des Tannhäuser. Von 2006 bis 2010 leitete er den Bayreuther Ring (Regie Tankred Dorst), und 2012 dirigierte er den Fliegenden Holländer. 2015 übernahm er in Bayreuth die musikalische Leitung für Tristan und Isolde[11] und ab 2018 Lohengrin.[12] Am 29. Juni 2015 wurde bekannt, dass Thielemann bereits am 15. März 2015 und mit Wirkung bis zum Jahre 2020 zum Musikdirektor der Bayreuther Festspiele berufen wurde, eine Position, die es bislang noch nicht gegeben hatte.[13] Bereits zuvor war Thielemann nach dem Tod des langjährigen Festspielleiters Wolfgang Wagner musikalischer Berater der Festspielleitung. Im Jahr 2020 lief sein Vertrag als Musikdirektor aus.[14] Thielemann dirigierte das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2019[15] und 2024. Am 10. Mai 2021 gab die Sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus Barbara Klepsch bekannt, dass der Vertrag mit Christian Thielemann als Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle zum Ende der Spielzeit 2023/24 ausläuft und nicht verlängert wird.[16] Am 27. September 2023 wurde bei einer Pressekonferenz der Staatsoper Unter den Linden bekanntgegeben, dass er ab der Spielzeit 2024/25 den Posten als Generalmusikdirektor erhalten und die Nachfolge von Daniel Barenboim antreten wird. Thielemann lebt in Potsdam-Babelsberg.[17] Rezeption durch die Musikkritik Nach Aussage von Peter Jungblut gilt er als ?genialer Wagner-Dirigent? Er stehe ?auch im Ruf, besonders selbstbewusst und schwierig im Umgang zu sein? Im Laufe seiner Karriere sei er mehrfach aus Opernhäusern ?im Unfrieden? ausgeschieden.[18][19] /// Standort Wimregal GAD-10.217 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.
-
3 (1 ms., 1 hs. und 1 eh.) Briefe mit eigenh. U.
Verlag: Wien, 1895-1896., 1896
Anbieter: Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH, Vienna, A, Österreich
Manuskript / Papierantiquität
EUR 120,00
Währung umrechnenEUR 30,00 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbZusammen 3 SS. 4to und qu.-8vo. Mit einem eh. adr. Kuvert. Ersucht die Redaktion von Hans Arnold Schwers (1856-1931) Zeitschrift um Nachsicht ob des Versäumnisses, "Ihnen zur Premiere der 'Karlsschülerin' die üblichen Referenten-Sitze zuzuschicken" (Br. v. 24. III. 1895) bzw. teilt mit, daß Sie "in Folge meiner Abwesenheit von Wien erst heute [davon erfahren hat], daß die Commune Wien selbst für die Beerdigung der Frau [Ludmilla] Dietz [geb. 1836] Sorge getragen [habe]" (Br. vom 20. VI. 1896). - Beide Br. auf Briefpapier mit gedr. Briefkopf des "K. K. Priv. Theater a. d. Wien". - Seit 1884 Inhaberin des Theaters an der Wien, verpachtete sie das Haus bis 1889 an den Librettisten Camillo Walzel (1829-1895) und führte es anschließend selbst weiter; unter ihrer Leitung wurde es zur führenden Wiener Operettenbühne, an der u. a. Werke von Johann Strauß Sohn ("Der Zigeunerbaron", 1885), Carl Millöcker ("Der arme Jonathan", 1890) und Karl Zeller ("Der Vogelhändler", 1891) uraufgeführt wurden. Vgl. Hadamowsky, Wien. Theatergeschichte, 1994, 619ff. sowie DBA I 1131, 73-76. - In altem Sammlungsumschlag.
-
4 eigenh. Briefe mit U.
Verlag: Wien, 1907., 1907
Anbieter: Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH, Vienna, A, Österreich
Manuskript / Papierantiquität
EUR 150,00
Währung umrechnenEUR 30,00 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbZusammen 9 SS. auf Doppelblättern. 8vo. An den Wiener Kulturstadtrat Hans Arnold Schwer (1856-1931): "Wenn Sie, worum ich Sie herzlich bitte, hochverehrter Herr Stadtrat, in den nächsten Tagen meine Sache vor dem Stadtrat vertreten, bitte ich Sie, auch dies gefälligst in Betracht ziehen zu wollen, daß ich der Bewilligung eines Restaurants durchaus keinen prinzipiellen Wert beilege. Als ich auch um Bewilligung des Restaurants nachsuchte, ging ich nicht zuletzt von der Erwägung aus, daß darin selbstverständlich das Bier aus dem Wiener Bräuhaus verschänkt wurde, und zwar in denkbar bester Form verschänkt würde, daß dadurch das Bier [.] in den besten Kreisen eingeführt und populärer gemacht würde, und daß deshalb die Comune selbst ein Interesse daran habe, mit dem vornehmen Theater ein vornehmes Restaurant zu verbinden [.]" (Br. v. 25. IX. 1907). - Karl Wiene war der Vater des Filmregisseurs Robert Wiene (1873-1938), der durch sein "Cabinet des Dr. Caligari" Unsterblichkeit erlangt hat. - Drei Briefe im linken Rand gelocht (keine bzw. geringfügige Textberührung). In altem Sammlungsumschlag.
-
10 eigenh. Briefe, 2 eh. Briefkarten sowie 3 gedr. Visitkarten mit jeweils mehreren eh. Zeilen und U.
Verlag: Wien, 1910-1918., 1918
Anbieter: Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH, Vienna, A, Österreich
Manuskript / Papierantiquität
EUR 180,00
Währung umrechnenEUR 30,00 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbZusammen 27½ SS. 8vo. Mit 2 eh. Adr. Kuverts. Lädt den Wiener Kulturstadtrat Hans Arnold Schwer (1856-1931) u. a. ein zur "commissionellen Besichtigung meines nun beendeten Dr. Carl Lueger Monumentalreliefs, wenn dies nicht schon von seiten der Bauleitung geschehen sein sollte" (Br. v. 11. VII. 1910), korrespondiert wegen zukünftigen Aufträgen für Bildnisse und dankt für eine an ihn ergangene Spende: "Das Schicksal hat mir, wie Herr Stadtrat gehört haben werden, nachdem ich endlich glücklich von meiner schweren Operation im Februar l. J. hergestellt war, wieder furchtbar mitgespielt. Ich bin seelisch und körperlich gebrochen. Gott gebe, daß die Zuversicht des Herrn Ober-Bezirksarztes Dr. Dostal mich wieder vollständig mit seinem neuen Heilmittel, das große Erfolge gezeitig[t] haben soll, sich tatsächlich erfüllen wird [.]" (Br. v. 11. V. 1918). - In Wörth bei Gloggnitz (Niederösterreich) geboren, studierte Swoboda seit 1868 an der Akademie der bildenden Künste in Wien, wurde 1872 ein Schüler von Kaspar Clemens von Zumbusch (1830-1915) und erhielt den Rom-Preis. "Er arbeitete im Atelier Zumbuschs am Beethoven- und am Maria-Theresien-Denkmal mit und schuf u. a. das Bramantedenkmal, das Rokitanskydenkmal für den Arkadenhof der Univ. Wien, außerdem Skulpturen für das Kunsthistorische Museum, die Akademie der bildenden Künste, das Parlament und die Neue Hofburg" (DBE). Vgl. Thieme/B. XXXII, 356. - In altem Sammlungsumschlag.
-
6 eigenh. Briefe, 4 eh. (Bild-)Postkarten mit U. sowie 1 Kabinettphotographie mit eh. Widmung, Datum und U. auf der Bildseite.
Verlag: Wien und New York, 1890-98., 1890
Anbieter: Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH, Vienna, A, Österreich
Manuskript / Papierantiquität
EUR 250,00
Währung umrechnenEUR 30,00 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbZusammen 15½ SS. 8vo. bzw. 16,6:10,4 cm. Mit 1 eh. Kuvert. An den Wiener Journalisten und späteren Kulturstadtrat Hans Arnold Schwer (1856-1931): "Vorerst drängt es mich, Dir zu Deiner Verlobung aus aufrichtigem Herzen zu gratulieren! [.] Was mich betrifft, so kann ich Dir nur sagen, daß ich mich sehr wohl fühle, denn vor Allem habe ich hier eine sehr schöne Stellung und hält Dir. Conried [?] sehr viel auf mich. Jedenfalls ist das Irving-Place-Theater ein vornehmes Kunstinstitut, was man vom Josefstädter Theater nicht behaupten kann!! Jetzt erst fühle ich so recht den Unterschied und bin glücklich aus diesem Vaudeville-Theater fort zu sein [.]" (Br. v. 13. XI. 1897). - Die Photographie (Brustbild, nach links gewandt, mit vierseitigem Goldschnitt [etw. beschabt], dat. 28. IX. 1895) stammt aus dem Hause des k. u. k. Hofphotographen Fritz Luckhardt, Wien. - 3 Br. auf Briefpapier mit gedr. Briefkopf. - Beiliegend eine gedr. Visitkarte des Malers und Dekorationsinspektors des Hofburgtheaters Gilbert Lehner (geb. 1844; vgl. Thieme/B. XXII, 585). - In altem Sammlungsumschlag.
-
Stammbuch der Gräfin Maja Gallenberg mit 110 Eintragungen von namhaften Künstlern der Zeit, darunter Enrico Caruso, Richard Strauss und Gustav Meyrink.
Verlag: Meist Wien, 1886-1918., 1918
Anbieter: Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH, Vienna, A, Österreich
Manuskript / Papierantiquität
EUR 2.500,00
Währung umrechnenEUR 30,00 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den Warenkorb93 num. Bll. (recte: 79). Lederband der Zeit mit umlaufendem Goldschnitt. 8vo. Das über drei Jahrzehnte hinweg geführte Stammbuch von Maja Gallenberg, der Enkelin des Komponisten Wenzel Robert Graf Gallenberg ("Musikgraf") und Julia "Giuletta" Gräfin Giucciardi, die mit Beethoven in enger Beziehung stand, der ihr seine "Mondschein-Sonate" widmete. Die Eintragungen stammen (in alphabetischer Reihe) mehrheitlich von Schauspielern, Sängern, Musikern und Intendaten, darunter John Quincy Adams, Josef Altmann, Friedrich Ludwig Arnsburg, Alice Barbi, Agathe Barsescu, Bernhard Baumeister, Josef Freiherr von Bezecny, Dr. (Generalintendant des Hoftheaters), Hedwig Bleibtreu, Ferdinand Bonn, Hermine Braga, Karl Bukovics von Kiss Alacska, Max Burckhard, Aloys Burgstaller, Willy Burmester, Enrico Caruso, Max Devrient, Babette Devrient-Reinhold, Andreas Dippel, Ella Forster, Zerline Gabillon (2), Oskar Gimnig, Alfred Grünfeld (Notenzitat), Ellen Gulbranson, Hugo von Habermann, August Hablawetz, Konrad Hallenstein, Ernst Hartmann, Helene Hartmann, Josef Hellmesberger sen., Oskar Hofmeister, Stella Hohenfels, Willibald Horwitz, Elisabeth (Klein-)Hruby, Robert Hübner, Marcel Journet, August Junkermann, Alma Kallina, Louise Kaulich-Lazarich, Ferdinand Kracher, Emilie von (Jauner-)Krall, Josefine Kramer-Glöckner, Fritz Krastel, Felix von Kraus, Anna Kratz, Viktor Kutschera, Marie Lehmann, Josef Lewinsky, Ida Baier-Liebhardt, Konrad Loewe, Pauline Lucca, Amalie (Friedrich-)Materna, Friedrich Mitterwurzer, Wilhelmine Mitterwurzer, Georg Müller, Rosa Paumgartner-Papier, Franceschina Prevosti, Theodor Reichmann, Georg Reimers, Hella Rentsch-Sauer, Emmerich Robert, Louisabeth Roeckel, Arnold Rosé, Adele Sandrock, Wilhelmine Sandrock, Anton Schittenheim, Antonie Schläger, Louise Schönfeld, Katharina Schratt, Fritz Schrödter, Adolf v. Sonnenthal, Philipp Stätter, Maria Strassmann, Richard Strauss, Guilhermina Suggia, Hugo Thimig, Hans Thoma, Rudolf Tyrolt, Ernest Van Dyck, Siegfried Wagner, Fanny Walbeck, Josephine Wessely, Hermann Winkelmann, Eugen Witte, Charlotte Wolter und Carl von Zeska. - Ferner unterzeichnen die Mitglieder des Flonzaley Quartetts - Adolfo Betti, Alfred Pochon, Ugo Ara und Iwan d'Archambeau -, der deutsche Politiker und Bankier Bernhard Dernburg (1865-1937), der Schriftsteller Gustav Meyrink (mit dem Schlussteil seiner Erzählung "Der heiße Soldat", die den Grundstein für Meyrinks literarische Laufbahn legte), die Schriftstellerin Edith Gräfin Salburg ("Schlage die Trommel und fürchte Dich nicht") und der Schriftsteller Raoul Auernheimer. - Die SS. 25, 27, 30, 33, 34, 39, 45, 49, 50, 51, 53, 61, 70 und 73 alt entfernt, S. 85 lose; Buchblock gelockert, eine kleine Fehlstelle am Rücken, Vordergelenk etwas angeplatzt, Deckel und Kanten etwas berieben und beschabt.
-
Kunstmaler Hans MATHIS (1882-1944): PK BERLIN 1911, an Rahmenfabrik in München
Verlag: Berlin, 1911
Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert
EUR 90,00
Währung umrechnenEUR 9,95 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Gut. 1. Auflage. Eigenhändige, signierte Postkarte des Kunstmalers der Münchner Schule Hans Mathis (1882-1944). --- Motiv: Berlin, Königsplatz mit Siegessäule und Reichstagsgebäude. --- Poststempel schwer lesbar; wahrscheinlich "BERLIN 12.12.11." --- Mit 5-Pfennig-Germania-Briefmarke (gültig 1900-1922). --- Gerichtet an die "Herrn Eder & Reicheneder, Rahmenfabrick, München, Kapuzinerstrasse 42." --- Gemeint ist die Rahmenfabrik Ebner & Reicheneder in München. --- Transkription: "Meine Herrn, sollten die Bilder eingeschlagen sein, so macht dies nichts, ich werde nach meiner Rückreise bei Ihnen vorbeikommen u. dieselben firnissen. Hoffentlich ist der kleine Mann gut mit den Sachen angekommen ohne Unfall. Mit herzlichen Grüssen aus dem kleinen Städtchen hier Ihr Hans Mathis." --- Format: 8,8 x 13,8 cm. --- Zustand: Kräftiges Papier gebräunt, mit kleinen Eckknicken. --- Über Hans Mathis (Quelle: wikipedia): Hans Mathis (geb. 13. Juli 1882 in Straßburg; gest. 23. November 1944 in Niederbronn, Elsaß) war ein deutscher Maler, der aufgrund seiner akademischen Ausbildung der sogenannten Münchner Schule zuzurechnen ist. Zu seinem Hauptwerk zählen Stadt- und Naturlandschaften, Stillleben und Genrebilder, vor allem aber auch Porträts, darunter von bedeutenden Persönlichkeiten der Münchener Gesellschaft. Sein Malstil zeigt sich im Naturalismus und Realismus der Zeit, wobei seine oft breite, lockere Pinselführung dem späten Impressionismus folgt, wie dies bei zeitgleich wirkenden Malern etwa aus dem Künstlerkreis Die Scholle wie Leo Putz, Adolf Münzer, Walter Püttner, aber auch dem älteren Wilhelm Trübner zu sehen ist. Leben: Hans Mathis entstammte einer großbürgerlichen Familie und wuchs mit seinem Bruder und einer Schwester in seiner Geburtsstadt auf. Durch seinen ersten Kunstlehrer Lothar von Seebach angeregt, widmete er sich der brotlosen Kunst wie so oft entgegen dem Willen der Eltern. 23-jährig übersiedelte er 1905 nach dem damals in der Hochblüte der Kunst stehenden München, um hier bis 1927 zu bleiben. Hier studierte er am Polytechnikum bei dem Architekten und Kunstgewerbler Adolf Seder. An der Münchener Akademie wurde er Schüler von Peter von Halm, dessen legendärer Zeichenunterricht nahezu Pflicht war, und dessen Schulung ihn auch später zu einem erfolgreichen Illustrator und Karikaturisten werden ließ. Im Fach der Malerei studierte er bei den Professoren Carl von Marr und Ludwig von Löfftz. Dabei widmete er sich weit mehr der moderneren Auffassung Carl von Marrs. Auch die Freundschaft mit dem Hamburger Adolf Heller (1874-1914), und dessen Stil der Düsseldorfer und Pariser Schulung hatte Wirkung auf Mathis, der sich nunmehr besonders auch dem Porträtfach widmete und zudem seine Eindrücke der Parisreisen von 1901 und später nachwirken lassen konnte. Das Angebot einer Professur an der Münchner Akademie lehnte er jedoch ab, um sich mehr seinen Reisen nach Paris, in die Bretagne, die Provence oder nach Italien widmen zu können. Mathis nahm intensiv am Leben der Münchner Künstlergesellschaften teil. Sein Atelier unterhielt er im Künstlerviertel Schwabing, in der Herzogstraße 51. Als Mitglied der Elf Scharfrichter stand er im Freundeskreis des Simplicissimus , wie Bruno Paul, Olaf Gulbransson oder Karl Arnold, die sich regelmäßig im Alten Simpl in der Türkenstraße trafen. Weitere enge Malerfreunde waren Leo Samberger, Hans Best, Heinrich von Zügel, Angelo Jank, Hugo von Habermann, Charles Vetter, Albert Weisgerber, Paul Paede und P. J. Walch. Als Porträtist schuf er Bildnisse auch bedeutender Persönlichkeiten der Gesellschaft, wie etwa des bekannten Münchner Arztes und Schriftstellers Felix Schlagintweit, der den Maler neben Leo Putz und anderen auch in seiner Biographie verewigt hat. Im Porträt wie im Genre, im Interieurfach oder Stillleben steht die Qualität seiner Werke denen von Putz oder Püttner kaum nach. Signatur des Verfassers.
-
Schriftsteller Hans von WOLZOGEN (1848-1938): Postkarte BAYREUTH 1919
Verlag: Bayreuth, 1919
Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert
EUR 90,00
Währung umrechnenEUR 9,95 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Gut. 1. Auflage. Eigenhändige, signierte Postkarte des Schriftstellers, Redakteurs, Librettisten und Herausgebers der "Bayreuther Blätter" Hans von Wolzogen (1848-1938). --- Nach ihm wurde die Wolzogenstraße in Berlin-Steglitz benannt. --- Datiert Bayreuth, den 15. Januar 1919. --- Gerichtet an eine Verwandte, die Freifrau von Wolzogen und Neuhaus in Berlin-Grunewald, Warmbrunner Straße 38-40. --- Dabei handelt es sich um Erika Emma Auguste Freifrau von Wolzogen und Neuhaus, geb. Begemann, geboren am 7. September 1886 in Altenburg als Tochter des Premierleutnants und späteren Majors z.D. Arnold Begemann und der Margarete, geb. (von) Krüger (* 27. September 1861 in Berlin). Am 6. April 1907 hatte sie in Schwerin den Leutnant im Artillerie-Regiment Nr. 60 und späteren Major Walter August Wilhelm Paul Freiherr von Wolzogen und Neuhaus geheiratet, geboren am 15. März 1877 in Reddentin als Sohn des Oberleutnants Barthold Ludwig Theodor August Freiherr von Wolzogen und Neuhaus (1844-1900) und der Hedwig Marie Karoline, geb. von Below (* 1844). Ein Sohn war Wolff-Dietrich von Wolzogen und Neuhaus (* 5. Juni 1910 in Berlin, gest. 2003 in Frankfurt am Main). --- Im Berliner Adressbuch ist ihr Ehemann als Hauptmann verzeichnet; später lebten sie in Schwerin. --- Auszüge: "Meine liebe Erika, der nahe Geburtstag HansJochens (ich weiß nicht einmal, ob er wieder dauernd zuhause ist?) gibt mir Gelegenheit [.], meine herzl. Grüße zu senden u. zu fragen, wie es Euch in diesen für Berlin so bösen Tagen ergangen ist. [.] um alle Lieben, die doch in der Unruhe u. Gefahr leben müssen. Wir haben es besser [.]. Die Zeit vergeht zum Glück schnell, u. man lebt, indem man sie zerstreut{?}, um möglichst bald eine andere, möglichst bessere, zu erleben, was Gott gebe! Mit herzl. Küssen [.] D. tr. Vetter Hans v. W." --- Zwar nur mit abgekürztem Nachnamen signiert; ein Vergleich der Handschrift mit anderen Autographen von Hans von Wolzogen verweist aber eindeutig auf ihn als Verfasser dieser Karte. --- 10-Pfennig-Ganzsache (8,8 x 14 cm) des Königreichs Bayern. --- Zustand: Karte gebräunt, mit Eckknick. ---Über Hans von Wolzogen (Quelle: wikipedia): Hans Paul Freiherr von Wolzogen (* 13. November 1848 in Potsdam; 2. Juni 1938 in Bayreuth) war ein deutscher Literat, Redakteur, Librettist und Herausgeber. Kindheit: Hans Paul von Wolzogen wurde am 13. November 1848 in Potsdam geboren. Sein Vater, Alfred von Wolzogen, war Hof-Theaterintendant in Schwerin; seine Mutter war eine Tochter des berühmten Baumeisters Karl Friedrich Schinkel. Sie starb, als ihr Sohn zwei Jahre alt war. Bereits in der Schule interessierte er sich besonders für Dichtung, Musik und das Theater. Er heiratete 1872 Mathilde Friederike Theodore von Schöler (* 11. Oktober 1851), eine Tochter des Generals August von Schoeler. Auf seiner Hochzeitsreise kam er zum ersten Mal nach Bayreuth, wo kurz zuvor, am 22. Mai, die Grundsteinlegung für das Bayreuther Festspielhaus Richard Wagners stattgefunden hatte. In Bayreuth: 1877 wurde er von Richard Wagner nach Bayreuth geholt, wo er von 1878 bis 1938 die Zeitschrift Bayreuther Blätter zunächst redigierte und herausgab. Er wohnte ab 1878 in der Schillerstraße, unweit von Wagners Haus Wahnfried. Richard Wagner, von dem die Idee für die Zeitschrift ausgegangen war, sah in den Bayreuther Blättern eine Zeitschrift zur Verständigung über die Möglichkeiten einer deutschen Kultur. Die Zeitschrift entsprach der Kunst- und Lebensanschauung Richard Wagners, hier wurden u. a. dessen letzte Aufsätze erstmals veröffentlicht. Wagner bedauerte zeitweise, Wolzogen nach Bayreuth berufen zu haben, da er sich genötigt fühlte, ihn beschäftigen zu müssen und Aufsätze für die Zeitschrift zu verfassen. Nach Wagners Tod entwickelte sich Wolzogen zu einer zentralen Figur des sogenannten Wahnfried-Kreises", der das Werk Wagners mit pseudoreligiöser Bedeutung aufzuladen versuchte. Wolzogen war Leiter des Allgemeinen Richard Wagner Vereins. Signatur des Verfassers.
-
Eigh. Brief m. U.
Verlag: oO [Leipzig] oJ [/1849], 1848
Anbieter: manuscryptum - Dr. Ingo Fleisch, Berlin, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität
EUR 100,00
Währung umrechnenEUR 9,95 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbDeutsche Handschrift auf Papier, 1 S. auf 2 Bl., c. 20,5 x 13,5 cm, gebräunt. Umschlag fehlt. An den befreundeten Pädagogen und Sprachwissenschaftler Julius Ludwig Klee (1807-1867) in Leipzig. Brockhaus teilt Klee mit, dass er drei Schüler, nämlich seinen jüngsten Sohn Fritz (Friedrich Brockhaus, 1838-1895), seinen Neffen Hippolyte Dardenne sowie Hans Reimer (1839-1887, aus der Verlegerfamilie Reimer, späterer Besitzer der Weidmann'schen Verlagsbuchhandlung) auf ihre Befähigung für die Sexta überprüfen solle. Am folgenden Tag werde er seinen Sohn Friedrich auf der Nikolaischule bei Nobbe (Karl Friedrich August Nobbe, 1791-1878, Pädagoge und Philologe, damaliger Direktor der Leipziger Nikolaischule) anmelden. Mit seinem Sohn Clemens (1837-1877, deutscher lutherischer Theologe) habe er das schon getan. - Hermann Brockhaus, Sohn des Verlegers Friedrich Arnold Brockhaus, wurde nach seinem Studium der orientalischen Sprachen Professor in Jena und später in Leipzig. Seine Gattin Ottilie Wagner war die Schwester des Komponisten Richard Wagner. Der junge Friedrich Nietzsche (1844-1900) war ein Schüler und Freund von Hermann Brockhaus, in dessen Haus er auch Wagner kennenlernte. Hermanns Sohn Friedrich (der angehende Sextaner) wiederum, der später ein bedeutender Jurist werden sollte, verdankte sein Berufung zum Professor des Straf- und Kirchenrechtes an der Universität Basel im Jahre 1871 zu einem gut Teil dem Einfluss von Nietzsche, der bereits seit 1869 in Basel lehrte.
-
Original Autograph Ildiko Raimondi /// Autogramm Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 45,00
Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbUmschlag. Zustand: Sehr gut. Eigenhändiger Briefumschlag von Ildiko Raimondi mit Namenszug im Absender.- /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Ildikó Raimondi (geborene Ildikó Clara Szabo, verheiratete Szabo-Raimondi; * 11. November 1962 in Arad, Rumänien) ist eine ungarisch-österreichische Sängerin (Sopran). Nach Studien in ihrer Heimat und ersten Engagements ebenda und in Italien gewann Ildikó Raimondi 1988 beim 7. Hans-Gabor-Belvedere-Gesangswettbewerb den Ersten Preis in der Kategorie Operette. Seit 1991 gehört sie zum Ensemble der Wiener Staatsoper, wo sie in mehr als 40 Opernpartien von der Pamina (Die Zauberflöte) bis zur Mimi (La Bohème) und von der Susanna (Le nozze di Figaro) bis zur Rosalinde (Die Fledermaus) auftrat. Auch im Wiener Musikverein konzertiert sie regelmäßig, ebenso auf Gastspielreisen und auf Festspielbühnen. Bei den Bregenzer Festspielen trat sie als Micaela (Carmen) auf, beim Wiener Klangbogen und bei den Wiener Festwochen in großen Mozartpartien, beim Edinburgh Festival unter Sir Charles Mackerras als Marzelline im Fidelio und bei den Salzburger Festspielen mit Musik von Wolfgang Amadeus Mozart und Egon Wellesz. Gastspiele führten die in Wien lebende Künstlerin unter anderem an die Deutsche Oper Berlin, die Semperoper Dresden, die Bayerische Staatsoper München und an das Opernhaus Zürich. Dazu kamen Konzerte, Rundfunk- und Fernseh-Auftritte in vielen Ländern Europas, in Japan, Indonesien, den USA und Israel. Auch Sakralmusik interpretiert sie, so im Rahmen der Schubertiade des Wiener Musikvereins oder in den großen Oratorien Johann Sebastian Bachs und Joseph Haydns, bei denen sie unter prominenten Dirigenten als Solistin mitwirkte. Ildikó Raimondi interpretiert auch Musik des 20. Jahrhunderts, u. a. Werke von Franz Schmidt, Arnold Schönberg, Alexander Zemlinsky, Egon Wellesz, Ernst Krenek, Gottfried von Einem und Paul Hindemith. Unter den Werken zeitgenössischer Musik gehören Friedrich Cerha und Thomas Daniel Schlee zum Repertoire der lyrischen Sopranistin. 2003 gab Ildikó Raimondi im Rahmen eines größeren wissenschaftlich-künstlerischen Lied-Projekts eine Sammlung der 41 Goethe-Lieder des tschechischen Komponisten Wenzel Johann Tomaschek heraus. In der Saison 2006/07 folgten Liederabende in Frankfurt am Main, Düsseldorf, im Wiener Musikverein (?Mozart und seine Gesellen?) und in Freiburg im Breisgau anlässlich des 550-Jahr-Jubiläums der dortigen Universität: Sie sang ferner Konzerte mit den Wiener Symphonikern (Uraufführung der ?Hymne der Agave? von Egon Wellesz), den Wiener Philharmonikern (Mozarts Krönungsmesse und Exsultate, jubilate in St. Peter zu Rom) unter Leopold Hager sowie der Sächsischen Staatskapelle Dresden (Mozarts Requiem) unter Manfred Honeck. An der Eröffnung des neuen Opernhauses von Valencia im Palau de les Arts Reina Sofía wirkte Ildikó Raimondi als Marzelline in Ludwig van Beethovens Fidelio unter der Leitung von Zubin Mehta mit. Die Saison 2007/08 verzeichnet unter anderem Liederabende und Konzerte in Bonn, Dresden (Anton Bruckners Te Deum unter Zubin Mehta, Sächsische Staatskapelle), Frankfurt, Wien (Wiener Musikverein), schließlich die Asien-Tournee der Wiener Staatsoper mit Le nozze di Figaro (Susanna / musikalische Leitung: Seiji Ozawa) sowie u. a. die Rollen der Pamina und der Mimi in der Wiener Staatsoper sowie der Rosalinde an der Bayerischen Staatsoper. Ildikó Raimondi ist seit Oktober 2015 Professorin für Sologesang an der Universität Mozarteum in Salzburg.[1] Im Februar 2024 wurde bekanntgegeben, dass sie die künstlerische Leitung der Schubertiade auf Schloss Atzenbrugg übernehmen soll.[2] Sie hat zwei Söhne. 2011 hat sie die vorläufig neuen Textversionen der Österreichischen Bundeshymne in einer Einspielung vorgestellt. /// Standort Wimregal GAD-10.310 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.
-
Emil Panosch: Gedr. Visitkarte mit 6 eigenh. Zeilen und U. sowie: M. Anders: Eigenh. Brief mit U.
Verlag: Wien, März 1914., 1914
Anbieter: Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH, Vienna, A, Österreich
Manuskript / Papierantiquität
EUR 80,00
Währung umrechnenEUR 30,00 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbZuammen 2½ SS. 4to bzw. 6,2:10,5 cm. Emil Panosch, seines Zeichens "Besitzer des slb. Verdienstkreuzes mit der Krone | n.ö. Landtagsabgeordneter | Gemeinderat der Stadt Wien | Vorsteher der Wiener Uhrmachergenossenschaft | etc. etc." erlaubt sich dem Wiener Kulturstadtrat Hans Arnold Schwer (1856-1931) "ein Schreiben wegen der Modelle des Wiener Bildhauers Friedl zu übersenden". Dem Brief zufolge befinden sich 9 Arbeiten des verstorbenen Bildhauers Ottokar Anderle in Anders' Besitz: "Diese Modelle hatte akad. Bildhauer Ottokar Anderle beim Tode Friedels gekauft, um der Familie aus der ersten Verlegenheit z. helfen. Ich bewahrte die Modelle seit dem Tode Anderles auf, da er mir immer sagte, man wird sie fürs Museum brauchen, da von Friedl nichts vorhanden ist [.]". - Der verstorbene Bildhauer hatte zahlreiche dekorative Plastiken geschaffen, u.a. an der Wiener Börse (1877) sowie an den Arkadenhäusern der Reichsratsstraße (1880-83), hauptsächlich jedoch für die Theaterbauten Ferdinand Fellners (1847-1916) und Hermann Helmers (1849-1919) in ganz Europa (etwa 1893 für das Berliner Metropoltheater). Als sein bedeutendstes Werk gelten die beiden Rossebändiger am Maria-Theresia-Platz in Wien (1893). Vgl. Thieme/B. XII, 457. - In altem Sammlungsumschlag.
-
Eigenh. Bildpostkarte mit U.
Verlag: Wien, 4. Juli 1966., 1966
Anbieter: Kotte Autographs GmbH, Roßhaupten, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität
EUR 300,00
Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den Warenkorb1 S. 8vo. An Herrn Käfer in Wien: [] Später, diese Tage (eine Art Weltflucht) gelten einer Kammersymphonie: eine oft schwierige Angelegenheit. Von deren U-Aufführung orientiere ich Sie. Der Rest? (eigentlich immer und alles) ist viel, sehr viel Arbeit. So war ich (als Gast v. Juror von Rainier III.) in Monaco, soll beruflich nach Paris und fühle mich allzu oft allzumüde und unwohl []". Die Postkarte zeigt das Fischerhaus in Fuschl am See. Nach dem Besuch des Konservatoriums in Karlsruhe ging Apostel 1921 nach Wien. Er war dort bis 1925 Schüler von Arnold Schönberg, später von Alban Berg. Apostel, der zur zweiten Generation der Neuen Wiener Schule der Musik zählt, war als freier Musiklehrer, Pianist und Dirigent tätig und bemühte sich als Komponist, unter Beibehaltung der von Schönberg entwickelten Form- und Konstruktionsprinzipien an die Tradition der klassischen Musik in Österreich anzuknüpfen. Seit den fünfziger Jahren verwendete er in seinen Kompositionen zwölftönige Komplexe und wandte sich 1957 mit seinem Rondo ritmico für Orchester ganz der Zwölftontechnik zu. Er schrieb Orchesterwerke, Klaviermusik, eine Kammersymphonie, Chöre und Lieder. Dabei ließ er sich von Gedichten Eduard Mörikes, Friedrich Hölderlins, Rainer Maria Rilkes, Georg Trakls und von Bildern Oskar Kokoschkas und Alfred Kubins anregen.
-
Albumblatt mit eigenh. Unterschrift.
Verlag: Zürich, 16. V. 1933., 1933
Anbieter: Kotte Autographs GmbH, Roßhaupten, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität
EUR 400,00
Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den Warenkorb8vo. 1 p. Namenszug unterhalb seines Portraits. - Walter Mittelholzer war Sohn einer Bäckersfamilie. Nach der Sekundarschule machte er eine Lehre als Fotograf und rückte anschliessend in Dübendorf in die Rekrutenschule ein. Eingeteilt wurde er in die Gebirgsbrigade 18 bei der neuen Fliegertruppe.Sein erster Flug führte ihn in einem Farman-Doppeldecker von Dübendorf nach Kloten. Mittelholzers Auftrag war es, Batteriestellungen am Holberg bei Kloten aus 1000 m Höhe zu fotografieren. Ein Jahr später wurde er als Unteroffizier Leiter der fotografischen Abteilung. Mehrere Flüge in der Umgebung Zürichs liessen in ihm den Wunsch nach längeren Flügen aufkommen. Ein erster Alpenflug, den er im Auftrag seines Kommandanten unternahm, scheiterte wegen einer Motorenpanne. Ein zweiter Versuch gelang und Mittelholzer kehrte mit gelungenen Aufnahmen zurück. Diesem Flug folgten zahlreiche weitere und so entstand eine umfangreiche Sammlung von Luftaufnahmen aus fast allen Gebieten der Schweiz.1917 erwarb Mittelholzer die zivile Fluglizenz und ein Jahr später schloss er die Ausbildung zum Militärpiloten ab.Am 5. November 1919 gründete er mit seinem Militärkollegen Alfred Comte die Mittelholzer und Co., Luftbildverlagsanstalt und Passagierflüge. 1920 schloss sich diese Firma mit der finanzkräftigeren Ad Astra Aero zusammen. Mittelholzer wurde Direktor und Chefpilot der Ad Astra Aero, aus der später die Swissair entstand.Im Auftrag der Junkerswerke flog er von Berlin aus die neuen Linien nach Danzig und Riga. Geplante Proviantierungsflüge von Spitzbergen aus für die Nordpolexpedition Roald Amundsens waren wegen einer Panne an Amundsens Flugzeug in Alaska obsolet. Stattdessen wurden auf der Junkers-Spitzbergen-Expedition vom 5. bis 8. Juli 1923 vier Rundflüge über Spitzbergen unternommen, von denen der längste über eine Strecke von 1000km bis über den 80. Breitengrad führte.[1] Während Arthur Neumann die Junkers F13 flog, war Mittelholzer für Filmaufnahmen und Fotografien zuständig. Es entstanden so die ersten Luftbildaufnahmen Spitzbergens. Ein möglich erscheinender Polflug wurde wegen technischer Probleme am Flugzeug unterlassen.[2] Im Winter 1924/25 flog Mittelholzer im Auftrag der persischen Regierung nach Teheran, welches er einen Monat nach seinem Start am Zürichhorn erreichte.1927 flog Mittelholzer als Erster nach Südafrika: Am 7. Dezember 1926 startete er, zusammen mit dem Schweizer Geologen Arnold Heim, dem Schriftsteller René Gouzy und dem Mechaniker Hans Hartmann, mit seiner Maschine vom Typ Merkur der Dornier-Werke in Zürich, flog über Alexandrien und den Victoriasee und landete, 76 Tage später, am 21. Februar 1927 in Kapstadt. Dabei legte er in zweieinhalb Monaten mit dem auf Schwimmer gesetzten Flugzeug 20'000 Kilometer zurück. Vom 17.Februar bis 6. März 1928 umrundete Mittelholzer in einer Junkers F 13 (CH 94) das westliche Mittelmeer und machte über 100 Luftbilder. Die wesentlichen Flugetappen waren ZürichRomTunisAlgierMadridMarseilleZürich. Die Flugzeiten betrugen zusammen 47 Stunden und 20Minuten bei einer zurückgelegten Gesamtentfernung von 6370 Kilometern.Am 8. Januar 1930 überflog er als Erster den Kilimandscharo. Dabei machte er unter anderem aus etwa 6200 Metern Höhe Luftaufnahmen vom Krater des Kibo, die in Illustrierten veröffentlicht wurden und grosses Aufsehen erregten.Im Winter 1930/31 unternahm Walter Mittelholzer einen weiteren Flug nach Afrika, über Marokko und Algerien bis zum Tschadsee. Auf dem Rückflug traf er in der Wüste am Kap Juby die deutsche Pilotin Elly Beinhorn auf ihrem ersten Afrikaflug.1931 wurde Walter Mittelholzer technischer Direktor der neu gegründeten Fluggesellschaft Swissair. 1934 flog er nach Addis Abeba, um Kaiser Haile Selassie seine bestellte Fokker Maschine selber zu überbringen. Dies war sein letzter Flug auf langen, unbekannten Routen. Jedoch hat Walter Mittelholzer auch in Europa und in der Schweiz weiterhin Luftbilder gemacht. Seine über 100'000 Aufnahmen aus rund 9000 Flügen haben heute einen grossen historischen Wert: Rund 18'000 Bilder, unter anderem Glasplatten im Format 13 × 18cm befinden sich heute im Bildarchiv der ETH-Bibliothek. Die Bilder und Geschichten seiner langen Auslandflüge hat Walter Mittelholzer jeweils in Büchern veröffentlicht, welche hohe Auflagen erreichten. Zur multimedialen Vermarktung seiner Auslandflüge gehörten auch Dokumentarfilme, die Mittelholzer als Mitbegründer der Praesens-Film AG produzierte.Walter Mittelholzer stürzte 1937 auf einer Klettertour an der Südwestwand der Stangenwand in der Steiermark mit seiner Seilschaft zu Tode, verursacht vermutlich durch Steinschlag. Geführt wurde er dabei von Ulrich Sild (19111937), dem ältesten Sohn von Cenzi von Ficker und Hannes Sild. Dritte des Bergsteigerteams war Liselott Kastner, geborene Lorenz ( 1937).
-
Autogrammbuch der Sopranistin Maria (auch Marie) Kastl mit 93 Unterschriften von u. a. Maria Cebotari, Kirsten Flagstad, Wilhelm Furtwängler, Alexander Kipnis, Hans Knappertsbusch, Franz Schmidt und Set Svanholm.
Verlag: Salzburg und Wien, 1934-1943., 1943
Anbieter: Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH, Vienna, A, Österreich
Manuskript / Papierantiquität
EUR 1.200,00
Währung umrechnenEUR 30,00 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den Warenkorb93 Unterschriften auf 70 Bll. Zeitgenössischer Kunstlederband. 8vo. Das mit zahlreichen prominenten Namen versehene Stammbuch wurde größtenteils während der Salzburger Festspiele und in Wien zusammengetragen. Seine Halterin war Sopranistin und von 1930 bis 1938 eines der beiden Bauernmädchen in Mozarts Opera buffa "Le nozze di Figaro", die (in der Inszenierung von Lothar Wallerstein) bei den Salzburger Festspielen und von 1931 bis 1939 auch an der Wiener Staatsoper gegeben wurde. Die 93 Einträge stammen von Margit Angerer, Anton Arnold, Ewald Balser, Irma Beilke, Dino Borgioli, Else Böttcher, Mercedes Capsir, Maria Cebotari, Maud Cunitz, Trude Eipperle, Richard Eybner, Kirsten Flagstadt, Ella Flesch, Willi Forst, Karl Friedrich, Wilhelm Furtwängler, Dusolina Giannini, Karl Hammes, Georg Hann, Theo Herrmann, Paul Hörbiger, Hans Hotter (2x), Gusti Huber, Alfred Jerger, Louise Kartousch, Erwin Kerber, Alexander Kipnis, Franz Klarwein (2x), Josef Knapp, Hans Knappertsbusch, Fritz Krenn, Zinka Kunz, Virgilio Lazzari, Lotte Lehmann, Frida Leider, Max Lorenz, Viktor Madin, Ferdinand Maierhofer, Rose Merker, Ruth Michaelis, Toti dal Monte, Alfred Muzzarelli, Hans Hermann Nissen (2x), Henk Noort, Jarmila Novotná, Julius Patzak (2x), Ezio Pinza, Alfred Poell (3x), Maria Reining, Hans Reinmar (2x), Marta Rohs, Helge Roswaenge (2x), Gertrud Rünger, Erna Sack, Richard Sallaba, Emil Schipper, Franz Schmidt, Else Schulz, Elisabeth Schumann, Vera Schwarz, Paolo Silveri (?), Albin Skoda, Gerda Sommerschuh, Set Svanholm, Set Svanholm, Horst Taubmann (2x), Margarete Teschemacher, Hermann Thimig, Kerstin Thorberg, Lawrence Tibbett (2x), Liane Timm, Piroska Tutsek, Franz Völker (2x), Ludwig Weber, William Wernigk, Luise Willer, Josef Witt, Otto Woegerer, Zdenka Ziková und Erich Zimmermann sowie von zwei nicht identifizierten Beiträgern. - Tadellos erhalten.
-
3 ms. Briefe mit eigenh. U., 2 eh. Postkarten mit U. und 1 eh. Briefkarte mit U.
Verlag: München, 1927., 1927
Anbieter: Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH, Vienna, A, Österreich
Manuskript / Papierantiquität
EUR 12.000,00
Währung umrechnenEUR 30,00 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbZusammen 11½ SS. auf 6 Bll. 4to und (qu.-)8vo. Die Postkarten mit eh. Adresse, die Briefkarte mit eh. adr. Kuvert. Unveröffentlichte Korrespondenz mit dem Schriftsteller und Übersetzer Hermann Georg Scheffauer, der gemeinsam mit Mann die im Verlag Th. Knaur Nachf. neu erscheinende Reihe "Romane der Welt" herausgab, von der bis März 1928 insgesamt 58 Bände erscheinen sollten: "Wie Sie mir Melville und Ilona charakterisieren, sind es gewiss gute Bissen für die Sammlung. Die deutschen Autoren sind auch meine Sorge", doch bringt Mann eine ganze Reihe von Namen ins Spiel, darunter A. M. Frey, Balder Olden, Ernst Lothar, Leo Perutz, Arnold Ulitz, Wilhelm Speyer, Willi Seidel, Bruno Frank und Bruno Götz (27. I. bzw. 31. III.). - "Die Frage eines deutschen Buches, das wirklich unbedingt so bald wie möglich heraus muss, beschäftigt mich dauernd. Aber die Hauptschwierigkeit ist eben die, die Sie nennen, dass die besseren Autoren in festen Händen sind. Wir dürfen beide nicht müde werden, uns weiter umzusehen. War das Manuskript von Frey ganz ungeeignet und haben Sie an die Autoren geschrieben, die ich Ihnen genannt habe? Anbei erhalten Sie 2 Briefe von Leuten, die sich als Uebersetzer anbieten und mit denen Sie vielleicht Fühlung nehmen. Hinzu kommt noch ein Brief einer mir bekannten Dame, Fräulein Emma Bonn in Feldafing bei München, der desselben Inhalts ist. Diese Dame ist zweisprachig, d. h. englisch-deutsch aufgewachsen, produziert selbst literarisch und würde nicht nur gut übersetzen sondern wahrscheinlich auch interessante Vorschläge machen können, was Material betrifft [.]" (1. III.). - Emma Bonn, die Tochter einer aus Deutschland stammenden Bankiersfamilie, wurde 1879 in New York geboren und kehrte in jungen Jahren mit ihrem Vater Wilhelm und ihrem Bruder Max nach Frankfurt zurück. 1913 zog sie nach Feldafing am Starnberger See, wo sie ein altes Haus zu einer stattlichen Villa umbauen ließ; die übrige Familie übersiedelte bis in die 1920er Jahre nach England, wo sich der Schwerpunkt ihrer Unternehmungen befand. In Kronberg i. T., wo die Familie bis zum Ersten Weltkrieg die Sommer zuzubringen pflegte, genoss sie wegen ihrer Wohltätigkeit großes Ansehen; Emmas Vater war der Namensgeber einer dortigen Straße, und im ehemaligen Sommersitz der Familie ist heute das Rathaus der Stadt untergebracht. Emma gehörte in Feldafing zum Kreis um Thomas Mann und Bruno Frank und schrieb heute weitgehend vergessene Romane und Erzählungen. Ihr Leben, das seit 1929 von einer schweren Nervenkrankheit überschattet war, endete am 24. Juni 1942 in Theresienstadt. - Mit Ausnahme der beiden Postkarten jeweils auf Briefpapier mit gedr. Briefkopf. - Nicht in: Die Briefe Thomas Manns. Regesten und Register. Hrsg. v. Hans Bürgin und Hans-Otto Mayer. Bearb. und hrsg. unter Mitarbeit von Yvonne Schmidlin (Frankfurt a. M., S. Fischer, 1976ff.).
-
Gästebuch des Restaurant Lindmayer an der Donau (Wien).
Verlag: Wien, 1958 bis 2006., 2006
Anbieter: Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH, Vienna, A, Österreich
Manuskript / Papierantiquität
EUR 6.500,00
Währung umrechnenEUR 30,00 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den Warenkorb11 Bde. Verschiedene Quartformate. Mit einigen Beilagen (siehe unten). Die vorliegenden Gästebücher umfassen einen Zeitraum von knapp zwanzig Jahren und gestatten einen einzigartigen Einblick in die Geschichte der beliebten Restauration an der Donau, deren Geschichte bis in das Jahr 1896 zurückreicht, als der Schiffmüller Anton Lindmayer am Donauufer (Dammhaufen 21) eine Weinschänke errichtete; seit 1902 mit einer Gastwirtschaftskonzession ausgestattet, war Bürgermeister Lueger ein häufiger Gast in dem "Donauperle" genannten Gasthaus. Die folgende Generation - Gustav Johann Lindmayer (1877-1929) und dessen Frau Therese (1890 -1969) - führte den Betrieb bis nach dem Zweiten Weltkrieg, anschließend fungierten Gustav Lindmayer (1905-1996), seine Frau Elisabeth (1923-2007) und deren Tochter Elisabeth jun. als Gastgeber für tausende von Gästen, darunter zahlreiche namhafte Persönlichkeiten aus allen Gebieten des öffentlichen Lebens wie Fred Adlmüller, Scheich Dschabar Al Ached von Kuwait, Ali Al Mofta, Rudi Altig, Gustinus Ambrosi, Hannes Androsch, Ettore Bastianini, Marian Bene, Anton Benya, Carlo Bergonzi, Michael Birkmeyer, Karl Blecha, Georg "Schurli" Blemenschütz, Maxi Böhm, Christian Broda, Rudolf Carl, José Carreras, Marin Ceausescu, Mimi Coertse, Dalai Lama und dessen Schwester, Alfred Dallinger, Ali Daschti, Rupert Davies, Vilma Degischer, Ivan Desny, Gottfried von Einem und Lotte Ingrisch, Richard Eybner, Rainhard Fendrich, Franz Fischler, Nora Frey, Cornelia Froboess, die Spieler des FC Kickers Luzern, Harry Fuss, Rex Gildo, Dana Gillespie, Vadim Glowna, Boy Gobert, Erich Götzinger, Karel Gott, Grete Grander, Leopold Gratz, Béla Guttmann, Waltraud Haas, Michael Häupl, Marte Harell, Heinrich Harrer, Karl Hartl, Hans Hass, Rudolf Hausner, Traudl Hecher, Johannes, Ludovica und Nicole Heesters, Kurt Heintel, Hans Hofer, Josef Holaubek, Thomas Hörbiger, Renate Holm, Friedensreich Hundertwasser, Saddam Hussein, Rosemarie Isopp, Georg Jacoby, Franz Jonas, Udo Jürgens, Alice und Ellen Keßler, Arnold Keyserling, Mohammed M. Khalili, Neil Kinnock, Rudolf Kirchschläger, Josef "Joki" Kirschner, Otto Klemperer, Edith Klinger, Dagmer Koller, Thanat Koman, Sawanit Kongsiri, Hans Krankl, Peter Kraus, Bruno und Vera Kreisky, Peter Kreuder, Erzbischof Mesrob Krikorian, Anita Kristina, Michael Kuhn, Ferdinand Lacina, Lotte Lang, Sixtus Lanner, Zarah Leander, Lotte Ledl, Leherb und Lotte Profohs, Hugo Lindinger, Theo Lingen, Emanuel List, Manfred Loth, Kurt Conrad Loew, Gretl, Sissy und Guggi Löwinger, Victor Luithlen, Karl Lütgendorf, Ali MacGraw, Jimmy Makulis, Louise Martini, Johanna Matz, Herta Mayen, Douglas McArthur II, George McGovern, Wolfgang Mekis, Peter Minich, Vahan Mirakian, Kurt Mrkwicka, Adelbert Muhr, Fritz Muliar, Elli Naschold, Alfred Neubauer, Elisabeth Neumann-Viertel, Ruth Niehaus, Mohsen Nourbakhsh, Rudolf Nürnberger, Camillo Öhlberger, Hans Orsolics, Elfriede Ott, Ashraf Pahlavi, Kostas Papanastasiou, László Papp, Karl Paryla, Gustav Peichl ("Ironimus", mit ganzseitiger Handzeichnung), Gunther Philipp, Hans Pirkner, Gawril Charitonowitsch Popov, Hugo Portisch, Marcel Prawy, Herbert Prohaska, Joesi Prokopetz, Dieter Quester, Julius Raab, Tunku Abdul Rahman, Kai Rautenberg, Karl Reidinger, Helmuth Reinberger, Heinz Reincke, Hans Richter, Zhu Rongji, Sieghardt Rupp, Barbara Rütting, Toni Sailer, Hans Sallmutter, Otto Schenk, Helmuth Schicketanz, Karl Schlögl, Dolores Schmidinger, Marianne Schönauer, Emmerich Schrenk, Maria Sebaldt, Johannes Mario Simmel (mit kleiner Zeichnung), Joginder Singh, Fred Sinowatz, Kurt Sobotka, Ernst Stankovski, Horst Stein, Kurt Steyrer, Peter Stiedl, Harri Stojka, Robert und Einzi Stolz, Toni Strobl, Frank Stronach, Henriette Thimig, Gerhard Track, Ernst Trost, Olga und Vera Tschechowa, Greta Unger, Peter Vogel, Franz Vranitzky, Peter Weck, Gerhard Wendland, Senta Wengraf, Paula Wessely und Attila Hörbiger, Peter Weck, Ljuba Welisch, Oskar Werner, Horst Winter, Hermann Withalm, Gusti Wolf,
-
Original Autogramm Hans Thoma (1839-1924) /// Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 150,00
Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbUmschlag. Zustand: Gut. A4 Albumblatt mit aufmontierter Originalkunstpostkarte eines Selbstportraits von Hans Thoma, darunter aufmontierter Briefumschlag mit eigenhändiger Adresse und Unterschrift als Absender von Hans Thoma an den Militärhistoriker Oskar Regele zu Mödling, postgelaufen am 3. November 1909 /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Oskar Regele (* 7. Juli 1890 in Pettau, Österreich-Ungarn; ? 1. Februar 1969 in Wien) war ein österreichischer Offizier, Militärhistoriker und -schriftsteller. Er war nach 1945 Leiter des Wiener Kriegsarchivs und 1955 zugleich Generaldirektor des Österreichischen Staatsarchivs sowie von 1952 bis 1963 Gründungspräsident der Österreichischen Kommission für Militärgeschichte. Freundschaftlich mit Emil Liebitzky verbunden, hatte er einen nicht unwesentlichen Anteil an der Konzeption des neuen Bundesheeres. Für seine Verdienste wurde er u. a. Ehrenpräsident der Commission Internationale d?Histoire Militaire, deren Vorstand er von 1960 bis 1965 angehörte. /// Hans Thoma (* 2. Oktober 1839 in Oberlehen, Bernau im Schwarzwald, heute Landkreis Waldshut; ? 7. November 1924 in Karlsruhe) war ein deutscher Maler und Grafiker. Hans Thoma stammte aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater Franz Joseph Thoma (1794-1855) war ein gelernter Müller und arbeitete als Holzarbeiter im Schwarzwald. Seine Mutter Rosa Thoma (1804-1897), geborene Mayer, stammte aus einer Kunsthandwerkerfamilie. Ihr Großvater stammte aus Menzenschwand und war ein Bruder des Großvaters von Franz Xaver und Hermann Winterhalter.[1][2] Die begonnenen Lehren, zuerst als Lithograph und Anstreicher in Basel, dann als Uhrenschildmaler in Furtwangen, brach er ab. Er betrieb autodidaktische Mal- und Zeichenstudien, bevor er 1859 von der Großherzoglichen Kunstschule in Karlsruhe aufgenommen wurde, wo er u. a. Schüler von Johann Wilhelm Schirmer und Ludwig Des Coudres war. 1866 beendete Thoma sein Studium. Wanderjahre Auf einer Waldwiese, 1876, Hamburger Kunsthalle. Thomas Braut Cella war das Modell der weiblichen Figur im Bild Nach Aufenthalten in Basel und Düsseldorf (1867-1868)[3] ging er zusammen mit Otto Scholderer 1868 nach Paris, wo ihn besonders die Werke Gustave Courbets und der Schule von Barbizon beeindruckten. Thoma ging schließlich nach München, die damalige Kunsthauptstadt Deutschlands. Er lebte dort von 1870 bis 1876. 1874 reiste er erstmals nach Italien. 1877 heiratete Thoma die Blumen- und Stilllebenmalerin Cella Berteneder. Eine zweite Italienreise folgte 1880, nachdem er 1879 England bereist hatte und dort 1884 im Art Club Liverpool ausstellen sollte. Er war mit Arnold Böcklin befreundet und stand dem Leibl-Kreis nahe. Frankfurt und Kronberg Interieur des Palais Pringsheim Seit 1878 lebte Thoma im Frankfurter Westend, Haus an Haus mit dem Malerfreund Wilhelm Steinhausen, und in gemeinsamem Haushalt mit seiner Ehefrau, seiner Schwester Agathe und mit Ella, der 1878 adoptierten Nichte seiner Frau. Dort traf er unter anderem auf den in der Nachbarschaft (Mendelssohnstraße 69) lebenden SDAP-Politiker, Ex-Internatsdirektor und Privatgelehrten Samuel Spier und seine Frau, die Schriftstellerin und Kunstkritikerin Anna Spier. Die Spiers wie auch andere Bekannte Steinhausens unterstützten Thoma mit Aufträgen. Anna Spier schrieb Artikel und ein Porträt in Buchform über ihn; Thoma schuf für sie ein Exlibris und malte ein Porträt, das sich heute im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg befindet. Von 1886 bis 1899 lebte er in der Frankfurter Wolfsgangstraße 150 und von 1896 bis 1898 zugleich auch in Oberursel in der Taunusstraße 20 (heute Altkönigstr. 20). Inschriften an beiden Häusern weisen darauf hin. Während dieser Zeit entstand auch der Fries mit mythologischen Szenen im Palais Pringsheim in München. Zeitweise beherbergte er den Schriftsteller Julius Langbehn. Der Erbauer des Wohnhauses der Thomas, Simon Ravenstein, unterstützte Thoma mit zahlreichen Aufträgen, deren erster 1882 die Ausmalung des Hauses des Architekten selbst war. Thoma stand den Malern der Kronberger Malerkolonie nahe. 1899 bezog die vierköpfige Familie in Kronberg im Taunus eine Wohnung mit Atelier neben dem Friedrichshof, was Thoma als sichtbaren Ausdruck der lang ersehnten Anerkennung als Maler empfand. Karlsruhe Selbstporträt mit Blume, 1919, National Gallery of Art Hermann Dumler: Hans Thoma auf dem Totenbett 1899 wurde Hans Thoma zum Professor an der Großherzoglichen Kunstschule in Karlsruhe und zum Direktor der Kunsthalle Karlsruhe ernannt. Dieses Amt übte er bis 1920 aus.[4] In der Kunsthalle stattete er die Thoma-Kapelle aus, die noch heute dort zu besichtigen ist; zu seinem 70. Geburtstag eröffnete ein Anbau mit Thoma-Museum. Die Karlsruher Zeit wurde überschattet durch den Tod seiner Frau Cella 1901, der Thoma jahrelang depressiv stimmte. Thoma wohnte nunmehr mit seiner Schwester in Karlsruhe. Seit seiner Ausstellung im Münchner Kunstverein 1890 wurde er allgemein in Deutschland anerkannt. Thoma gehörte bis um etwa 1910 zu den angesehensten Malern Deutschlands. Meyers Großes Konversations-Lexikon hielt 1909 fest, er sei ?einer der Lieblingsmaler des deutschen Volkes geworden?,[5] eine Bezeichnung, die 2013 vom Frankfurter Städel-Museum mit der Ausstellung Hans Thoma. ?Lieblingsmaler des deutschen Volkes? aufgegriffen wurde.[6] Von 1905 bis 1918 war Thoma vom Großherzog ernanntes Mitglied der Ersten Kammer des Badischen Landtags. Im Oktober 1914 gehörte er zu den Unterzeichnern des Manifestes der 93, dessen Text zu Beginn des Ersten Weltkrieges den deutschen Militarismus zu verteidigen versuchte und bestritt, dass Kriegsgräuel in Belgien stattgefunden hatten.[7] 1919 organisierten Ernst Oppler und Lovis Corinth eine Geburtstagsfeier anlässlich seines 80.[8] Hans Thoma starb im November 1924 mit 85 Jahren in Karlsruhe. Künstlerische Entwicklung und Bedeutung Der Rhein bei Säckingen, 1873, Alte Nationalgalerie Mainebene, 1875, Museum für Franken Acht tanzende Frauen in Vogelkörpern, 1886 Thomas Frühwerke sind von einem lyrischen.
-
Original Autogramm Hermann Alexander Graf Keyserling (1880-1946) /// Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 200,00
Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Blankovisitenkarte von Hermann Alexander Graf Keyserling mit blauer Tinte signiert mit eigenhändigem Zusatz "23. VI. 1937", dabei Nachruf auf Hermann Keyserling von Willy Krampf /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Hermann Alexander Graf Keyserling, kurz Hermann Keyserling (* 8. Julijul. / 20. Juli 1880greg. in Könno (estnisch: Kõnnu, heute Gemeinde Kaisma), Gouvernement Livland, Russisches Kaiserreich; ? 26. April 1946 in Innsbruck), war ein deutschbaltischer Philosoph. Hermann Keyserling, ein Enkel des in Russland angesehenen Geologen Alexander Graf Keyserling, stammte aus einem alten deutschbaltischen Adelsgeschlecht. Er wuchs auf den abgeschiedenen livländischen Gütern seines Vaters auf, erst in Könno, dann in Rayküll, wo er von seinen Eltern und Hauslehrern unterrichtet wurde.[1] Nach dem Tode seines Vaters Leo (1895) heiratete seine Mutter Johanna im Jahre 1900 einen dieser Hauslehrer. Diese nicht standesgemäße Verbindung, die Hermann Keyserling zutiefst missbilligte, führte zu einem dauerhaften und folgenschweren Zerwürfnis: Die Mutter wandte sich radikal gegen Standesunterschiede, der Sohn wurde zu einem Verfechter aristokratischer Ideale.[2] Nach dem Abitur (1897) übersiedelte Keyserling nach Genf, wo er Geologie studierte. 1898/1899 setzte er das Studium in Dorpat (heute Tartu, Estland) fort. In Dorpat wurde er Mitglied der Korporation ?Livonia?.[3] 1899 wurde er in einem Duell schwer verwundet. Darauf ging er nach Heidelberg, dann nach Wien, wo er 1902 das Geologiestudium mit der Promotion abschloss.[4] In Wien schloss er Freundschaft mit dem Schriftsteller Houston Stewart Chamberlain, unter dessen Einfluss er sich der Philosophie zuwandte. Chamberlain war für ihn als Mensch ein Vorbild, doch bestand zwischen ihnen nach Keyserlings Worten keine ?sachliche und gesinnungsmäßige Übereinstimmung?, und später trennten sich ihre Wege.[5] Von 1903 bis 1906 wohnte Keyserling in Paris, von 1906 bis 1908 in Berlin, dann kehrte er auf sein Gut Rayküll zurück. Das Familienvermögen ermöglichte ihm das Leben eines freien Schriftstellers und Philosophen. 1911/1912 unternahm er die Weltreise, auf der sein bekanntestes Werk entstand, das Reisetagebuch, das aber wegen der Kriegswirren erst 1919 erschien und ihn dann schlagartig bekannt machte. Bis zum Ende der Weimarer Republik wurden trotz des anspruchsvollen philosophischen Inhalts 50.000 Exemplare verkauft.[6] Nach dem Kriegsende emigrierte er nach Deutschland. Die entschädigungslose Enteignung seiner Güter durch die estnische Regierung brachte ihn 1919 um seine bisherige finanzielle Existenzbasis.[7] Im selben Jahr heiratete er die Gräfin Maria Goedela von Bismarck-Schönhausen (1896-1981), eine Enkelin des Reichskanzlers Otto von Bismarck, mit der er die beiden Söhne Manfred (1920-2008) und Arnold (1922-2005) hatte. Auf Einladung des ehemaligen Großherzogs Ernst Ludwig von Hessen ließ er sich in Darmstadt nieder. Dort gründete er 1920 mit der Unterstützung Ernst Ludwigs und des Verlegers Otto Reichl die ?Schule der Weisheit?, eine Lebensschule und vor allem eine Begegnungsstätte für maßgebliche Persönlichkeiten des geistigen Lebens. Zu den prominenten Förderern des Vorhabens gehörte Thomas Mann.[8] An Keyserlings Gründung der Gesellschaft für freie Philosophie war Kuno Graf von Hardenberg maßgeblich beteiligt.[9] Als philosophischer Schriftsteller und Leiter der Schule wurde Keyserling eine der namhaftesten Persönlichkeiten des geistigen Lebens in der Weimarer Republik. An den Jahrestagungen seiner Schule beteiligten sich u. a. Carl Gustav Jung, Max Scheler, Richard Wilhelm, Leo Frobenius, Paul Dahlke, Rabindranath Tagore, Frank Thieß und Hans Driesch.[10] Ein Schwerpunkt seiner Bestrebungen war die europäische Auseinandersetzung mit asiatischem Denken, ein anderer der geistige Austausch zwischen Deutschland und Frankreich.[11] Seine bekanntesten Werke wurden ins Englische, Französische und Spanische übersetzt und erregten auch im Ausland großes Aufsehen.[12] Die Wirkung seines Auftretens prägte die Vorstellungen von dem, was ein Philosoph in der Öffentlichkeit sein kann. Grab von Hermann Graf Keyserling auf dem Neuen Friedhof Mühlau, Innsbruck Ab 1931 setzte sich Keyserling öffentlich mit dem erstarkenden Nationalsozialismus auseinander. Er bezeichnete ihn als Irrationalismus, der zur Katastrophe führen müsse, und folgerte: ?der Nationalsozialismus [?] darf [?] als Partei niemals zur Führung gelangen?.[13] Allerdings bemühte er sich, auch positive Aspekte im Nationalsozialismus zu finden. In der nationalsozialistischen Presse wurde er heftig angegriffen. Nach der Machtübernahme Hitlers erhielt er Redeverbot. Er konnte auch eine Zeitlang nicht in Deutschland publizieren und durfte nicht mehr ins Ausland reisen. Wegen seines Ansehens im Ausland wurden diese Verbote aber zeitweilig gelockert.[14] 1937 nahm er zusammen mit Fritz Usinger und anderen Schriftstellern und Künstlern an der Gau-Kulturwoche der NSDAP in Darmstadt teil.[15] Nach dem Kriegsende plante Keyserling eine Neugründung der Schule der Weisheit in Innsbruck. Das Vorhaben fand in Österreich viel Unterstützung, kam aber nicht zustande, da Keyserling schon im April 1946 starb.[16] Er liegt auf dem Friedhof in Innsbruck-Mühlau begraben. Sein Sohn Arnold Keyserling trat später ebenfalls als Philosoph hervor. Werk Das Reisetagebuch eines Philosophen zählt zu Keyserlings grundlegenden Werken. Es enthält die philosophischen Eindrücke der Weltreise, die den Autor über das Mittelmeer, den Sueskanal und den Indischen Ozean nach Ceylon, Indien, China, Japan und Nordamerika führte. Fernöstliche Weisheit trifft hier auf die abendländische Weltanschauung. Das Motto lautete Der kürzeste Weg zu sich selbst führt um die Welt herum. Er schilderte, dass er sich auf der Reise so in seine jeweilige Umgebung versenkte, dass er zu einem Teil von ihr wurde. Daher verglich er sich gern mit Proteus, dem griechischen Gott der Wandlung, der jede beliebige Gestalt annehmen konnte. Im Spektrum.
-
Original Autogramm Arnold Gehlen (1904-1976) /// Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 240,00
Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Blankovisitenkarte von Arnold Gehlen mit blauer Tinte mit vollem Titel signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Arnold Karl Franz Gehlen (* 29. Januar 1904 in Leipzig; ? 30. Januar 1976 in Hamburg) war ein deutscher Philosoph, Anthropologe und Soziologe. Er zählt mit Helmuth Plessner und Max Scheler zu den Hauptvertretern der Philosophischen Anthropologie. In den 1960er Jahren galt er als konservativer Gegenspieler Theodor W. Adornos. Gehlen war Sohn des Verlegers Max Gehlen[1] und dessen Frau Margarete Gehlen, geborene Ege. 1937 heiratete er Veronika Freiin von Wolff. Aus der Ehe ging eine Tochter hervor, die spätere Baronin Caroline von Lieven.[2] Ein Cousin war der erste Präsident des BND, Reinhard Gehlen. Gehlen legte 1923 am Thomas-Gymnasium in Leipzig das Abitur ab.[3] Nach einer Zwischenzeit als Buchhändler und Bankangestellter studierte Gehlen von 1924 bis 1927 Philosophie, Philologie, Kunstgeschichte, Germanistik und Psychologie in Leipzig und Köln. Er wurde bei Hans Driesch mit dem Dissertationsthema Zur Theorie der Setzung und des setzungshaften Wissens bei Driesch promoviert. Seine Lehrbefähigung erhielt er 1930 mit der Habilitationsschrift Wirklicher und unwirklicher Geist. Eine philosophische Untersuchung in der Methode absoluter Phänomenologie. Von 1930 bis 1934 war er Privatdozent für Philosophie an der Philologisch-Historischen Abteilung der Universität Leipzig. Am 1. Mai 1933 trat er in die NSDAP ein (Mitgliedsnummer 2.432.246) und wurde 1934 auch Mitglied im NS-Dozentenbund.[4] Im November 1933 unterzeichnete er das Bekenntnis der deutschen Professoren zu Adolf Hitler.[4] Nach Paul Tillichs Entlassung aus dem Staatsdienst, die aufgrund des Berufsbeamtengesetzes wegen eines kritischen Artikels Tillichs gegen die nationalsozialistischen Machthaber erfolgte, übernahm Gehlen dessen vakante Professur an der Universität Frankfurt im Rahmen einer Lehrstuhlvertretung. 1934 erhielt er - nach einer Zeit als Assistent von Hans Freyer - einen Lehrstuhl für Philosophie am Institut für Kultur- und Universalgeschichte an der Universität Leipzig. 1938 wechselte Gehlen als Professor an die Universität Königsberg, 1940 an die Universität Wien, wo er die zeitweilige Institutsleitung innehatte, im Oktober 1941 aber erstmals von der Wehrmacht einberufen wurde, um bis Mai 1942 eine Stellung als Kriegsverwaltungsrat in der Personalprüfstelle des heerespsychologischen Amtes im besetzten Prag zu versehen. Gegen Ende des Krieges wurde Gehlen erneut einberufen und im Range eines Leutnants schwer verwundet. Als Nichtösterreicher wurde er nach dem Krieg aus dem österreichischen Staatsdienst entlassen. Nach zwei Jahren Unterbrechung konnte Gehlen seine Tätigkeit als Professor, wenn auch zunächst nicht an einer Universität, wieder aufnehmen. Von 1947 bis 1961 war er Dozent für Psychologie und Soziologie an der Staatlichen Akademie für Verwaltungswissenschaften Speyer, später Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer und ab 1962 ordentlicher Professor für Soziologie an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) in Aachen, wo er bis zu seiner Emeritierung 1969 lehrte. Ein Jahr vor der Emeritierung gehörte er zusammen mit vielen anderen Professoren der RWTH Aachen zu den Unterzeichnern des ?Marburger Manifestes?,[5] das eine akademische Front gegen die aufkommende Mitbestimmung an den Hochschulen bildete.[6] Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde seine Haltung vor allem seitens der Frankfurter Schule scharf kritisiert. Im Nationalsozialismus war er nicht nur Mitläufer. Er profitierte vielmehr auch von der Entlassung von Professoren aus rassistischen und politischen Gründen. Nicht alle Professoren gehörten in der Zeit des Nationalsozialismus der NSDAP an. Antisemitische Äußerungen sind von ihm jedoch nicht bekannt geworden; insbesondere seine Theorie des Menschen, seine philosophische Anthropologie, ist frei davon. Ende der 1950er Jahre hatte sich Gehlen um eine Soziologie-Professur an der Universität Heidelberg bemüht. Max Horkheimer und Theodor Adorno machten ihren Einfluss geltend, um die von Karl Löwith unterstützte Berufung Gehlens auf einen Heidelberger Lehrstuhl zu verhindern. Auch René König versuchte die Berufung zu verhindern, indem er die Fakultät auf die NS- und Rosenberg-Passagen in Der Mensch von 1940 aufmerksam machte. Gehlens Berufung scheiterte. Arnold Gehlen starb 1976 in Hamburg. Philosophische und soziologische Arbeiten Von wesentlichem Einfluss während seines Studiums der Philosophie waren Hans Driesch, Nicolai Hartmann und Max Scheler. Er galt seinerseits dann als bedeutender Vertreter der Leipziger Schule. Seine Beiträge zur Philosophischen Anthropologie waren einflussreich und sind heute bekannter als die Arbeiten seines Vorgängers Scheler und als das Werk Helmuth Plessners, das allerdings in den letzten Jahrzehnten eine Renaissance erlebte. Seinen anthropologischen Einsichten zufolge ist der Mensch ein ?instinktentbundenes, antriebsüberschüssiges und weltoffenes Wesen?.[7] Seine These vom Menschen als ?Mängelwesen? geht im Kern auf Johann Gottfried Herder zurück und erinnert an das ?nicht festgestellte Tier? Friedrich Nietzsches, dem Wesen, das zeitgleich und komplementär zu seiner relativen Instinktarmut eine ungeheure Plastizität und Weltoffenheit, eine Formbarkeit, Lernfähigkeit und Erfindungsgabe besitzt. Aus dieser menschlichen Beschaffenheit ergibt sich für Gehlen eine ?Institutionenbedürftigkeit? Den Begriff der ?Institutionen? versteht Gehlen sehr grundlegend; er hat damit eine der wichtigsten soziologischen Institutionentheorien formuliert. Darunter fallen technische Werkzeuge ebenso wie Sprache, Rituale und Kulte (?magische Techniken?) sowie die Institutionen Familie, Staat und Kirche. Die Technik ist in diesem Sinne ein ?Organersatz? bzw. eine ?Organverlängerung? des Menschen - ein Gedanke, der im Kern bereits bei dem von Hegel beeinflussten Technikphilosophen August Koelle auftaucht.[8] Gehlen stellt neben das Konzept einer Steigerun.