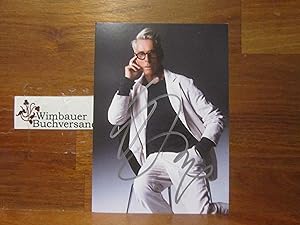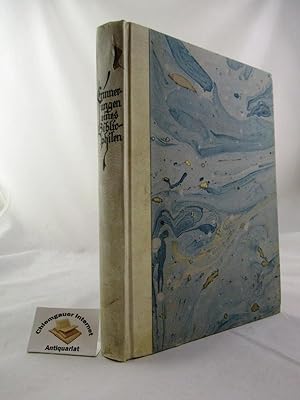werke alter meister, Signiert (7 Ergebnisse)
FeedbackSuchfilter
Produktart
- Alle Product Types
- Bücher (5)
- Magazine & Zeitschriften (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Kunst, Grafik & Poster (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Manuskripte & Papierantiquitäten (2)
Zustand Mehr dazu
- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Wie Neu, Sehr Gut oder Gut Bis Sehr Gut (1)
- Gut oder Befriedigend (4)
- Ausreichend oder Schlecht (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Wie beschrieben (2)
Einband
Weitere Eigenschaften
Sprache (2)
Gratisversand
- Kostenloser Versand nach Deutschland (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
Land des Verkäufers
Verkäuferbewertung
-
Original Autogramm Alan Ayckbourn /// Autograph signiert signed signee
Sprache: Englisch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 12,00
Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbEchtfoto. Zustand: Gut. Herrliches Schwarzweissfoto mit Katze auf der Schulter von Alan Ayckbourn bildseitig mit blauem Kuli signiert mit eigenhändigem Zusatz "Best wishes," /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Sir Alan Ayckbourn, CBE (* 12. April 1939 in Hampstead, London) ist ein britischer Autor von Theaterkomödien. Alan Ayckbourn ist der Sohn des Violinisten Horace Ayckbourn und der Schriftstellerin Irene Worly. Werk Ayckbourn schrieb bereits im Alter von zehn Jahren Stücke, begann seine Theaterkarriere Ende der 1950er Jahre allerdings als Schauspieler. Die ersten Stücke verfasste Ayckbourn 1959 bis 1961 unter dem Pseudonym Roland Allen.[1] Mittlerweile hat Ayckbourn mehr als 70 Theaterstücke geschrieben und gilt als einer der erfolgreichsten Komödienautoren der neueren Zeit in Europa. Seine Theaterstücke wurden in über 35 Sprachen übersetzt und weltweit aufgeführt. Zugleich arbeitete Ayckbourn als Regisseur.[2] Nach der Einschätzung des British Council gehört er zu den herausragenden zeitgenössischen Dramatikern (?one of the world's pre-eminent dramatists?).[3] Seine Werke enthüllen meist menschliche Schwächen der englischen oberen Mittelschicht im Umgang miteinander. Ayckbourn gilt auch als Meister der Farce. 1987 wurde Ayckbourn von der britischen Königin zum Commander des Order of the British Empire ernannt und 1997 als erster Dramatiker seit Terence Rattigan als Knight Bachelor (?Sir?) in den Adelsstand erhoben.[4] Nach einem Schlaganfall 2006 schränkte Ayckbourn viele seiner Aktivitäten ein, nahm jedoch kurze Zeit später seine Tätigkeit als Autor wieder auf. 2009 wurde er in die American Theater Hall of Fame aufgenommen. Kommentare über Alan Ayckbourn und seine Werke Ayckbourn . schreibt über die Mühen der modernen Menschheit, den Pleuelstangen, Zahnrädern, Kolben des "großen Mechanismus" auszuweichen. Wo Shakespeare die Menschen exemplarisch fallen lässt, sieht Ayckbourn sie alltäglich hüpfen, stolpern und tanzen. Wo bei Shakespeare die Männer Macht und Bedeutung haben, sind bei Ayckbourn längst die Frauen Trägerinnen der Potenz und des Lebenswillens. In seinem Werk finden wir Damen vom Schlag Camilla Parker Bowles'; seine Männer sind einfühlsame, zaudernde Wichte.-.[5] Stücke Fast alle Stücke Ayckbourns wurden im Stephen Joseph Theatre in Scarborough erstaufgeführt. Dort war Ayckbourn von 1972 bis 2009 künstlerischer Leiter (Artistic Director).[6] 1959: The Square Cat 1959: Love After All 1960: Dad's Tale 1961: Standing Room Only 1962: Christmas V Mastermind 1963: Mr Whatnot 1965: Meet My Father, Relatively Speaking 1967: The Sparrow 1969: How The Other Half Loves 1970: The Story So Far., Me Times Me Times Me, Family Circles 1971: Time And Time Again (deutsch: In bestem Einvernehmen - Uraufführung 1971 in London, Deutschsprachige Erstaufführung 1974 im Theater in der Josefstadt Wien) 1972: Absurd Person Singular (deutsch: Frohe Feste - Uraufführung 1972 in London, deutsche Uraufführung 1974 im Thalia Theater Hamburg - Regie: Harry Meyen) 1973: Fancy Meeting You, Table Manners (Norman Conquests) 1973: Make Yourself At Home, Living Together (Norman Conquests) (deutsch: Trautes Heim) 1973: Round And Round The Garden (Norman Conquests) (Bei den drei letztgenannten Stücken, deutsch: Normans Eroberungen; handelt es sich um eine Geschichte, die aus drei unterschiedlichen Perspektiven dargestellt wird. Jedes der Stücke spielt an einem anderen Ort: Esszimmer, Wohnzimmer und Garten) 1974: Absent Friends (deutsch: Freunde in der Not - Uraufführung 1974 in London, deutsche Erstaufführung 1978 im Staatstheater Saarbrücken) 1974: Confusions (Sammlung von 5 Einaktern, darunter Mother Figure und A Talk in the Park) 1975: Jeeves (1966, umgeschrieben 1996 als By Jeeves) 1975: Bedroom Farce (deutsch: Schlafzimmergäste) 1976: Just Between Ourselves 1977: Ten Times Table (deutsch: Das Festkomitee - Uraufführung 1977 Stephen Joseph Theatre, Scarborough; deutsche Erstaufführung 1980 Theater am Kurfürstendamm, Berlin) 1978: Joking Apart (deutsch: Spaß beiseite - Uraufführung 1978 in Scarborough, deutsche Erstaufführung 1979 Deutsches Schauspielhaus in Hamburg - Regie: Peter Zadek) 1979: Sisterly Feelings 1979: Taking Steps 1980: Suburban Strains 1980: Season's Greetings (Schöne Bescherungen) 1981: Way Upstream 1981: Making Tracks 1982: Intimate Exchanges Consisting Of 8 Plays 1983: It Could Be Any One Of Us 1984: A Chorus Of Disapproval 1985: Woman In Mind 1987: A Small Family Business 1987: Henceforward. (deutsch: Ab jetzt - deutsche Erstaufführung 1989 im Theater am Kurfürstendamm - Regie: Peter Zadek) 1988: Man Of The Moment 1988: Mr A's Amazing Maze Plays 1989: The Revengers' Comedies 1989: Invisible Friends 1990: Body Language 1990: This Is Where We Came In 1990: Callisto 5 (1990 umgeschrieben in Callisto 7) 1991: Wildest Dreams 1991: My Very Own Story 1992: Time Of My Life (Glückliche Zeiten) 1992: Dreams From A Summer House 1994: Communicating Doors 1994: Haunting Julia 1994: The Musical Jigsaw Play 1995: A Word From Our Sponsor 1996: The Champion Of Paribanou 1997: Things We Do For Love 1998: Comic Potential 1998: The Boy Who Fell Into A Book 1999: House (House & Garden - ein sog. "double play", das vor zwei unterschiedlichen Zuschauerschaften zeitgleich vorgeführt wird) 1999: Garden (House & Garden - siehe House) 2000: Virtual Reality 2000: Whenever 2001: MutProbe (Verfolgte Unschuld) 2001: UmTausch (Verfolgte Unschuld) 2001: RollenSpiel (Verfolgte Unschuld) 2002: Snake In The Grass 2003: My Sister Sadie 2003: Sugar Daddies 2004: Drowning on Dry Land 2004: Private Fears in Public Places 2004: Miss Yesterday 2005: Improbable Fiction 2006: If I were You 2008: Life And Beth 2008: Awaking Beauty 2011: Neighbourhood Watch (Play 75), (dt. Nachbarschaftswache) 2012: Surprises (Play 76) 2013: Arrivals & Departures (Play 77) 2014: Roundelay (Play 78) 2015: Hero?s Welcome (Play 79) 2016: Consuming Passions (Play 80) 2017: A Brief History of Women (Play 81) 2018: Better Off Dead (Play 82) 2019: Birthdays Past,
-
Original Autogramm Wolfgang Joop /// Autogramm Autograph signiert signed signee
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Signiert
EUR 25,00
Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 2 verfügbar
In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Wolfgang Joop bildseitig mit silbernem Stift signiert, ggf. mit eigenhändigem Zusatz "To Gina" (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Wolfgang Joop (* 18. November 1944 in Potsdam) ist ein deutscher Modedesigner; er betätigt sich zuletzt auch als Schauspieler. Er ist Gründer der Mode- und Kosmetikfirmen JOOP! und Wunderkind und gilt zusammen mit Karl Lagerfeld und Jil Sander als erfolgreichster Deutscher in dieser Branche. Joop wurde als Sohn von Gerhard (1914-2007) und Charlotte (1916-2010) Joop in Potsdam geboren. Er wuchs auf dem Bauernhof der Großeltern, Gut Bornstedt, am Park von Sanssouci auf, bis die Familie 1954 nach Braunschweig übersiedelte, wo sein Vater als Chefredakteur des Kulturmagazins Westermanns Monatshefte arbeitete. Zu DDR-Zeiten bewohnte die Schwester von Joops Mutter, Ulla Ebert (? 2002) das Grundstück und wurde bei der Erhaltung des Anwesens von der Familie aus dem Westen finanziell unterstützt. Nach der Wiedervereinigung zogen Joops Eltern nach Bornstedt zurück.[2] Seit 1994 teilt sich Wolfgang Joop mit seinen Töchtern Jette und Florentine die Besitzrechte.[3] Das Familiengut ist seit 2018 wieder Hauptwohnort des Designers.[4] 1970 heiratete Joop die damalige Kostümbildstudentin Karin Benatzky, von der er 1985 geschieden wurde.[5] Er hat zwei Töchter - Jette Joop, die als Mode- und Schmuckdesignerin tätig ist, und Florentine Joop, Schriftstellerin und Malerin. Seit der Trennung von seiner Frau lebt er in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft und ging 2013 eine Verpartnerung mit Edwin Lemberg ein, was erst 2017 bekannt wurde. Joop ist fünffacher Großvater.[6] Er bezeichnet sich selbst als Kosmopoliten. Er besaß zwei Villen in seiner Heimatstadt Potsdam (Villa Wunderkind und Villa Rumpf), erstere wurde 2017 an die Hasso-Plattner-Stiftung verkauft, der er sich sehr verbunden fühlt. Nach langjährigem Aufenthalt in Hamburg lebt er derzeit in Potsdam-Bornstedt.[7] Die frühen Jahre Aus einer Joop-Pelzkollektion, 1979 Nach seinem Abitur am Wilhelm-Gymnasium in Braunschweig begann Joop 1966 - nur auf Drängen seines Vaters - ein Studium der Kunstpädagogik in Braunschweig, das er nicht zu Ende führte. Er arbeitete nach dem Studienabbruch als Restaurator und betätigte sich als Maler. Außerdem fälschte er Bilder Alter Meister.[8][9] Joops Karriere begann 1970, als er zusammen mit seiner Frau Karin an einem Modewettbewerb der deutschen Zeitschrift Constanze teilnahm und die ersten drei Preise gewann. Aufgrund dieses Erfolges wurde er Moderedakteur beim Frauenmagazin Neue Mode. Diesen Job beendete er 1971; er zog es vor, fortan unabhängig zu arbeiten, unter anderem als freiberuflicher Journalist und Designer. Joop! JOOP!-Schriftzug ? Hauptartikel: Joop (Unternehmen) Im Frühjahr 1982 stellte Joop seine erste Prêt-à-porter-Damenkollektion vor, gefolgt von der ersten Herrenkollektion 1985. Zwei Jahre später, mit der Vorstellung seiner ersten Parfümkollektion, machte er seinen Namen endgültig zum Markenzeichen, indem er der Versalschrift zur Symbolisierung von Energie noch ein Ausrufezeichen anfügte. Ab sofort konnte man unter diesem Namen unter anderem Bekleidung, Schuhe, Schmuck, Brillen, Parfüm, Heimtextilien und Haushaltswaren erwerben. ?JOOP!? war nicht länger ein Designer-Label, sondern eine Lifestyle-Marke, die Lizenzen vergab, aber keine eigene Produktion mehr betrieb. Wolfgang Joop, 1992 1983 wurde Joop mit dem Fil d'or geehrt.[10][11] 1984 folgte die Auszeichnung mit dem ?Goldenen Spinnrad? der Stadt Krefeld und der Europäischen Seiden-Kommission. 1985 übernahm Joop eine Rolle als Gastdozent im Fachbereich Design an der Berliner Hochschule der Künste. Die Hochschule ernannte ihn 1987 zum Honorarprofessor. Er leitete später das Seminar ?Pelzmode mit Accessoires? 2009 folgte die Auszeichnung mit dem Bambi, 2011 wurde er mit dem GQ Men of the Year Award ausgezeichnet.[12] Nach der Wiedervereinigung begann Joop als erster westdeutscher Designer mit der Meißener-Porzellan-Manufaktur zusammenzuarbeiten, indem er für sie ein Service entwarf.[13] 1998 verkaufte Joop nach Unstimmigkeiten für rund 150 Millionen D-Mark 95 Prozent seiner Firmenanteile an den Hamburger Wünsche-Konzern, blieb aber zunächst weiterhin Chefdesigner der Marke JOOP! Der Verkauf der restlichen 5 Prozent und Joops endgültiger Ausstieg aus dem Unternehmen erfolgten 2001.[14] Wunderkind ? Hauptartikel: Wunderkind (Unternehmen) 2003 gründete Joop zusammen mit seinem Partner Edwin Lemberg die Wunderkind GmbH & Co. KG[15] mit Sitz in Potsdam. Die erste internationale Wunderkind-Modenschau fand im September 2004 auf der New York Fashion Week statt; Joop präsentierte danach in drei aufeinanderfolgenden Fashion Weeks die Mode der Marke.[16] Auf der Pariser Modewoche gab es 2006 den ersten Auftritt[17], im Oktober 2012 wurde dort eine komplette Kollektion präsentiert.[18] Anfang 2016 siedelte das Unternehmen nach Berlin um, neuer Standort waren Räumlichkeiten im ehemaligen Hotel Bogota.[19] Im Herbst 2017 trennte sich Wolfgang Joop von der Marke. Seine letzte Kollektion präsentierte er im März 2017 während der Mailänder Modewoche.[20] Weitere Aktivitäten Wolfgang Joop beschäftigt sich neben Mode und Design mit der Illustration. In dem Bildband Stillstand des Flüchtigen (2002) sind Porträts und Modeillustrationen von 1970 bis 2000 abgebildet. Über 100 Musterteile aus verschiedenen Joop-Kollektionen sind im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe ausgestellt. Seit 2009 verkauft er Editionen seiner Modezeichnungen in der Editionsgalerie LUMAS. Darüber hinaus profilierte sich Joop auch als Bildhauer, eines seiner Werke hat er für die Grabstätten seiner Eltern auf dem Bornstedter Friedhof entworfen. Auch Ölgemälde gehören zu seinem ?uvre. Seine Kunstwerke wurden unter anderem in der Kunsthalle Rostock (2009)[21], in Seoul (2010)[22] sowie während der Kunstbiennale in Venedig (2011)[23] und im Museum der Künste in Leipzig ausgestellt. Weiterhin samme.
-
Karl Hurm in der Ölmühle Haigerloch. Mit einführenden Texten von Barbara Lipps-Kant und Karl Arndt. * Beiliegend: Farbige Ansichtskarte (Karl Hurm Gelbes Glasfenster) mit handbeschriebener Rückseite "Wir hoffen, daß es Ihnen wieder besser geht: Wir sind sehr zufrieden. Alle guten Wünsche für Sie! wünscht Ihnen sehr herzlich Ihre Familie Karl Hurm"
Verlag: Kunstmuseum Ölmühle, Haigerloch, 1998
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat Heinzelmännchen, Stuttgart, Deutschland
Signiert
EUR 35,00
Währung umrechnenEUR 3,90 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den Warenkorb61, (1) Seiten. Mit zahlreichen farbigen Abbildungen. Farbig illustrierte Originalbroschur. (Einband etwas fleckig). 28x21 cm * Karl Hurm (* 29. Dezember 1930 in Weildorf; 8. Juni 2019 in Balingen) war ein deutscher Maler. Die Werke des autodidaktischen Künstlers zählen zur Naiven Kunst und werden seit 1998 in einer ständigen Ausstellung im Städtischen Kunstmuseum Ölmühle in Haigerloch gezeigt. Karl Hurm wurde 1930 als siebtes von acht Kindern geboren. Als Kind zeichnete er die dörfliche Umgebung seines Heimatortes Weildorf, das Malen war alleweil dabei" äußerte er dazu selbst. Nach dem Schulabschluss 1946 begann er eine Lehre zum Anstreicher. Daneben informierte sich Hurm über regionale Maler, besuchte den Düsseldorfer Maler Friedrich Schüz (18741954) und hörte von den jungen Künstlern, die im Kloster Bernstein arbeiteten. 1949 übernahm Hurm die elterliche Obst- und Gemüsehandlung in Weildorf. Seine wöchentlichen Fahrten zum Großmarkt in Stuttgart nutzte er auch für Museumsbesuche. Hurm nannte später neben den Werken alter Meister die Werke von Picasso und Paul Klee, Henri Rousseau und Paul Gauguin, Marc Chagall und Jean Tinguely als Anregung für seine Maltechnik und Motive. 1955 heirateten Karl Hurm und Anni Huber (19352019).[1] Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor, darunter der Amerikanist Gerd Hurm. Hurm arbeitete weiter im Obst- und Gemüsegroßhandel, in der Freizeit zeichnete und malte er. 1970 schied Karl Hurm aufgrund einer schweren Erkrankung aus dem Unternehmen aus und widmete sich seitdem ausschließlich der Malerei. 1972 gewann er mit dem Bild Frau beim Fernsehen den ersten Preis beim Sonntagsmaler-Wettbewerb" für Hobbykünstler der Firma Eisenmann, Böblingen. Im gleichen Jahr hatte er die erste Einzelausstellung in der Galerie die schwarze Treppe in Haigerloch. Seitdem präsentierte Karl Hurm seine Bilder in über 200 Gruppen- und Einzelausstellungen in Europa, den USA sowie Japan. Karl Hurm malte und lebte im Haigerlocher Stadtteil Weildorf. Die seit den 1970er Jahren entstandenen Werke Karl Hurms sind nur schwer einer Stilrichtung zuzuordnen, werden häufig unter dem Begriff Naive Kunst" gefasst. Hurm startete aus der Riege der Sonntagsmaler" und schuf ein umfangreiches, eigenständiges Werk. Er präsentiert seine Bilder zumeist in Öl auf Hartfaserplatten gemalt. Die kleinen Formate werden in selbstgebauten Holzrahmen gefasst. In den frühen 1970er Jahren malte Hurm belebte Szenen in naiver Manier (Die Arche Noah, 1973). Bis auf wenige Ausnahmen im Bild weist jeder Gegenstand, jedes Lebewesen seinen Platz, seine realistische Farbgebung auf. Schon früh lenkte Hurm durch eine eigenwillige Interpretation der Größenverhältnisse den Betrachter im Bild (Das Paradies, 1972). Die schwäbische Heimat im Wandel der Tages- und Jahreszeiten diente bis zuletzt als Basis vieler Bilder. Zentrale Merkmale sind Menschen, Häuser, Kühe, Pferde, Wiesen und Wälder, die Landschaft im Wechsel der Jahreszeiten, Szenen des alltäglichen Lebens. Dabei blieb Hurm keineswegs im Klischee einer ländlichen Idylle verhaftet, er nahm Brüche und Kanten der Moderne wertfrei wahr. In vielfältigen Variationen spielte er mit diesen Themen, so dass kein Bild dem anderen gleicht, jedes ein Einzelstück ist. Karl Hurm rückte im Laufe seines Schaffens vom Abbilden ab. Durch die mit feinem Pinsel in vielen Schichten aufgetragenen Farben, der Realität entrückten Formen, der Stimmung geschuldete Verwendung emotionaler Farbigkeit, entstand in seinen Bildern eine parallele Realität. In unbändiger Vorstellungskraft verfremdete Hurm Momente des Alltags und setzte Akzente in der Gewichtung durch eigenwillige Maßstäbe. So scheinen sich die kleinen, gedrungenen Männer vor den großen, runden, rothaarigen Frauen zu verstecken (Viadukt in der Winterlandschaft, 1988), als einsamer Betrachter steht der Mann der Natur gegenüber (Gelber Hügel, 1998). Häuser stapeln sich zu Gebirgen (Turm in der Winterlandschaft, 1986), Vögel nehmen Kontur und Farbigkeit der Büsche an (Großer Vogel mit drei Bäumen, 1986). Winterlandschaften und Interieurs gaben dem Maler Gelegenheit, eigenwillige Farbdominanzen" auszuloten (Blumenstrauß mit gelbem Vorhang, 1989). Hurm experimentierte mit den Farben Rot, Weiß, Blau, Braun, die als Filter über das Bildmotiv gelegt werden (Blauer Stadtteil, 1988). In den 1990er Jahren entwickelte die Farbe ein vom Gegenstand gelöstes Leben der Entgrenzung". Sie umfasst Gruppierungen (Grüne Vögel bei den Kühen, 1999), setzt expressive, kontrastreiche Schwerpunkte. Hurm leitete eine Tendenz zur Abstraktion ein, die an Höhlenmalereien erinnert. In den 1990er Jahren begann Karl Hurm vermehrt, Alltags-Objekte in seine Gemälde einzubauen, seine Bilder in die dritte Dimension zu führen. Strumpfhosen, Schuhbänder, Pinselborsten, Kettenglieder, Maschendraht, Einkaufsnetze, Zweige und Bucheckern wurden in Collagen untergebracht. Kaugummis, als Flachrelief in Form gepresst, lassen die Figuren plastisch erscheinen. Gleichzeitig entstanden Bilder auf alten Ofentüren, Eisenplatten, Blechen oder Holzstücken. Karl Hurm nutzte dieses Material, um wie aus ferner Vorzeit auf uns überkommene Bilder zu gestalten. Im Material vorgefundene Strukturen werden durch Andeutungen in Farbe interpretiert. Bereits als Kind und Jugendlicher hat Hurm gezeichnet. Dieses Frühwerk ist ebenso wenig erhalten wie die während der Berufstätigkeit als Obst- und Gemüsegroßhändler entstandenen Skizzen auf der Rückseite von Geschäftspapieren. Die erhaltenen Zeichnungen seit den 1960er Jahren verstehen sich nicht als Entwürfe, sie sind als eigenständige Kunstwerke präzise und detailfreudig komponiert. Die Zeichnungen entstanden immer dann, wenn Staffelei und Farben nicht zur Verfügung standen. (Quelle Wikipedia) Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 700.
-
Georg Muche. Der Zeichner. Staatsgalerie Stuttgart Graphische Sammlung. (Ausstellung) 4. September bis 16. Oktober 1977. Katalog und Ausstellung: Gunther Thiem. Widmungsexemplar. Handschriftlich auf dem Vortitelblatt: "für Ulrike Gauss Gerog Muche am 4. IX. 1977 dem Geburtstag von Oskar Schlemmer".
Verlag: Stuttgart 4. September bis 16. Oktober, 1977
Sprache: Deutsch
Anbieter: Antiquariat Heinzelmännchen, Stuttgart, Deutschland
Signiert
EUR 40,00
Währung umrechnenEUR 3,90 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den Warenkorb65, (4) Seiten. Mit zahlreichen teils farbigen Abbildungen. Illustrierte Originalbroschur. (Geringe Gebrauchsspuren). Querformat 24x32 cm * Dabei: Hans K. Roethel: Notizen zu Gerog Muche (8 Seiten. Als Manuskript gedruckt. Illustrrierter Originalumschlag) und zwei Zeitungsausschnitte mit Kritiken zur obigen Ausstellung. --- Georg Muche (* 8. Mai 1895 in Querfurt; 26. März 1987 in Lindau) war ein deutscher Maler, Grafiker und Hochschullehrer. Während seiner Schulzeit in Querfurt übte sich Muche in Zeichnungen von Schulfreunden, legte Naturstudien an, stellte Kopien der Alten Meister wie Tizian, Rembrandt, Rubens in Ölfarbe her, und beschäftigte sich mit van Gogh und Cézanne. Im Alter von 17 Jahren verließ Muche ohne Abitur die Schule, um in München bei Anton Abe an dessen privater Kunstschule Malerei zu studieren. Nach nur einem Jahr Unterricht und der abgelehnten Bewerbung an der bayrischen Kunstakademie ging er 1914 nach Berlin und fand dort Kontakt zur Gruppe um Herwarth Waldens Galerie Der Sturm". Dieser arrangierte bereits 1916 zusammen mit Max Ernst eine Ausstellung mit 22 Arbeiten für den jungen Muche. Obwohl ohne jede Ausbildung, stellte man ihn in der im September 1916 gegründeten Kunstschule des Sturm" aufgrund seiner überragenden Fähigkeiten als Lehrer für Malerei an. Bis 1917 gab es weitere Sturm"-Ausstellungen mit Paul Klee und Alexander Archipenko. 1918 wurde Muche zum Militär einberufen und wurde in den Wirren zum Ende des Ersten Weltkriegs zum Pazifisten. Nach 1919, er lebte inzwischen in Berlin, wurde er Mitglied der Novembergruppe, auf deren Ausstellungen er sich von 1927 bis 1929 beteiligte. 1920 wurde er von Walter Gropius nach Weimar berufen, um dort als Meister für Holzschnitzerei am Bauhaus tätig zu sein. Von 1921 bis 1927 war er Leiter der Werkstatt für Weberei, gab Vorkurse und leitete den Ausschuss für die Bauhausausstellung von 1923, für die das Musterhaus Am Horn" entworfen und errichtet wurde. 1925/26 entwarf er mit Hilfe des Architekturstudenten Richard Paulick das Stahlhaus Dessau". 1922 heiratete er die Bauhausschülerin Elsa Franke. 1927 zog er wieder nach Berlin, wo er bis 1930 Lehrer an Johannes Ittens privater Kunstschule wurde. Mit Itten, den er bereits 1916 kennengelernt hatte, verbanden ihn gemeinsame philosophische und pädagogische Vorstellungen. Sie hatten bereits bis Ittens Weggang 1923 gemeinsam den Vorkurs" am Bauhaus getragen, vor allem aber folgten beide den Lehren des Mazdaznan, eines auf dem Zoroastrismus beruhenden östlichen Kultes. Zwischen 1931 und 1933 nahm er eine Professur für Malerei an der staatlichen Akademie für Kunst und Kunstgewerbe Breslau wahr. Während der Zeit des Nationalsozialismus lehrte Muche von 1933 bis 1938 an der von Hugo Häring geleiteten Schule Kunst und Werk" in Berlin und beschäftigte sich fast ausschließlich mit Freskomalerei. Auf ein Dekret von Joseph Goebbels vom 30. Juni 1937 wurden unter anderem dreizehn seiner Werke als Entartete Kunst" beschlagnahmt, zwei davon waren im gleichen Jahr auf der gleichnamigen Ausstellung in München zu sehen. Von 1939 bis 1958 leitete Muche die neu eingerichtete Meisterklasse für Textilkunst", die der Höheren Fachschule für Textilindustrie (ab 1944 Textilingenieurschule) in Krefeld verwaltungsmäßig angegliedert war. 1942 malte Georg Muche in der Lackfabrik von Kurt Herberts in Wuppertal große Fresken, die im Jahr darauf bei einem Bombenangriff zerstört wurden. 1960 zog Muche nach Lindau/Bodensee, wo er als freier Maler, Grafiker und Schriftsteller tätig war und sich mit Kunsttheorien auseinandersetzte. Die Stadt Lindau ehrt ihn in ihrem Stadtmuseum (Cavazzen") mit einem nach ihm benannten Raum mit seinen Werken. Sein Grab auf dem Lindauer Friedhof wurde nach Ablauf der Ruhezeit 2007 aufgelassen. 1955 wurden seine Werke auf der Documenta 1 in Kassel ausgestellt. 1979 wurde er mit dem Lovis-Corinth-Preis ausgezeichnet. Georg Muche war Mitglied im Deutschen Künstlerbund sowie im Deutschen Werkbund. (Quelle Wikipedia) Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 1000.
-
Fritz Kuhr. Bauhaus-Erinnerungen. Meine Meister. (Hrsg. von Hermann Famulla). (Signiert vom Herausgeber).
Verlag: Frankfurt/M.; Team Kommunikation, 1993
ISBN 10: 3980243923 ISBN 13: 9783980243926
Sprache: Deutsch
Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland
Erstausgabe Signiert
EUR 48,00
Währung umrechnenEUR 4,99 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbZustand: Gut. 1. Auflage. 40 Seiten; farbige Illustr.; graph. Darst.; kart. Gutes Exemplar; geringfügige Bleistift-Eintragungen; minimale Gebrauchs- u. Lagerspuren. - Ex. Nr. "108" / Impressum SIGNIERT von Hrsg. Hermann Famulla. - Vorwort Hermann Famulla und Alwin Schütze. - Fritz Kuhr (* 10. Mai 1899 in Lüttich, Belgien; 25. Februar 1975 in Berlin) war ein deutscher Künstler. Im Alter von acht Jahren entdeckte Kuhr seine Leidenschaft für die Malerei. In der Folgezeit entstanden hauptsächlich Naturstudien. 1922 begegnete er Otto Pankok und schloss sich dessen Laienkünstlergruppe an. 1923 ging er nach Weimar, um die Werke von Wassily Kandinsky und László Moholy-Nagy zu studieren. Im gleichen Jahr schrieb er sich am Bauhaus als Student ein. Ausschlaggebend für seine Einschreibung war jedoch die Begegnung mit Werken von Paul Klee, insbesondere dessen Aquarell Traumstadt. Er belegte den Vorkurs bei László Moholy-Nagy und besuchte die freien Malklassen von Kandinsky und Klee. Nach dem Vorkurs ging er in die Werkstatt für Wandmalerei. 1927 legte er die Gehilfenprüfung an der Handwerkskammer in Dessau ab und war 1928 und 1929 als Mitarbeiter von Hinnerk Scheper in der Werkstatt für Wandmalerei tätig. Er beteiligte sich auch aktiv am sozialen Leben des Bauhauses. Unter anderem spielte er in der zweiten Bauhauskapelle den Bumbass und vertrat die Studentenschaft im Meisterrat. Er war mit Ernst Kallai befreundet. In der am Bauhaus geführten Kontroverse zur Stellung der Malerei positionierte sich Kuhr klar, indem er für eine eigenständige und freie Malerei am Bauhaus eintrat. Hiermit distanzierte er sich von der von Walter Gropius propagierten Einheit von Kunst und Technik, die der Kunst eine eher dienende Rolle zukommen ließ. 1929 bis 1930 war er Lehrer für gegenständliches Zeichnen, sowie für Akt und Porträt beziehungsweise Figur am Bauhaus. 1930 erhielt Kuhr das Bauhausdiplom Nr. 13 und ging als freier Maler nach Berlin. Dort stellte er in verschiedenen Galerien aus, unter anderem in der Galerie Ferdinand Möller, die ihn auch international vertrat. Bis 1933 erwarben die Kunstmuseen in Danzig, Hamburg und Hannover sowie die "Gesellschaft für moderne Kunst - Krefeld" Arbeiten Kuhrs. 1932 lernte er Ernst Ludwig Kirchner kennen, der ihm unter anderem eine Ausstellung in Davos vermittelte. (wiki) // " Die künstlerische Karriere von Fritz Kuhr begann mit einer Begegnung mit Otto Pankok. Anfänglich Mitglied in einer Laienkünstlergruppe, ging er dann an das Weimarer Bauhaus und studierte auch in Dessau weiter. Er wurde dort Mitarbeiter in der Werkstatt für Wandmalerei und lehrte später am Bauhaus gegenständliches Zeichnen, Akt- und Figuren-zeichnen. Fritz Kuhr trat am Bauhaus für ein eigenständiges Lehrfach Malerei ein. Er gehörte damit zu den Bauhäuslern, die nicht die von Gropius vertretene Verschmelzung von Kunst und Architektur für richtig hielten. Für Fritz Kuhr brauchte die avangardistische Kunst nicht in der Konstruktion von Gebrauchsgeräten und in der Architektur zu münden. Für ihn war die Malerei eine eigenständige Disziplin, die aus sich und der Umwelt schöpfen konnte und in die Abstraktion münden sollte. Paul Klee war Fritz Kuhrs wichtigster Meister. In den freien Malklassen von ihm und von Wassily Kandinsky lernte er eigene Wege zu finden. Nicht die Kopie der Meister war gefordert, sondern durch die Anregung der Meister sollten eigene Impulse vorangetrieben und verwirklicht werden, auch Moholy-Nagy war für Fritz Kuhr wichtig, wie die abstrakten Fotos belegen, die in der Bauhaus-Zeitschrift von 1929 veröffentlicht sind. Er hat die Impulse seiner Meister aufgenommen und zu einem sehr vielfältigen Werk zusammengefügt. Schon vor dem Krieg hat Fritz Kuhr ausgestellt, am wichtigsten sind hier die Ausstellungen von Ferdinand Möller und Cassirer. Nachdem er in den Naziausstellungen entartete Kunst" gezeigt wurde, war eine weitere Arbeit an seiner Kunst unmöglich, da er in Deutschland blieb. Nach dem Krieg arbeitete er beim Ulenspiegel, wieder werbend für die abstrakte Kunst. Erschrieb zum Beispiel über Ernst Ludwig Kirchner, der sich für Kuhrs Arbeit sehr interessierte, einen langen Artikel, hier, wie so oft, bestrebt, Interesse auch bei Nichtfachleuen zu erwecken. Bald wurde er Professor an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin und war hier tätig bis an sein Lebensende. Fritz Kuhrs Zeichnungen, Aquarelle, Guachen, Ölbilder, Drucke und die vielen Mischtechniken zeigen, daß er die Anregungen seiner Meister am Bauhaus zu einem Gesamtwerk entwickelt hat. Das Streben nach neuen Techniken und Experimenten, die schon seine Bauhauszeit prägten, legte er in seinem Leben nicht ab. So haben wir jetzt ein Werk vorliegen, dos geprägt ist durch künstlerische Individualität. . " (H. F.) ISBN 3980243923 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 250.
-
Erinnerungen eines Bibliophilen.
Verlag: Berlin-Wilmersdorf : Bibliophiler Verlag Goldschmidt-Gabrielli, 1919
Sprache: Deutsch
Anbieter: Chiemgauer Internet Antiquariat GbR, Altenmarkt, BAY, Deutschland
Erstausgabe Signiert
EUR 55,00
Währung umrechnenEUR 3,95 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbZustand: Sehr gut. IX, 207 Seiten Von Leopold Hirschberg und dem Vorbesitzer SIGNIERT. Nur der Rücken mit leichten Gebrauchsspuren ( kleine bestoßene Stelle, siehe Foto) . Sonst SEHR gutes Exemplar. - Winziger Stempel der Buchbinderin MARIA LÜHR am unteren Rand des hinteren Vorsatzes. Zu LÜHR vgl. ausführlichst WIKIPEDIA. - L. Hirschberg (Posen 1867 - 1929 Berlin) war Arzt, Musikschriftsteller und Bibliophiler. Als Büchersammler brachte er eine Bibliothek von 20.000 Bänden zusammen, die viele seltene Werke und Zeitschriften enthielt und die er 1913 an die Bibliothek der Universität Berlin verkaufte - Maria Lühr (* 2. April 1874 in Horsbüll; 1969 in Berlin) war Lehrerin, Autorin, Übersetzerin, Kunststickerin und die erste deutsche Buchbindemeisterin. Sie wurde am 2. April 1874 in Horsbüll, einem kleinen Ort an der Nordseeküste im Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein als drittes von acht Geschwistern geboren. Sie war die Tochter eines musikbegeisterten Pastors Wulf Friedrich August Lühr und Anna Friedrike, geb. Ottens. Ihrem Vater stand wenig Geld zur Verfügung. Er konnte seiner wissbegierigen Tochter deshalb keine höhere Schulbildung bieten. Am 1. April 1891 begann Maria im Alter von 16 Jahren eine Handarbeitslehre. Über Arbeitsstationen in Heide, Kreis Norderdithmarschen, Zwickau und Gotha gelangte sie zu ihrem zukünftigen Lebensort, Berlin und somit zum Lette-Verein. Sie schrieb: Mein sehnlichster Wunsch war von früher Jugend auf, recht viel von der Welt zu sehen."[1] Ihr hoch betagter Vater zog nach seiner Pensionierung zur letzten Lebensstation ebenfalls nach Berlin.[2] Lehre Maria Lühr besuchte 1899 einen Kurs im Lette-Verein zur Förderung der Erwerbsfähigkeit des weiblichen Geschlechts" und erlernte dort zunächst die Kunststickerei. Der 1866 von Wilhelm Adolf Lette in Berlin gegründete Lette-Verein plante eine Lehrabteilung für Buchbinden einzurichten. Maria Lühr sagte: Die Leitung kam darauf eine Lehrabteilung für Buchbinden einzurichten, und lenkte mich nach dieser Richtung hin. Mir gefiel das Handwerk."[1] Nach Rücksprache mit dem Vorstand, erklärte sich Maria Lühr bereit, das Buchbinderhandwerk zu erlernen. Nach mehrfachen Verhandlungen und auf Druck der Projektorin des Lette-Verein, der Kaiserinwitwe, Kronprinzessin Victoria, konnte der kaiserliche und königliche Hofbuchbinder Georg Collin seine Gesellenschaft überzeugen, eine Frau auszubilden. So konnte Maria Lühr 1899 ihre ersten eineinhalb Lehrjahre antreten. Der Kunsthistoriker und Bibliothekar Dr. Peter Jessen, der seit 1887 die Bibliothek des Kunstgewerbemuseum in Berlin leitete, vermittelte ihr eine einjährige Fortsetzung ihrer Buchbindelehre bei dem berühmten Buchbinder, Drucker und Künstler Thomas James Cobden-Sanderson in London, der sie in Lederband und Handvergoldung unterrichtete.[2] Nach ihrer Rückkehr aus London hielt sich Maria Lühr im Sommer 1901 in Düsseldorf auf, um bei Carl und Hendrik Schultze die Lederschnitttechnik nach Hulbe zu erlernen. Sie blieb nur einen Monat, danach ging sie zu Meister Wilhelm Rauch nach Hamburg und legte nach weiterer Lerntätigkeit 1902 die Gesellenprüfung und noch im selben Jahr die Meisterprüfung vor der Berliner Gewerbekammer ab.[1] Damit war Maria Lühr ab dem 9. Mai 1902 die erste Frau in Deutschland mit dem Meistertitel im Buchbinderhandwerk. 1902 richtete sie im Lette-Verein eine Klasse zur Ausbildung von Buchbinderinnen ein, die sie bis Oktober 1913 leitete. Paul Kersten führte nach ihr die Klassen im Lette-Verein weiter. Neben ihrer Lehrtätigkeit bildete sie sich stetig weiter, unter anderem in Berlin bei Bruno Scheer im Restaurieren alter Einbände, für zwei Monate in Brüssel bei Meister Louis Jacobs, einem berühmten Vergolder. Sie suchte viele Werkstätten in anderen Ländern auf und studierte Werkstücke der Einbandkunst in Bibliotheken, etwa in Paris. Durch ihre vielen Reisen und ihre Wissbegierde avancierte sie zur Kunstbuchbinderin.[1] Die erworbenen Englischkenntnisse und ihr Fachwissen erlaubten es ihr später, Douglas Cockerells Werk Bookbinding and the Care of Books" überzeugender zu übersetzen, als es Felix Hübel bei der ersten Auflage gelungen war.[2] Werk Im Oktober 1913 eröffnete sie ihre eigene Buchbinder-Werkstatt und Fachschule am Berliner Kurfürstendamm 225. In der Buchbinderwerkstatt und Fachschule wurden Schülerinnen in allen Bereichen der Buchbinderei gründlichst ausgebildet. In der Fachklasse wurden sie in dreijähriger Lehrzeit auf die Gesellenprüfung vor der Handwerkskammer vorbereitet. Maria Lühr wollte Frauen ermöglichen, den Meistertitel zu erwerben und Lehrlinge anzuleiten. Als Amateure erhielten neben Frauen auch Männer einen halbjährigen Unterricht, Bibliothekarinnen und Kinder zum ermäßigten Preisen. Außerdem wurde durch den Maler und Grafiker G. Tischler Zeichenunterricht erteilt und es fanden gesonderte Kurse für Marmorpapiere und Kleisterpapiere statt. Unterstützt wurde sie von ihrer Schülerin Helene von Stolzenberg, die sie zur Meisterin ausbildete. 1914 stellte sie auf der Bugra, der internationalen Messe für Buch und Graphik" in Leipzig aus. Die Bücher wurden im Auftrag von Frau Ida Schoeller-Düren für die Leipziger Bugra, Haus der Frau, Abteilung Sammlerinnen angefertigt und nach eigenem Entwurf vergoldet.[3] Ihre langjährige Mitarbeiterin Helene von Stolzenberg war dort ebenfalls mit eigenen Einbänden vertreten. Obwohl ihre Werkstatt weitestgehend von Bomben im 2. Weltkrieg verschont geblieben ist, sind eine überwiegende Anzahl ihrer vergoldenden Lederbände Kriegsverluste.[2] 1912 war Maria Lühr Gründungsmitglied des Jakob-Krause-Bundes, mit dem sie unter anderem bei der Ausstellung Deutsche Einbandkunst" im Jahr 1921 ausstellte. Nach 1921 kam es zum Bruch zwischen dem Altmeister Paul Kersten und den jüngeren Meistern. Die Vereinigung Meister der Einbandkunst (mde) wurde gegründet, zu der auch Maria Lühr wechselte.[2] Bund deutscher weiblicher Buchbindemeister Im März 1918 versuchte Maria Lühr einen Bund deutscher weiblicher Buchbindermeister" zu.
-
Nachmittag. Erinnerungen eines Verlegers.
Verlag: München, Piper Verlag, 1950
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Erstausgabe Signiert
EUR 68,00
Währung umrechnenEUR 3,40 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbZustand: Gut. Erstausgabe. 1. - 5. Tausend. 589 (3) Seiten. Mit 89 Fotos auf Tafelseiten. 19 cm. Einbandentwurf: Emil Preetorius. Mit einer eigenhändigen Widmung von Reinhard Piper an Ernst Penzoldt auf dem Vortitel: "Meinem lieben Freund und Festredner Ernst Penzoldt in Schwabing dankbar Reinhard Piper". Aus der Bibliothek von Ulla Penzoldt der Tochter des Schriftstellers Ernst Penzoldt. Beiliegend ein hektographierter Zeitungsartikel von Ledig-Rowohlt: Klaus Piper zu seinem 60. Geburstag am 27. März" aus dem Börsenblatt vom 26. März 1971. Beiliegend ein Zeitungsartikel von Karl Adolf Sauer: " Meisterschaft des Büchermachens" zum 70. Geburstag von Reinhard Piper in der Schwäbischen Landeszeitung vom 28.10. 1949. Guter Zustand. Schutzumschlag mit Randläsuren. - Reinhard Piper (* 31. Oktober 1879 in Penzlin; 21. Oktober 1953 in München) war ein deutscher Verleger und Kunsthistoriker. Er gründete 1904 in München den Verlag R. Piper & Co. Leben: Reinhard Piper wuchs als Sohn des Burgenforschers und Bürgermeisters Otto Piper zunächst in Penzlin in Mecklenburg auf. 1889-1893 lebte die Familie in Konstanz am Bodensee, wo der Vater freiberuflich als Burgenforscher tätig war. 1893 zog die Familie Piper nach München. Nach dem Einjährigen (Mittlere Reife) absolvierte Reinhard Piper 1895-1898 eine Buchhändlerlehre in der Palmschen Hofbuchhandlung in München und arbeitete 1898-1901 in der Berliner Buchhandlung Adolf Weber. 1900 lernte er den Bildhauer und Schriftsteller Ernst Barlach kennen, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verband. 1902-1903 arbeitete er in der Buchhandlung Köhler in Dresden. Im gleichen Jahr verlegte er mit Dafnis von Arno Holz sein erstes Buch. Am 19. Mai 1904 gründete er zusammen mit Georg Müller den Verlag R. Piper & Co. in München. In der Folge gab der Verlag u. a. Dostojewskis Sämtliche Werke und zahlreiche Bücher zur Kunst heraus. Nach der Scheidung von seiner ersten Frau heiratete Piper 1910 die Malerin Gertrud Engling aus Königsberg, 1911 wurde Sohn Klaus geboren, 1913 Sohn Martin und 1923 Tochter Ulrike. 1912 begegnete Piper erstmals dem Maler Max Beckmann. Piper stand in Verbindung mit Künstlern der Gruppe Der Blaue Reiter wie Franz Marc und Wassily Kandinsky, deren Almanach Der Blaue Reiter er verlegte. Seit 1923 verlegte Piper auch Reproduktionen von Gemälden alter und neuer Meister, die so genannten Piper-Drucke. Er wirkte am Kabarett Die Elf Scharfrichter mit. 1953 starb Piper an den Folgen eines Schlaganfalls. Sein Nachlass befindet sich im Deutschen Literaturarchiv Marbach. . Aus: wikipedia-Reinhard_Piper Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 710 Braunes Originalleinen mit goldgeprägten Rücken- und Deckeltiteln, Kopffarbschnitt und Schutzumschlag.