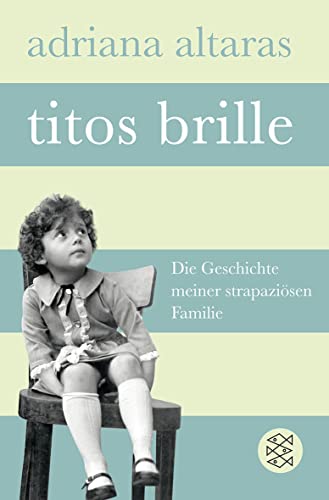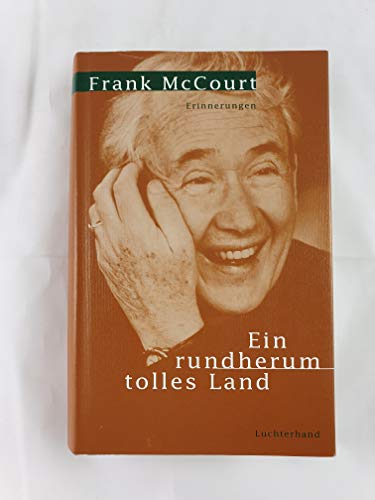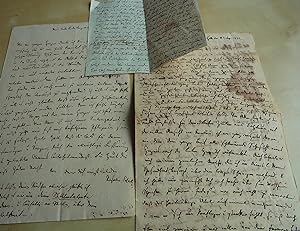nicht ohne meiner tochter, Erstausgabe (32 Ergebnisse)
FeedbackSuchfilter
Produktart
- Alle Product Types
- Bücher (9)
- Magazine & Zeitschriften (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Kunst, Grafik & Poster (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Manuskripte & Papierantiquitäten (23)
Zustand Mehr dazu
- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Wie Neu, Sehr Gut oder Gut Bis Sehr Gut (5)
- Gut oder Befriedigend (24)
- Ausreichend oder Schlecht (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Wie beschrieben (3)
Einband
Weitere Eigenschaften
Sprache (2)
Gratisversand
Land des Verkäufers
Verkäuferbewertung
-
Mein liebes Kind. Roman. Aus dem Italienischen von Antonio Avella. Originaltitel: Bambino mio. - (=Münchner Edition).
Verlag: München : Schneekluth Verlag, 1983
ISBN 10: 379510694X ISBN 13: 9783795106942
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Erstausgabe
EUR 3,60
Währung umrechnenEUR 3,40 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbZustand: Gut. Deutsche Erstausgabe. 156 (4) Seiten. 21 cm. Befriedigender Zustand. Schnitt fleckig. - 1976 erschien das erste Buch von Lidia Ravera - "Schweine mit Flügeln". Es wurde weltweit zum Bestseller. Mit einem Freund schrieb Ravera in nur zwei Wochen ein fiktives Tagebuch, in dem ein Mädchen und ein Junge ihre sexuellen Erfahrungen beschreiben. Ravera wollte erreichen, dass Jugendliche endlich ohne Scham über freie Liebe, Masturbation und Homosexualität redeten. Das Buch kam zunächst wegen angeblicher Pornografie auf den Index, wurde später wieder freigegeben. Allein in Italien sind bislang zweieinhalb Millionen Exemplare verkauft worden. Frisch wie ein Salatkopf. Kein Buch wurde so häufig aus der Schulbibliothek geklaut: Mit ihrem Sex-Tagebuch "Schweine mit Flügeln" schockte Lidia Ravera einst Italien - und landete wegen angeblicher Pornografie sogar auf dem Index. . Ich war damals tatsächlich noch sehr jung, immerhin ging ich aber schon aufs Gymnasium. 1968 hat meine eigene Biografie stark geprägt. Als ich gerade den Kopf aus der Kindheit herausstreckte, entstand eine Bewegung, die ihre Jugend als Abenteuer erlebte. Anders als die Generationen vor uns warteten wir nicht darauf, den Platz unserer Väter oder Mütter einzunehmen. Für mich als Tochter aus bürgerlichem Haus hätte das bedeutet, wie meine Mutter einen Akademiker zu heiraten und zwei Kinder zu bekommen. Stattdessen riss ich mit 18 erst mal von zu Hause aus. Freie Liebe, Masturbation und Homosexualität: Zwischen meiner Generation und der meiner Eltern lag als große Zäsur der Zweite Weltkrieg. Als ich in den fünfziger Jahren geboren wurde, erlebte Italien sein Wirtschaftswunder und war kein Agrarstaat mehr. Ich bin so alt wie das Fernsehen, meine Eltern hingegen gingen in ihrer Jugend noch nicht einmal ins Kino. Die Achtundsechziger-Bewegung hat die Kluft zwischen den Generationen weiter vergrößert und ihr erstmals einen politischen Wert beigemessen. Ich habe 21 Romane geschrieben, die allesamt von der Achtundsechziger-Generation handeln, sie sind eine Art kollektive Autobiografie. 1976 erschien mein erstes Buch, "Schweine mit Flügeln", das weltweit zum Bestseller wurde. Mit einem Freund, Marco Lombardo Radice, schrieb ich in nur zwei Wochen ein fiktives Tagebuch, in dem ein Mädchen und ein Junge ihre sexuellen Erfahrungen beschreiben. Wir wollten erreichen, dass Jugendliche endlich ohne Scham über freie Liebe, Masturbation und Homosexualität reden konnten. Das Buch kam zunächst wegen angeblicher Pornografie auf den Index, kursierte aber in Raubdrucken, bis das Verbot aufgehoben wurde. Allein in Italien sind bislang zweieinhalb Millionen Exemplare verkauft worden. Das Private ist politisch: Noch immer spricht "Schweine mit Flügeln" viele Jugendliche an. Kein Buch ist so häufig aus Schulbüchereien geklaut worden. Für mich ist das ein guter Rekord. In verschiedenen Generationen machen junge Leute offensichtlich ganz ähnliche Lebenserfahrungen. Politik spielte für uns damals allerdings eine wichtigere Rolle. Eine der ersten Lektionen, die ich lernte, bestand darin, dass das Private politisch ist. Wir haben erkannt, dass sich das Unbehagen des Einzelnen immer in den Erfahrungen eines Kollektivs widerspiegelt. Dieses Wir-Gefühl hat die heutige Jugend verloren. Sicherlich waren wir Linken sehr idealistisch und auch etwas naiv. Wir glaubten an eine bessere Zukunft und kämpften für eine Gesellschaft, in der es gerechter zugehen würde. Meine Kinder haben diese Hoffnung nicht mehr. Sie sehen die Erde auf eine Umweltkatastrophe zusteuern und rechnen damit, dass die globale Armut die kleine, alte Welt der Reichen unter sich erdrücken wird. Anders als wir damals haben die Jugendlichen inzwischen nicht mehr die Illusion, die Welt verändern zu können. Sie haben damit sogar Recht. Dennoch tun sie mir leid, denn ich hatte eine faszinierende Jugend, die mich innerlich gestärkt hat. Heute lebt jeder isoliert für sich, auch das Internet kann keinen echten Zusammenhalt stiften. Wäre die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Italien früher so prekär gewesen wie heute, hätten wir dagegen immer wieder auf der Straße protestiert. Heute denkt jeder zuerst daran, wie ihn persönliche Beziehungen weiterbringen können. Junge Menschen haben aber kaum noch die Chance, sozial höher aufzusteigen als ihre Eltern. Frauen als ewige Teenager: Auch für Frauen hat sich das Blatt nicht zum Besseren gewendet. 1968 hat ihnen nicht automatisch die Gleichberechtigung gebracht. Unsere linken Genossen diktierten uns, was wir schreiben sollten, und ließen uns Flugblätter vervielfältigen. Wir wurden genauso diskriminiert wie vorher auch. An meiner Schule bewerteten die Jungs die Mädchen danach, wer den schönsten Busen und den schönsten Hintern hatte. Nicht ohne Grund ist der Feminismus aus der Achtundsechziger-Bewegung entstanden. Unsere Ziele haben wir bisher jedoch nicht erreicht. In der Gesellschaft haben Frauen nach wie vor eine untergeordnete Rolle. Das beste Beispiel dafür ist die Tatsache, dass wir nicht altern dürfen. Wir haben keinen kulturellen Stellenwert, sondern werden als Teil der Natur betrachtet. Während Männer mit zunehmendem Alter tüchtiger, mächtiger und reicher werden, müssen wir immer so frisch aussehen wie ein Salatkopf. Wir sind gezwungen, unsere Jugend zu konservieren und ewige Teenager zu bleiben. In Italien haben Frauen weiterhin nicht die gleichen beruflichen Chancen wie Männer. In den Vorstandsetagen der Unternehmen und den Chefredaktionen der Zeitungen sind sie kaum vertreten. Frauen, die den Arbeitsmarkt verlassen, um Kinder zu bekommen, kehren entweder gar nicht mehr in den Beruf zurück oder machen keine Karriere. Frauenquoten halte ich für reine Demagogie, denn sie funktionieren nur, wenn auch die Männer damit einverstanden sind. Paarbeziehung reicht nicht mehr: Wir Achtundsechziger können uns also nicht als Gewinner fühlen. Durch unsere Erfahrungen haben wir immerhin gelernt, nach Lösungen zu suchen. Ich bin deshalb gespannt, wie meine Generation mit dem Älterwerden umgehen wird. W.
-
Das Erdbeerfeld. Roman. Aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers. Originaltitel: Het duister dat ons scheidt.
Verlag: München : C. Bertelsmann Verlag, 2005
ISBN 10: 357000824X ISBN 13: 9783570008249
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Erstausgabe
EUR 4,00
Währung umrechnenEUR 3,40 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbZustand: Sehr gut. Deutsche Erstausgabe. 318 (2) Seiten. 22 cm. Sehr guter Zustand. Die Welt ist in Ordnung in der neuen, schmucken niederländischen Siedlung - Natur, Ruhe, friedliche Nachbarschaft. Die Frauen widmen sich der Verschönerung von Haus und Garten, bekommen Kinder, die sie mit aller Liebe umsorgen. Die Männer fahren täglich in die Stadt zur Arbeit, um für das Familienglück finanziell aufzukommen. Doch hinter dem Paradies lauert die Unzufriedenheit der Mütter - heimlich sind sie wütend wegen der vielen Opfer, die sie bringen müssen, um ihren Kindern eine heile Welt zu präsentieren. Nur die Mutter von Loes ist anders. Sie lebt mit ihrer Tochter und zwei skurrilen Männern im alten Pfarrhaus. Sie zeichnet Kinderbücher und lässt die Tochter ein ungebärdiges Kinderleben führen. Doch dann taucht Thomas auf und mit ihm eine gefährliche Vergangenheit. Und eine einzige Nacht verändert alles. Loes wird zur Zielscheibe kindlicher Grausamkeit. Ihre heile Welt zerbricht. Doch kein Erwachsener nennt ihr den Grund. Sie lassen Loes allein. Von dem Umzug auf eine Hebrideninsel verspricht sich ihre Mutter einen Neuanfang. Aber man kann die Vergangenheit nicht einfach abschütteln. Eindringlich erzählt Renate Dorrestein von Loes' Erwachsenwerden und der Suche nach der Wahrheit und dem Ursprung der Schuld. Nach und nach wird das Schweigen gebrochen und das Geheimnis freigelegt, das so viel Schaden angerichtet hat. Erst nun ist ein Neubeginn möglich.Mütterliche Zuwendung, die ins Gegenteil umschlägt, Verdrängung, die Lüge und Schuld gebiert - Renate Dorrestein versteht es, komplexe psychologische Zustände eindringlich und lebensnah zu schildern. Ihr ausgefeilter Stil nimmt den Leser sofort gefangen."Dorrestein gibt ihren Figuren eine enorme Leidenschaft mit. Ihr Überlebensdrang und Mut sind unbegrenzt, ihre Einsamkeit wird dadurch um so stärker fühlbar."De Volkskrant"Es ist absolut bemerkenswert wie gut sich diese Autorin in die Gedanken und Gefühle eines Kindes hineinversetzen kann."De Telegraaf"Renate Dorrestein schreibt einfühlsam und fesselnd."Der Spiegel. - Renate Dorrestein (* 25. Februar 1954 in Amsterdam) ist eine niederländische Autorin, Journalistin und Feministin. Leben: Sie arbeitete beim niederländischen Wochenmagazin Panorama. Der Suizid ihrer Schwester hat einen großen Einfluss auf ihre Bücher. Ihr Bucherfolg aus dem Jahr 2006 Mein Sohn hat ein Sexleben und ich lese meiner Mutter Rotkäppchen vor wurde im Herbst 2009 vom ZDF mit Iris Berben verfilmt. . Aus: wikipedia-Renate_Dorrestein Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 536 Roter Pappband ohne Schutzumschlag.
-
Titos Brille. Die Geschichte meiner strapaziösen Familie.
Verlag: Köln : Kiepenheuer & Witsch Verlag, 2011
ISBN 10: 3596193044 ISBN 13: 9783596193042
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Erstausgabe
EUR 5,60
Währung umrechnenEUR 3,40 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbZustand: Wie neu. Erstausgabe. 263 (9) Seiten. 20,9 cm. Umschlaggestaltung: Rudolf Linn. Sehr guter Zustand. Adriana Altaras führt ein ganz normal chaotisches und unorthodoxes Leben in Berlin: mit zwei fußballbegeisterten Söhnen, einem westfälischen Ehemann, der ihre jüdischen Neurosen stoisch erträgt, und mit einem ewig nörgelnden, stets liebeskranken Freund. Alles bestens also . bis ihre Eltern sterben und sie eine Wohnung erbt, die seit 40 Jahren nicht mehr ausgemistet wurde. Fassungslos kämpft sich die Erzählerin durch kuriose Hinterlassenschaften, bewegende Briefe und uralte Fotos. Dabei kommen nicht nur turbulente Familiengeheimnisse ans Tageslicht, auch die Toten reden von nun an mit und erzählen ihre eigenen Geschichten. - Adriana Altaras (* 6. April 1960 in Zagreb, SFR Jugoslawien) ist eine deutsche Schauspielerin und Theaterregisseurin. Leben: Adriana Altaras ist die Tochter ehemaliger jüdischer Partisanen aus dem heutigen Kroatien, Jakob Altaras und Thea Altaras. Der Vater setzte sich 1964 ins Ausland ab, die Familie sollte nachkommen. Die Behörden entzogen jedoch der Mutter den Pass. Familienmitglieder aus Mantua schmuggelten daraufhin die vierjährige Tochter aus dem Land. Drei Jahre lang lebte sie bei Tante und Onkel in Italien. 1967 kam Adriana mit den Eltern in Gießen zusammen. Sie besuchte die Waldorfschule in Marburg und studierte nach dem Abitur Schauspiel an der Hochschule der Künste (HdK) in Berlin. Nach einem Studienaufenthalt in New York City war sie Mitgründerin des freien Theaters zum westlichen Stadthirschen, wo sie neben der Schauspielerei auch als Regisseurin und Autorin tätig sein konnte. Gastengagements erhielt sie als Schauspielerin am Maxim-Gorki-Theater und an der Freien Volksbühne in Berlin, sowie in Stuttgart, Konstanz und Basel. Anfang der 1980er Jahre erhielt sie erste Filmrollen, dennoch lag der Schwerpunkt ihrer Arbeit weiterhin bei den unterschiedlichen Theaterprojekten. Nach Regiearbeiten am Berliner Ensemble und der Neuköllner Oper sorgte ihre Inszenierung der Vagina-Monologe für großen Erfolg, die mit wechselnden Schauspielerinnen 2001 in Berlin zu sehen war. Im Kino war sie vor allem in Filmen von Rudolf Thome zu sehen, mit dem sie seit den 1980er Jahren zusammenarbeitete. 1988 erhielt sie für ihre Rolle in Thomes Film Das Mikroskop den Deutschen Filmpreis. Neben der Theater- und Filmarbeit war sie für Steven Spielbergs Shoah Foundation als Interviewerin tätig und als Dozentin an der HdK im Bereich Musicaldarstellung. Sie schreibt regelmäßig in Zeit Online in der Kategorie Freitext, unter anderem im Mai 2016 Ausflug ins Land der Dichter und Henker. Regina Schilling drehte nach der Buchvorlage von Adriana Altaras über sie den Film Titos Brille (2014), in dem sie auf der Suche nach ihrer familiären Vergangenheit durch ihre kroatische Heimat reist. Sie hat zusammen mit dem Komponisten Wolfgang Böhmer zwei Söhne, darunter Aaron Altaras. . Aus: wikipedia-Adriana_Altaras. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 258 Zweifarbiger Pappband ohne Schutzumschlag.
-
Ein rundherum tolles Land. Erinnerungen. Aus dem Englischen von Rudolf Hermstein.
Verlag: München : Luchterhand Verlag, 1999
ISBN 10: 3630870341 ISBN 13: 9783630870342
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Erstausgabe
EUR 6,00
Währung umrechnenEUR 3,40 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbZustand: Gut. Deutsche Erstausgabe. 487 (9) Seiten. 21,9 cm. Umschlaggestaltung: R.M.E. Roland Eschlbeck. Sehr guter Zustand. Schutzumschlag mit Tesa ausgebessert. Die Fortsetzung von Frank McCourts Lebenserinnerungen. Sie beginnt dort, wo der erste Teil endet, auf einem irischen Schiff vor der Skyline von New York, und der Funkoffizier fragt den neunzehnjährigen Frank: Ist das hier nicht ein rundherum tolles Land? Frank McCourts Freunde kennen das Geheimnis seines Erfolgs, hören sie ihm doch ganze Nächte lang zu und können nicht genug kriegen. Er ist ein wahrer irischer Geschichtenerzähler, ein »seanachie«, für den eine Geschichte erst dann gut erzählt ist, wenn die Leute nicht wissen, ob sie lachen oder weinen sollen. Als er mit neunzehn Jahren von Irland nach Amerika geht, hat er nichts außer der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Arm, mit schlechten Zähnen und entzündeten Augen, ohne jede nennenswerte Ausbildung, erreicht er das Land seiner Träume und muß feststellen, daß er mit seinem Aussehen und seinem Akzent ein Nichts ist. Mit Hilfe eines gar nicht frommen katholischen Priesters, der demokratischen Partei und der US Army gelingt es ihm jedoch, sich im Land der Schönen und Reichen zu behaupten, auch wenn die Stationen seines Werdegangs recht ungewöhnlich sind: Hoteldiener, Hafenarbeiter, Soldat, nicht im Korea-Krieg, sondern in Bad Tölz, einer Kleinstadt in Bayern, wo er vom Hundeabrichter zum Materialverwalter (Zuteilung von Decken, Kissen, Kondomen) aufsteigt Trotz aller Widrigkeiten wird er High-School-Lehrer dank der GI-Bill, seiner Liebe zur Literatur und seines unverwüstlichen Humors , gründet eine Familie und holt seine Mutter und seine Brüder aus Limerick nach. Ende gut, alles gut? Seine Frau ist eine Protestantin, abends zieht er durch die irischen Kneipen der Stadt und erzählt Anekdoten aus seinem Leben, und auch nach Limerick kommt er noch einmal: um dort die Asche seiner Mutter auf die Gräber der Familie zu streuen Frank McCourts zweiter Erinnerungsband über die Jahre in Amerika steckt voll der unglaublichsten Geschichten über Priester und Jungfrauen, über irische Kneipen, bayerische Bierkellerund die merkwürdigen Sitten der Amerikaner im allgemeinen, geschildert mit Frank McCourts unnachahmlicher Mischung aus Traurigkeit und Witz. - Francis Frank" McCourt (* 19. August 1930 in Brooklyn, New York City; 19. Juli 2009 ebenda) war ein US-amerikanischer Schriftsteller irischer Abstammung. Leben: Frank McCourt wurde als ältester Sohn einer irischen Einwandererfamilie in Brooklyn, New York geboren. Als er vier Jahre alt war, kehrte seine Familie nach Irland zurück, da seine Eltern aufgrund der Großen Depression in New York keine Arbeit fanden. McCourt verbrachte den Rest seiner Kindheit und Jugend in ärmlichen Verhältnissen im katholisch geprägten Limerick. Sein Vater Malachy war arbeitslos und vertrank häufig das Stempelgeld. Als Frank McCourt zehn Jahre alt war, ging der Vater nach England, um dort in einer Fabrik zu arbeiten. Geld schickte er nicht, so musste Frank McCourt zusammen mit seiner Mutter Angela für die jüngeren Geschwister Malachy McCourt, Michael und Alphey sorgen. 1949 hatte er sich den Traum seiner Jugend zusammengespart: Die Fahrkarte zurück nach New York. Dort arbeitete er zunächst im Biltmore Hotel und ging dann zur Armee. Als Korporal war er drei Jahre lang in Bayern stationiert. Nach seiner Heimkehr studierte er in New York und arbeitete nebenbei in Lagerhäusern und auf den Docks, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Nach dem Ende seines Studiums unterrichtete er an verschiedenen Schulen als Englischlehrer. Zuletzt war er 15 Jahre an der renommierten Stuyvesant High School in New York. Dort unterrichtete er vor allem kreatives Schreiben. Frank McCourt war zweimal verheiratet, seine Tochter Margaret stammt aus erster Ehe. Im Ruhestand verarbeitete Frank McCourt seine schwierige Kindheit und Jugend in dem autobiografischen Roman Die Asche meiner Mutter (1996). Das Buch wurde mit über 6 Mio. Exemplaren zum internationalen Bestseller und brachte seinem Autor 1996 den National Book Critics Circle Award und 1997 den Pulitzer-Preis. Der Roman wurde 1999 von Alan Parker verfilmt. In Ein rundherum tolles Land erzählt Frank McCourt seine Erlebnisse seit der Rückkehr nach New York. Im dritten Teil seiner Memoiren, Tag und Nacht und auch im Sommer, schildert Frank McCourt sein Berufsleben als Lehrer mit teils sehr problematischen Klassen. Am 19. Juli 2009 verstarb er in einem Hospiz in Manhattan, New York, an einer durch Hautkrebs hervorgerufenen Meningitis. . . . Aus: wikipedia-Frank_McCourt. -- Rudolf Hermstein, geb. 1940, studierte Sprachen in Germersheim und ist der Übersetzer von u.a. William Faulkner, Allan Gurganus, Doris Lessing, Robert M. Pirsig und Gore Vidal. Er wurde mit dem Literaturstipendium der Stadt München sowie mehrfach mit Stipendien des Deutschen Übersetzerfonds ausgezeichnet. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 785 Brauner Pappband mit farbigen Vorsätzen, weißgeprägten Rückentiteln, Lesebändchen und Schutzumschlag.
-
Hoefische Reglements und Lustbarkeiten: Die Besuche von Caroline Mathilde und Christian VII. in Hamburg und Holstein 1766-1772 (Historie).
Anbieter: ANTIQUARIAT Franke BRUDDENBOOKS, Lübeck, Deutschland
Erstausgabe
EUR 17,00
Währung umrechnenEUR 3,55 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbGebundene Ausgabe, Quer Gr.8°. Zustand: Sehr gut. 1.,. 108 S. Das Buch ist in sehr gutem, sauberen Zustand. Gebundenes Buch mit Original-Schutzumschlag. Dieser mit leichten Randläsuren. Besitzvermerk mit zartem Bleistift auf Vorsatz. Sonst sauberes und wohlerhaltenes Exemplar. -----Inhalt:. Zahllose Abbildungen aus vielen Quellen (zumeist europäische Adelshäuser), die in dieser Form zusammen noch nicht veröffentlicht wurden. 'In Celle habe ich die Königin von Dänemarck speißen sehen' Ein Besuch in der alten Residenzstadt Celle von Mathias Hattendorff Die Neugier, eine berühmte Person der Zeitgeschichte aus nächster Nähe zu sehen, führte den Göttinger Schriftsteller und Mathematikprofessor Georg Christoph Lichtenberg am 12. Mai 1773 nach Celle. Noch am selben Abend gelangte er durch Vermittlung seines Wirtes ins Schloss, wo ihn der Hausknecht in den Speisesaal führte. Königin Caroline Mathilde war gerade dabei, ihr Souper einzunehmen. 'Dort die dicke Dame, grade gegen uns über, in dem blauen Kleide ist die Königin, sagte der Hausknecht, indem sein Zeigefinger seinen Weg nach der Königin durch meine rechte Locke nahm, daß ich fast böß geworden wäre. Halt er das Maul, ich sehe sie schon lange, antwortete ich bloß.' Die königliche Tafel bestand aus 10 Personen, die Anzahl der Zuschauer, die sich am Eingang des Saals aufhielten, belief sich auf etwa 30, darunter diverse Dienstmädchen, Handwerksburschen sowie Lichtenberg und sein Diener. Über eine halbe Stunde schaute Lichtenberg dem Essen zu: 'Die Königin ist nicht sehr groß, dabey recht, was man ausgestopft nennt, alles ist dick, doch ohne in das schmalzigte Forstmeistermäßige zu fallen. Ihre Mine ist nicht gantz frey, und aus ihren Augen leuchtet, zumal so bald sie aufhört zu lächeln, etwas trotziges bey vielem Feuer hervor. Ihre Gesichtsfarbe ist gesund aber mehr blaß als roth, und ihr Gesicht überhaupt nicht was man schön nennt. Man sieht ihr, meiner Meinung nach, Muth und Entschlossenheit an, den sie auch würklich bey ihrer Arretirung gezeigt hat. Sie aß mit großem Appetit, und hörte dem was gesprochen wurde mit vieler Aufmercksamkeit zu, ohne selbst viel zu sprechen. Wenn sie nur eine Hand bey dem Essen brauchte, so legte sie sich gantz nachlässig mit dem andern Arm über den Tisch. Sie lachte einmal gantz laut, über etwas das eine alte Dame auf frantzösisch sagte. Ich habe es nicht verstanden, ob ich sonst gleich Spässe und frantzösisch verstehe.' Im letzten Jahr würdigte eine Sonderausstellung in eben diesem Schloss die Königin, die 1751 in London geboren wurde, mit 15 Jahren mit dem kranken Christian VII. von Dänemark verheiratet, dann 1772 nach der Liebesaffäre mit dem Leibarzt des Königs und Reformer Struensee geschieden und nach Intervention ihres Bruders, des britischen Königs und Kurfürsten von Hannover, nach Celle umgesiedelt wurde, wo sie bereits 1775 starb. Etliche Exponate sind an die Leihgeber zurückgewandert, doch die 'Sahnestücke' aus den hauseigenen Beständen laden nach wie vor dazu ein, sich in historischer Atmosphäre nicht nur mit der dänischen Hofgeschichte jener Jahre zu befassen, sondern auch mit dem kurzen Leben der Königin in Celle. Die zu diesem Themenkomplex ausgestellten Exponate kann der Besucher ebenso wie die in den angrenzenden Räumlichkeiten eingerichtete landesgeschichtliche Abteilung (Geschichte des Königreichs Hannover) und die einzigartigen Miniaturmalereien aus der Sammlung Tansey sich allein anschauen. Die übrigen Räume, darunter das Schlafzimmer des letzten Celler Herzogs Georg Wilhelm und seiner morganatischen Ehefrau Eleonore d'Olbreuse, sind nur mit einer Führung zugänglich. Hier erfährt man Einschlägiges über Macht- und Heiratspolitik im Welfenhaus des 17. und 18. Jahrhunderts. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Tochter des Herzogspaares, Sophie Dorothea, die mit ihrem Vetter, dem kurhannoverschen Kurprinzen verheiratet wurde und die 1695 nach der Königsmarckaffäre als für den Rest ihres langen Lebens in tiefste Provinz verbannte 'Prinzessin von Ahlden' traurige Berühmtheit erlangte (und seither mit ihrer Urenkelin Caroline Mathilde um den Platz der tragischsten Frau im Welfenhaus konkurriert). Bezeichenderweise hat ihr Ex-Mann, der spätere Georg I., in Celle bis zum heutigen Tage den Ruf einer grobschlächtigen, ungehobelten Dumpfbacke, während er in Großbritannien schon lange als erfahrener Soldat, Staatsmann und als kluger Monarch gewürdigt wird. Ein schönes Beispiel für die in Celle immer noch wirkende antihannoversche Hetzpropaganda der Tories nach 1714! Vielleicht hat man hier auch nie so ganz verwunden, dass das größere Fürstentum Lüneburg (mit der Residenz Celle) 1705 im Erbgang an das kleine (allerdings politisch einflussreiche) Kurhannover fiel. Auch wer sich weniger für die Geschichte des Welfenhauses begeistern kann, sollte an dem Rundgang teilnehmen, denn nur so kommt man in den Genuss, das Schlosstheater zu sehen, bei dem es sich um das älteste bespielte Theater der Barockzeit in Deutschland (1674) handelt es sei denn, man besucht eine der abendlichen Aufführungen. Und auch nur mit Führung gelangt man, ein wirklicher Höhepunkt, in die wunderbare Schlosskapelle, die eine einheitliche Renaissanceausstattung aufweist. Ein Kleinod ersten Ranges. Wem die historischen Eindrücke noch nicht reichen, der kann sich im gegenüberliegenden Bomann-Museum, dem drittgrößten Museum Niedersachsens, in ländliche Wohnkultur der Südheide oder in die Celler Stadtgeschichte vertiefen, oder er beschränkt seinen Besuch auf die Ausstellungen zeitgenössischer Kunst, die u.a. im angegliederten Neubau gezeigt werden, der etwas hochtrabend als 'das erste 24-Stunden-Kunstmuseum der Welt' vermarktet wird. Weitere empfehlenswerte Sehenswürdigkeiten sind die Stadtkirche, in der sich auch die Grabdenkmäler diverser welfischer Herzöge bzw. Herzöginnen befinden; die nur zu bestimmten Zeiten zugängliche Gruft enthält u.a. den prächtigen Sarkophag von Caroline Mathilde und den schmucklosen Sarg von Sophie Dorothea. Lohnenswert ist der Blick auf die illusionistischen Fa.
-
Portrait meiner Mutter mit Geistern. Roman. Mit Quellenangaben.
Verlag: München : C.H. Beck Verlag [2025]., 2025
ISBN 10: 3406829716 ISBN 13: 9783406829710
Sprache: Deutsch
Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland
Erstausgabe
EUR 22,00
Währung umrechnenEUR 3,40 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbZustand: Wie neu. Erstausgabe. 395 (5) Seiten. 22,1 x 14,4 cm. Umschlaggestaltung: buxdesign. Lesetipp des Bouquinisten! Sehr guter Zustand. Frisches Exemplar. Wie ungelesen. Allein schon der Titel ist eine Vorbeugung von den beiden Künsten, der Literatur und der Fotografie. Ein großer Roman." ARD, ZDF & 3sat auf der Leipziger Buchmesse, Alexander Solloch. Ein Name ist nicht viel aber manchmal ist er alles, was wir haben. Rabea Edels Roman umspannt Jahrzehnte und verknüpft Zeitgeschichte mit persönlichem Schicksal. Im Mittelpunkt: eine unangepasste Frau, flirrend, poetisch und mutig, die isch entscheidet, dem scheinbar Vorherbestimmten etwas Eigenes entgegenzusetzen. Raisa lebt allein mit ihrer Mutter Martha und das schon immer. An ihren Vater hat sie keine Erinnerungen. Ihr Name ist das Einzige, was sie von ihm bekommen hat besser so, sagt Martha. Doch Raisa beginnt, Fragen zu stellen. Als der Nachbarsjunge Mat verschwindet, beginnt Martha zu erzählen. Von der Großmutter Dina. Von Lügen, die schützen, und Lügen, die in Gefahr bringen. Von der Liebe ihres Lebens und ihrem größten Verlust. Rabea Edel zeichnet in ihrem Buch die bewegende Lebensgeschichte ihrer Mutter und das Portrait einer Nachkriegsgeneration, die im Schatten der Gewalt und des Schweigens aufgewachsen ist. Sie erzählt von der Kraft der Liebe und von der Rückeroberung der eigenen Geschichte durch die Sprache. Ein Buch wie ein Kaleidoskop, das vor allem die Frauen in den Blick nimmt und die weibliche Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden. "Es liegt eine Art Trost in Edels Sprache, in der Zurückhaltung, mit der sie erzählt. Eine wahre Bereicherung." Haaretz. Drei Generationen von Frauen, die ohne Väter aufwachsen Eine Tochter, die den Zirkel des Schweigens durchbricht Der neue Roman der vielfach ausgezeichneten Autorin. "Rabea Edel beschreibt in überraschenden Bildern das Entgleisen der Gefühle. Durch verblüffende Dialoge und Porträts gelingt ihr ein Roman über die Abhärtung gegen das Glück." Herta Müller über "Das Wasser, in dem wir schlafen". - Rabea Edel (* 31. Juli 1982 in Bremerhaven ist eine deutsche Schriftstellerin und Fotografin. Leben: Edel wuchs in Cuxhaven auf. Sie studierte in Berlin und Siena Italianistik und Literaturwissenschaften. Danach folgte ein Studium der Fotografie an der Berliner Ostkreuzschule. Ihr Debütroman Das Wasser, in dem wir schlafen erschien 2006. Sie lebt als freie Autorin und Fotografin in Berlin und an der Mosel. Ihr zweiter Roman Ein dunkler Moment erschien im Frühjahr 2011 im Luchterhand Literaturverlag. Im Dezember 2021 erschien ihr fotografisches Kunstbuch A Second Beating Heart im Verlag Shift Books. Im Januar 2025 erschien bei C.H.Beck ihr dritter Roman Portrait meiner Mutter mit Geistern. Seit Dezember 2022 ist sie Mitglied im PEN Berlin. . . . Aus: wikipedia-Rabea_Edel. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 625 Altrosa Pappband mit einer Stammtafel auf den Vorsätzen, schwarz- und weißgeprägten Rückentiteln, Lesebändchen und Schutzumschlag.
-
Vorphila-Brief BRIEF BERLIN 1852: Kfm. August STERNEBERG (1809-1895) an Mutter
Verlag: Berlin, 1852
Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert
EUR 35,00
Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Gut. 1. Auflage. Vorphila-Brief von 1852 aus Berlin. --- Der Kaufmann August Sterneberg (1809-1895), der zu Besuch bei seinem Bruder, dem Schriftsteller und Arzt Dr. Johann Wilhelm Sterneberg (1807-1888) ist, schreibt an seine Mutter, die Witwe Johann Sterneberg, geb. Hueffer (1783-1860) in Münster, Tochter des Professors Christian Hueffer aus Stromberg. Diese ist in den Münsteraner Adressbüchern fälschlich als Witwe Johanna Sternberg verzeichnet. --- August Sterneberg war ein Sohn des Kaufmanns Franz Joseph Anton Sterneberg (1771-1817) und wurde am 1. Mai 1809 in Münster geboren. Später kehrte er nach Nürnberg zurück, wo er 7. Dezember 1895 starb. --- Datiert Berlin, den 9. November 1852. --- Er erwähnt eine geplante Reise nach New York. --- Im Brief erwähnt er eine unglückliche Liebe zu seiner Cousine Julie (Wilde?) aus Münster; dabei handelt es sich wohl nicht um seine verstorbene Ehefrau. --- Auszüge: "Liebe Mama! Schon von Cöln aus [.] beabsichtigte ich, Dir die Begebenheit mitzutheilen, welche mich plötzlich, wie im Sturm, aus meinen früheren Verhältnissen gerissen und mir eine neue Laufbahn angewiesen hat [.]. Ungern rife ich die Geschichte meines Leidens in's Andenken zurück, denn es kostet mich jedesmal nicht wenig Mühe, die verschiedenen Gefühle, die dann mit Kraft wieder aufwallen, zu dämpfen, doch ich bin es, Dir liebe Mama, schuldig. [.] Der Ausbruch einer unglücklich Neigung zu der lieben Julie, die nicht weniger erwidert wurde, machte den Anfang und das Ende meiner Katastrophe. Seit ich zum erstenmale sie noch ein Kind erblickte, gewann sie mein Herz, und der stete ungehinderte Umgang mit ihr nährte die Neigung so sehr, daß ich nach zwey Jahren mich [.] unglücklich fand, als Tante, aufmerksam geworden oder gemacht, mit der Erklärung dazwischentrat, daß sie, so willkommen ich ihr übrigens als Schwiegersohn seyn würde, der nahen Verwandtschaft halber darauf dringen müsse, daß ich meine Neigung unterdrücke, da sie so viele Beyspiele unglücklicher Verbindungen damals gesehen, und ihr Kind nicht preisgeben könne. Glaubend, ohne den Gehalt dieses Grundes zu prüfen, entsagte ich aufrichtig, indem ich die Sorge der Mutter, die schon zwey Kinder veloren, ehrte." --- Dann berichtet er, wie er Julie am 15. Oktober 1852 zuerst bei einem Ball und dann bei einem Gastmahl zu Ehren seines Bruders wiedersieht und neu für sie entflammt; sie sagt, dass sie die seine werden möchte. "Aber nur kurz währte die Freude; schon am anderen Tag entstand ein unseliges Mißverständniß durch einen förmlichen Liebesbrief von Eduard Hüffer, das sich zwar zu meiner völligen Genugthuung auflöste, aber leider alles ans Licht brachte [.]. Ich kann nur schweigen oder toben. Blos ein Fingerzeig: erinnere Dich der Aeußerung meiner damaligen Ansicht über Onkel Wilde und Halb-Bruder Jodocus. [.] O des Glückes, gute Geschwister zu haben! [.] so bin ich jetzt in Berlin beim lieben Bruder Wilhelm und werde Pepe auf der Leipziger Neujahrsmesse treffen; von da reise ich nach Hamburg, dann nach Bremen, von wo ich bey guter Jahreszeit nach Newyork oder Baltimore unter Segel gehe [.]. Ich verbleibe mit herzlichster Liebe Dein Sohn August." --- Umfang: drei Textseiten und eine Adressseite (26,3 x 22 cm). --- Format (zusammengefaltet): 8,3 x 12,5 cm. --- Anm.: Auf der ancestry-Website ist der Verfasser in einem privat angelegten Stammbauim verzeichnet. Demnach hatte er 1850 Eleanor Jessie, geb. Hallett (geb. 14. November 1814 in London) geheiratat, die am 29. Juli 1852 in New York nach der Geburt ihrer Tochter Emma Sterneberg gestorben war. Die Tochter Emma Sterneberg ging später zurück nach Deutschland und starb dort am 23. Dezember 1910. --- Diese Angaben erscheinen unwahrscheinlich; generell sind Angaben aus privaten Stammbäumen mit Vorsicht zu genießen. . Zustand: Dünnes Papier etwas fleckig, mit kleinen Einrissen in der Falz. Signatur des Verfassers.
-
ADEL: Briefe Schloss KARLSLUST (NÖ) 1966-68, Maria-Christiane von WALDSTEIN
Verlag: Schloss Karlslust, 1966
Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert
EUR 35,00
Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Befriedigend. 1. Auflage. Fünf Adelsbriefe von 1966-1968. --- Die meisten Briefe geschrieben auf Schloss Karlslust (Niederösterreich). --- Geschrieben von Maria-Christiane "Idi" Gräfin von Waldstein (* 2. Juli 1936 in Wien; gest. 1989), Tochter von Eugen Graf von Waldstein-Forni (1905-1967) und der Marie Elisabeth Christiane Wilhelmine Antonia Kunegonde, geb. Prinzessin von Cro (1905-1971). 1977 heiratete sie Egmont Erich Prinz von Thurn und Taxis (1939-2023). --- Erwähnt ist ihre Schwester Juliane von Altenburg, geb. Gräfin von Waldstein-Wartenberg-Forni (* 22. Mai 1940 in Buchberg am Kemp), Ehemann von Peter von Altenburg. Da ihre Eltern keine weitere Tochter hatten, muss es sich bei "Idi" um Maria-Christiane handeln, auch wenn ich diesen Spitznamen bei ihr nicht nachweisen konnte. --- Erwähnt ist auch der Tod ihres Vaters, der am 11. Oktober 1967 in Karlslust starb: "Vom Heimgang unseres geliebten Vaters wirst Du wahrscheinlich schon gehört haben." --- Gerichtet an eine Freundin namens Clara, d.i. die Gräfin Clara Ledóchowska (* 26. Juni 1911 in Sarns), Sekretärin bei der österreichischen Botschaft am Heiligen Stuhl (Vatikan). --- Meist nur mit "Idi" signiert; nur einmal "Idi Waldstein." --- Auszüge: --- Karlslust, 7. März 1966: "Sehr verehrte liebe Clara! [.] wir alle hoffen [.], daß Dein Urlaub bei uns auch wirklich gelingen möge!! [.] Eben sagt mir Mutter, daß Sie Dir ausrichten läßt, daß wir im Prinzip noch weitere Paying Guests für diesen Sommer suchen [.], da ab Mitte July das ganze Schloß für Gäste zur Verfügung steht. [.] Liebe Clara, nun sind bald 2 Wochen seit meiner Rückkehr aus Rom vergangen [.]." --- München, 4. Februar 1968: "Vom Heimgang unseres geliebten Vaters wirst Du wahrscheinlich schon gehört haben." [.] Hast Du sehr viel Arbeit auf der Botschaft? Besonders viel Liebes mit herzlicher Umarmung von Deiner dankbaren Idi Waldstein." --- Karlslust, 14. März 1968: "[.] ob ich ev. für 10 Tage nach Rom und wenn es Dir noch recht ist, bei Dir 'einfallen' darf? [.] Mutter und den Brüdern geht es Gott Lob gut." --- Karlslust, 15. Mai 1968: "Höchst wahrscheinlich werden ab Mitte Juli auch Tante Jelly und Onkel Max Attems hier sein und auch meine Schwester Juni mit ihrem Mann Peter Altenburg." --- Brief aus dem Urlaub von einer Insel ("Canaren"?), nur auf "Sonntag datiert): "Um 18 Uhr fuhr ich auf den Hafen. Dort hat bereits die Signora gewartet. Um 20.00 fuhren wir bei prachtvollem Sonnenuntergang aus Neapel weg. [.] Den nächsten Tag landeten wir bei prachts Wetter um 10.00 auf der Insel. Das ganze Dorf war auf den Beinen, um die Signora zu begrüßen. Sie ist so bissl die ungekrönte Königin von der Insel." --- Jeweils ohne Umschlag. --- Zustand: Papier leicht gebräunt. --- Über das Schloss Karlslust (Quelle: wikipedia): Schloss Karlslust liegt im niederösterreichischen Waldviertel, nördlich der Straße von Niederfladnitz nach Mitterretzbach nahe der tschechischen Grenze, und ist für Besucher nicht zugänglich. Geschichte: Mit dem Aussterben der Familie Trautson ging die Herrschaft Kaja als Erbschaft an Karl Josef Fürst Auersperg über. 1795 war Baubeginn von Schloss Karlslust in dessen Jagdrevier, Baumeister war Franz Xaver Pollnfürst aus Wien. Nach der baulichen Fertigstellung des Schlosses wurde im Jahr 1798 ein Wildpark angelegt, der das Schloss umgibt. Die Fertigstellung der Innenausstattung erfolgte im Jahr 1801. Als Innenarchitekt könnte Heinrich Fischer tätig gewesen sein, der auch im Wiener Stadtpalais tätig war. Die Stuckaturarbeiten stammen von Johann Georg Böhm. Obwohl das Schloss einsam und abgelegen im Wald liegt, wurden die Herrschaftsverwaltung und das zugehörige Archiv von Schloss Niederfladnitz hierher verlegt. Nach dem Aussterben eines männlichen Zweigs der Familie Auersperg-Trautson ging die Herrschaft durch Erbschaft zunächst auf die Herzöge von Cro , dann ab 1945 in den Besitz der Grafen von Waldstein-Wartenberg über. Signatur des Verfassers.
-
3 Dokumente BERLIN-Spandau 1922/23, Frauenarzt Adolf BUTTERMANN, Schwester WANKE
Verlag: Berlin, 1922
Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert
EUR 35,00
Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Gut. 1. Auflage. Drei Dokumente von 1922 und 1923 aus Spandau und Berlin. --- Bezogen auf den Frauenarzt Dr. Adolf Buttermann, Mitinhaber der "Privatklinik Dr. Buttermann Dr. Gontermann", Spandau, Friedrichstr. 3 (der andere Inhaber war der Chirurg Carl Gontermann), sowie auf Hildegard Wanke, die dort als 2. Stationsschwester gearbeitet hatte. --- Adolf Buttermann aus Fürstenberg in Mecklenburg legte seine Dissertion 1902 in Greifswald ab ("Über den Einfluss von Nierenerkrankungen auf den Blutdruck"); Carl Gontermann 1903 in Berlin ("Experimentelle Untersuchungen über die Ab- oder Zunahme der Keime in einer accidentellen Wunde unter rein aseptischer trockner und antiseptischer feuchter Behandlung. Aus der chirurg. Universitätsklinik Sr. Excellenz des Herrn Geheimrath von Bergmann"). --- Hildegard Emilie Amalie Wanke wurde am 7. Januar 1897 in Rummelsburg in Pommern (heute: Miastko in Polen) als Tochter des praktischen Arztes Dr. med. Richard Wanke geboren (später Medizinalrat in Belgard an der Persante). Am 10. Juli 1923 heiratete in Belgard den praktischen Arzt Dr. med. Friedrich Wilhelm Timm (* 14. Oktober 1891 in Bohlsen, Kreis Uelzen), wohnhaft in Uelzen, wo er am 31. Oktober 1942 starb. Er war der Sohn von Johann Friedrich Wilhelm Timm (* 20. Januar 1852 in Bohlsen, Gerdau; gest. am 30. Oktober 1922 ebd. (Quelle: Heiratsurkunde auf der ancestry-Website und Stammbaum auf wikitree.) --- 1.) Handschriftlicher Brief von Dr. Buttermann an den Vater von Hildegard Wanke, datiert Spandau, den 2. Januar 1922. --- Umfang: knapp zwei von vier Seiten beschrieben (17,5 x 14,2 cm); ohne Umschlag. --- Auszüge: Sehr geehrter Herr Med. Rat! Zur Verlobung Ihrer Tochter Hildegard mit meinem früheren Assistenten Dr. Timm spreche ich Ihnen und Ihrer Gattin zugleich im Namen meiner Frau unsere besten Glückwünsche aus. Soweit ich das junge Paar kenne, glaube ich, daß Ihre Tochter für Herrn Dr. Timm die richtige Frau sein wird; denn dieser braucht bei seiner Schwerblütigkeit und nicht sehr ausgeprägten Initiative eine tüchtige und energische Frau, die nicht nur als Hausfrau wirkt sondern auch die Praxis mit überwacht." Signiert "Ihr ergebenster Dr. Buttermann." 2.) Maschinenschriftliches Zeugnis (16,3 x 21 cm) der Privatklinik Dr. Buttermann Dr. Gontermann für Hildegard Wanke; signiert von beiden Inhabern. Datiert Spandau, den 1. April 1923. 3.) Bescheinigung (16,5 x 20,8 cm) des Einwohnermeldeamts Berlin vom 18. Juni 1923, dass Hildegard Wanke vom vom 2. August 1922 bis 31. Januar 1923 bei Buttermann gewohnt hat. Im Auftrag signiert vom Polizeisekretär Heinrich Churs. Aus der Inflationszeit; mit seltener Quittungsmarke über 300 Mark ("Einwohnermeldeamt Berlin, Quittung über 300 Mark Abfertigungsgebühr"). Zustand: Dokumente gefaltet; Papier gebräunt, der Brief fleckig. Signatur des Verfassers.
-
Gesangslehrerin Pauline NOWACK (1822-1889): Briefe WARNEMÜNDE 1875 & 1886 Urlaub
Verlag: Warnemünde, 1875
Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert
EUR 35,00
Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Gut. Ohne Schutzumschlag. 1. Auflage. Zwei Briefe von 1875 und 1886 aus Warnemünde (geschrieben aus dem Urlaub). --- Verfasst von der Berliner Gesangslehrerin Pauline Nowack (1822-1889), der Franz von Holstein (1826-1878) seinen Liederzyklus "Fünf Lieder für eine mittlere Stimme mit Begleitung des Pianoforte" (op. 16) gewidmet hatte. --- Gerichtet an Marie von Dechend (1855-1917) in Berlin, Tochter des Reichsbank-Präsidenten Hermann von Dechend (1814-1890). 1884 heiratete sie den Berliner Landrichter Heinrich Georg Althaus (1845-1894). --- 1.) 4-seitiger Brief (22 x 14,3 cm), datiert Warnemünde, den 14. August 1875. Pauline Nowack macht dort Urlaub mit ihrer Mutter Auguste Nowack, geb. Clemens (1800-1884). --- Beileidsbrief zum Todestag von Maries Schwester Clara Wichelhaus, geb. von Dechend (1853-1874), Ehefrau des Chemikers Hermann Wichelhaus (1842-1927), die in ihren Flitterwochen am 14. August 1874 im Vierwaldstättersee bei Luzern in einem Sturm ertrank, als ihr Boot umkippte. --- Auszüge: "Liebe Marie! Die schmerzliche Erinnerung, die sich an den heutigen Tag knüpft, beschäftigt mich so ausschließlich, daß ich um so lieber an Sie schreibe, um auch, außer zu meiner Mutter, davon reden zu können! auch ist es mir Bedürfniß, Ihnen zu sagen, wie wir mit Ihnen fühlen! Die Zeit wird darin nichts ändern; wen man so geliebt hat, wie ich Ihr Klärchen, den betrauert man ewig. Sie können es kaum so ahnen, liebe Frl. Marie, wie vertrauensvoll sie in der letzten Zeit zu mir stand; es that auch unserem Singen keinen Abbruch, sondern im Gegentheil, man lebte sich zusammen ein und verstand sich besser. Das ist alles dahin, und wenn ich klage, was sollen Sie und der Eine, der ihre volle Liebe besaß, erst sagen? [.] Wir sind [.] am 1. August hier eingetroffen und befinden uns in der pension Hübner außerordentlich wohl. Das Haus ist seiner schönen Lage wegen, jedem anderen vorzuziehen; es liegt dem Bade zunächst, an der Düne [.], und von unsern Fenstern aus liegt das Meer weit ausgebreitet vor uns, so daß wir in jedem Augenblick die köstliche Luft genießen. Die Gesellschaft läßt zu wünschen viel übrig. [.] Nachmittags ist Musik im pavillon, der auch dicht am Meere liegt; ich ziehe jedoch die der Wellen vor [.], Gesungen habe ich hier noch nicht; der Flügel im Salon lockt mich wohl, weniger aber die steten Zuhörer [.]. Wie mag es mit Ihrem Singen sein, liebe Frl. Marie? [.] Ihre treue Pauline Nowack." --- 2.) 4-seitiger Brief (17,5 x 11,2 cm), datiert Warnemünde, den 29. August 1886. -- Zwar ohne Jahresangabe, geschrieben aber im Jahr 1886, da zur Geburt eines Kindes gratuliert wird und Maries Sohn Karl Althaus (1886-1956), später Anwalt in Perleberg, ihr einziges Kind ist, das im August geboren wurde (am 23. August 1886). Auszüge: "Meine liebe gnädige Frau! Da ich gar nicht ahnte, daß Sie sich den Storch bestellt hatten, war mir die Nachricht von seiner Ankunft an meinem Geburtstage eine desto freudigere Überraschung! Gestern Abend, als ich vom Strande zurückkehrte, erfuhr ich sie erst! Seien Sie allerherzlichst begratuliert beiderseitig! Das Gratulieren bei Dechends ist ja permanent, danach zieht man den Schluß, daß es eine gottbegnädigte Familie ist, mit Recht! [.] Ich bin seit 3 Wochen hier; meine Gesundheit bedurfte dieser Erfrischung in hohem Grade [.]. Ich habe mir einen Strandkorb gemiethet, den ich dicht an die Wellen rücke; der schützt vor Sonne und Wind, und ich wandele schon früh um 8 Uhr zu ihm hinunter, bis gegen 12 darin bleibend, mit Frühstück (wovon Sie leider hier Spuren zu sehen bekommen, die ich sehr zu entschuldigen bitte), Schreibemappe, Arbeit, oder Buch. Augenblicklich gewährt die See einen um so interessanteren Anblick, als die Kriegsschiffe davor liegen. [.] Immer Ihre Pauline Nowack." --- Briefe jeweils ohne Umschlag. ---- Zustand: Briefe gefaltet; Papier gebräunt und etwas fleckig. Signatur des Verfassers.
-
Wie Ostdeutschland besetzt wurde und Berlin kapituliert hat * m a s s e n h a f t e r u s s i s c h e K r i e g s v e r b r e c h e n 1 9 4 5 / b r u t a l e s und a u s b e u t e r i s c h e s s o w j e t i s c h e s B e s a t z u n g s s y s t e m i n D e u t s c h l a n d n a c h K r i e g s e n d e
Verlag: Ohne Orts- und Verlagsangabe,, 1949
Sprache: Deutsch
Anbieter: Galerie für gegenständliche Kunst, Kirchheim unter Teck, Deutschland
Erstausgabe
EUR 69,50
Währung umrechnenEUR 7,45 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 2 verfügbar
In den WarenkorbVollständige Ausgabe im original Verlagseinband: Broschur kl.8vo im Format 14,5 x 21 cm mit bebildertem Deckeltitel, 93 Seiten, Schrift: Antiqua. - Aus dem Inhalt: "Mit dem empfangenen Besatzungsgeld wussten die Soldaten nichts anzufangen, denn in den deutschen Geschäften gab es nicht zu kaufen, da sie niedergebrannt und ausgeplündert waren. Die einzige Quelle für den Inhalt der Pakete war die Habe der zurückgebliebenen Deutschen (aus welcher man sich dann auch bediente) und das Gut, das von den geflohenen Deutschen weggeworfen worden war. - Immer öfter waren im Offizierskorps Gespräche darüber zu hören, daß es mit einem derartigen politisch-moralischen Gesicht der Soldaten nicht mehr weitergehen dürfe, daß wir mit derartigem Benehmen der Roten Armee Schande bereiten. Des ungeachtet setzen sich die Fälle von Plünderungen, Vergewaltigungen und Morden an der ortsansässigen Bevölkerung fort. Wie sollte dem auch nicht so sein, wenn die Kommandaturen mit irgendwelchen Leuten aus der Reserve besetzt wurden, welche, nachdem sie in der Kommandantur gelandet waren, sich bemühten, ihren Posten in erster Linie zur Verbesserung ihrer materiellen Lage und der ihrer Freunde auszunutzen. Unter den Kommandanten jener Zeit waren wenige solche Persönlichkeiten, welche in der Lage gewesen wären, eine eiserne Ordnung und Disziplin in ihrem Wohngebiet einzuführen. - Hier eine charakteristische Episode: der Gehilfe des Chefs der Kommandanturverwaltung war ein Hauptmann Golinskij. Eines Tages, als er von seinen regelmäßigen Rundfahrten zurückgekehrt war, erzählte er: "Nun, Genossen, beginnt eine Panzerarmee bei uns einzutreffen. Die werden es den Brüderchen, den Deutschen, noch geben, verlasst euch drauf! Und sie haben schon angefangen, es ihnen zu geben! Gestern musste ich einen Panzerkommandanten verhaften, einen Oberstleutnant - Helden der Sowjetunion. Die Ernennung zum Helden hat er dafür erhalten, daß er in den Kämpfen 30 deutsche Panzer vernichtete, darunter 11 "Tiger"-Panzer. Als die Deutschen in der Ukraine waren, rotteten sie seine ganze Familie aus und all seine Verwandtschaft, im Ganzen an die 40 Menschen; darunter Vater, Brüder und Schwestern - aufgehängt. Dieser Oberstleutnant also hielt mit seinem Tank beim deutschen Haus und ging hinein. Er nahm etwas Essen und Getränke ins Haus hinein und, nachdem er den Hausherren und die Hausfrau und ihre drei Töchter mit Wodka und einem guten Imbiss bewirtet und sich selbst einen ordentlichen Rausch zugelegt hatte, vergewaltigte er der Reihe nach die drei Mädchen, führte sie danach in den Hof hinaus und schoss sie neben seinem Tank mit der Pistole tot. Nun, was hättet ihr an meiner Stelle mit diesem Menschen gemacht? Ich persönlich habe mir diesen Tankkisten angehört, habe ihm die Hand gedrückt und ihn freigelassen. Es war wirklich die Rache eines Gemarterten". Leider Gottes gab es eine zahllose Menge solcher "Helden", und es wurde ihnen das Recht "überlassen", die "Rache des Volkes" im Gebiet des Gegners zu personifizieren. Es war eine endlose Reihe eigenmächtiger Abrechnungen mit der ortsansässigen Bevölkerung und eine Welle wilder Strafgerichte über irgendwelche Angehörige dieser Bevölkerung, ausgeführt von betrunkenen Deserteuren und Etappen-"Helden", die es nach menschlichem Blut dürstete. . . " - Deutsches / Drittes Reich, Großdeutschland am Ende / nach dem im 2.Weltkrieg, Kriegführung der roten Armee in Ostdeutschland 1944 ff, russische / sowjetische Kriegführung im 20. Jahrhundert, schreckliches Besatzungsregime der Roten Armee in Deutschland, russische Kriegsverbrechen, bestialische Verbrechen von Sowjetsoldaten an der deutschen Bevölkerung, Massenvergewaltigungen vor und nach Kriegsende, der jüdische Hetzer Ilja Ehrenburg. - Erstausgabe in guter Erhaltung; restliche Beschreibung s.Nr. 50478 ! Versand an Institutionen auch gegen Rechnung Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 2000.
-
Theologin Elisabeth GÖSSMANN (1928-2019): Brief MÜNCHEN 1955, über Doktor-Arbeit
Verlag: München, 1955
Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert
EUR 45,00
Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Gut. 1. Auflage. Eigenhändiger, signierter Brief der römisch-katholischen Theologin und Feministin Elisabeth Gössmann (1928-2019). --- Datiert München, den 3. April 1955. --- Über ihre Doktorarbeit "Die Verkündigung an Maria im dogmatischen Verständnis des Mittelalters", die jedoch erst 1957 gedruckt werden sollte. --- Gerichtet an eine "verehrte gnädige Frau"; d.i. die Gräfin Clara Ledóchowska (* 26. Juni 1911 in Sarns), Sekretärin bei der österreichischen Botschaft am Heiligen Stuhl (Vatikan). --- Auszüge: "Das Thema meiner Arbeit heisst genau: Die Verkündigung an Maria im dogmatischen Verständnis des Mittelalters. Es handelt sich um eine dogmengeschichtliche Untersuchung zu Luc. 1,26-38. Mit der Drucklegung wird z.Zt. erst begonnen, und ich denke, dass die Arbeit bis spätestens Ende des Jahres beim Max-Hueber-Verlag München erschienen ist. Mit freundlichen Grüssen! Elisabeth Gössmann." --- Umfang: eine A4-Seite; ohne Umschlag. --- Zustand: Papier leicht gebräunt und etwas knittrig, mit Eckknicken. --- Über die Verfasserin (Quelle: wikipedia): --- Maria Elisabeth Gössmann (geborene Placke; * 21. Juni 1928 in Osnabrück; 1. Mai 2019 in München) war eine deutsche römisch-katholische Theologin und prominente Vertreterin der feministischen Theologie innerhalb der Römisch-katholischen Kirche. Sie selbst sah sich als Vertreterin einer historischen Frauenforschung in der Theologie". --- Leben: Elisabeth Gössmann studierte nach dem Abitur 1947 Katholische Theologie, Philosophie und Germanistik in Münster und bestand 1952 ihr Staatsexamen. In München studierte sie bei Michael Schmaus. Sie interessierte sich dabei eher für das Alternative", nämlich für die theologischen Entwürfe der frühen Scholastik und mehr für die franziskanische als die dominikanische Linie. 1954 promovierte sie dort (gleichzeitig mit ihren Kommilitonen Joseph Ratzinger und Uta Ranke-Heinemann). Bis 1954 hatte es in Deutschland für Frauen keine Promotion in katholischer Theologie gegeben. --- Sie arbeitete zunächst in Japan, erst als Dozentin für deutsche Literatur des Mittelalters an der kirchlichen Sophia-Universität in Tokio, dann als Dozentin für Christliche Philosophie an der mit der Gesellschaft vom Heiligen Herzen Jesu (jap. Seishinkai) verbundenen Seishin-Frauenuniversität. Dort lehrte sie seit 1968 als Professorin auf Japanisch. Sie hatte seit 1986 Lehraufträge in Deutschland, Österreich und der Schweiz. --- Ihr erster Versuch, sich zu habilitieren, misslang 1963 wegen eines Einspruchs der Deutschen Bischofskonferenz: Laien sollten nicht zu Professoren gemacht werden. 1978 gelang ihr zweiter Versuch zur Habilitation, diesmal im Fach Philosophie bei Eugen Biser. Sie erhielt in Deutschland allerdings trotz 37-maliger Bewerbung keinen Lehrstuhl und konnte erst 1990 eine außerplanmäßige Professur in München antreten. --- Sie war von 1954 bis zu seinem Tod im Januar 2019 mit dem Literaturwissenschaftler Wilhelm Gössmann verheiratet und hatte zwei Töchter und zwei Enkelkinder. Elisabeth Gössmann starb nach längerer Krankheit Anfang Mai 2019 im Alter von 90 Jahren in München. --- Ehrungen 1985: Ehrendoktorwürde der Universität Graz 1994: Ehrendoktorwürde der Universität Frankfurt am Main 1997: Herbert-Haag-Preis 2003: Ehrendoktorwürde der Universität Bamberg 2003: Ehrendoktorwürde der Universität Luzern 2017: Ehrendoktorwürde der Universität Osnabrück. Signatur des Verfassers.
-
5 Briefe 1885-1888 von Marie KARBE, geb. Karbe (1856-1945). u.a. BUCKOW (Mark)
Verlag: Buckow, Misdroy und Tölz, 1885
Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert
EUR 45,00
Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Gut. Ohne Schutzumschlag. 1. Auflage. Zwei Briefe und drei Briefkarten von 1885-1888. --- Geschrieben von Marie Karbe, geb. Karbe (1856-1945), Witwe des Rittergutsbesitzers Adolf Karbe (1850-1884) in Buckow (Brandenburg). --- Gerichtet an den Berliner Landrichter Heinrich Georg Althaus (1845-1894) in Berlin, Sohn des Professors der Philosophie an der Universität Berlin Karl Heinrich Althaus (1806-1886), bzw. an dessen Ehefrau Marie "Mieze" Althaus, geb. von Dechend (1855-1917), Tochter des ersten Reichsbank-Präsidenten Hermann von Dechend (1814-1890). --- 1.) 1-seitig beschriebene Karte (14,3 x 10,8 cm) an Heinrich Georg Althaus; datiert Buckow, 11. Februar 1885. Mittig gefaltet. --- Glückwünsche zur Geburt eines Sohnes, d.i. Georg Althaus (* 7. Februar 1885 in Berlin, gestorben bereits im Alter von 10 Jahren am 13. Oktober 1895 in Halle als Schüler der Latina). "Hoffentlich geht es meiner lieben Mieze den Verhältnissen nach leidlich wohl und wird dieselbe bald wieder ganz frisch sein. Wenn sie erst wieder lesen darf, werde ich ihr selbst schreiben, solange nur einen recht herzlichen Gruß von ihrer M. Karbe geb. Karbe." --- 2.) 2-seitiger Brief (18,3 x 11,3 cm) an Heinrich Georg Althaus, datiert Misdroy, 26. August 1886. --- Glückwünsche zur Geburt des zweiten Sohnes, d.i. ihr Patensohn Karl Althaus (1886-1956), am Ende Rechtsanwalt in Perleberg. "Möchte der kleine Prinz in seiner Entwicklung das halten, was er mit seinem stolzen Gewicht verspricht [.]." --- 3.) 4-seitiger Brief (18 x 11,3 cm) an Marie Althaus, datiert Toelz, Krankenhaus, den 25. Juli 1888. Als einziges Schreiben mit Umschlag, adressiert an den Sommer-Aufenthalt in Grund (Harz). --- Auszüge: "Kleine liebe Mieze! [.] Wohin hat Dich diesmal Dein Weg geführt, ich nehme an Du hast diesmal Luisens Wohnung in Rügen bezogen und läßt Georg in der See baden, daß thäte ihm gewiß gut, dem kleinen zarten Burschen! Denk Dir, mich haben sie wirklich auch wieder fortgeschickt, und zwar ins bayrische Hochgebirge um meine Lungen ordentlich zu baden in Bergesluft. [.] Meine Schw. Gretchen hütet mir die Kinder zu Haus, mit denen sie anfangs etwas Noth hatte, da sie sich bei dem kalten nassen Wetter sogleich etwas erkältet hatten. [.] Es grüßt Dich herzlich Deine Dich liebende Marie Karbe." --- Anm.: Erwähnt ist ihre Tochter Elisabeth "Lisbeth" (* 27. November 1882 in Buckow, gest. 2. August 1908 in Berlin), die 1904 den Oberleutnant Siegfried Karbe (1870-1914) heiraten sollte, sowie ihre Schwester Margarethe "Gretchen" (* 30. August 1848 in Blankenburg, Uckermark; gest. am 12. Juli 1925 in Berlin). --- 4.) Beidseitig beschriebene Karte (9 x 11,5 cm) an Heinrich Georg Althaus, datiert Buckow, 28. Dezember 1888. --- Glückwünsche zur Geburt einer Tochter, d.i. Luise Althaus (* 19. Dezember 1888 in Berlin). "Es trifft sich nett, daß nun wieder ein Mädchenpärchen ist, wie vorher die Knaben passende Spielgefährten sind!" --- 5.) Beidseitig beschriebene Karte (7,5 x 10 cm) an Marie Althaus; undatiert und ohne Ortsangabe. --- Zusage zur Taufe einer Tochter, d.i. entweder die schon erwähnte Luise Althaus oder Angelika Althaus (* 18. Januar 1888 in Berlin). "Hoffentlich wird das Schneewehen bis dahin nachlassen, daß ich unterwegs nicht stecken bleibe! Mit herzlichen Grüßen bis dahin! Deine treue Marie Karbe." --- Über die Verfasserin: Marie Caroline Karbe wurde am 30. September 1856 in Blankenburg (Uckermark) als Tochter des Amtsrats und Domänenpächters Carl August Karbe (* 8. Februar 1822 in Blankenburg / Uckermark; gest. 12. Oktober 1870 ebd.) und der Marie Luise Elisabeth, geb. Thym (1824-1888) geboren und starb am 14. Juli 1945 in Brandenburg. Am 28. März 1879 heiratete sie in Blankenburg (Uckermark) Adolf Friedrich Wilhelm August Karbe (geb. 11. April 1850 in Lichterfelde als Sohn des Rittergutsbesitzers August Karbe und der Therese, geb. Theremin, gest. am 14. Dezember 1884 in Buckow). --- Zustand: Nur ein Brief (der aus Tölz) mit Umschlag. Papier gebräunt und teils fleckig; teilweise mit Knicken. Signatur des Verfassers.
-
3 Briefe CELLE & HOYEL 1894-1903, von Auguste ALTHAUS, geb. SIEVERS (1834-1904)
Verlag: Celle und Hoyel, 1894
Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert
EUR 45,00
Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Gut. 1. Auflage. Drei Briefe aus Celle und Hoyel (OT von Melle-Riemsloh) von 1894 und 1903. --- Geschrieben von Auguste Althaus, geb. Sievers (1834-1904), Witwe des ev. Theologen August Althaus (1807-1881) und Mutter des Theologen Paul Althaus d.Ä. (1861-1925) und des ev. Pastors und Missionars Gerhard Althaus (1866-1946) sowie Großmutter der Theologen Paul Althaus (1888-1966) und Georg Althaus (1898-1974). --- Ihr Ehemann August Althaus war 1847-1859 Pastor in Celle gewesen. Danach war er bis zu seinem Tod Pastor in Fallersleben (Wolfsburg); offenbar kehrte seine Witwe nach dessen Tod nach Celle zurück. --- 1.) 3-seitiger Brief Celle, den 14. November 1894, gerichtet an ihre Nichte Marie, d.i. Marie Althaus, geb. von Dechend (1855-1917), Tochter des ersten Reichsbankpräsidenten Hermann von Dechend (1814-1890). Beileidsbrief zum Tod ihres Mannes. --- Auszüge: "Liebe Nichte Marie! Mit tiefer Betrübniß habe [.] die Nachricht seines Heimgangs empfangen. So sehr schwer und schmerzlich für Euch alle der Verlust des geliebten Mannes und Vaters und Bruders sein muß, so dürfen wir jetzt doch wohl nur danken, daß der Herr unser Gott dem schweren Leiden ein Ziel gesetzt und den lieben Heinrich davon erlöst hat." --- Signiert "Tante Auguste Althaus, geb, Sievers." --- Am Ende ein ausführliches PS --- Die beiden Briefe von 1903 gerichtet an Adelheid Althaus (1846-1923), Tochter von August Althaus' Bruder Karl Heinrich Althaus (1806-1886), Philosoph. --- 2.) 6 ½-seitiger Brief, datiert Hoyel, den 9.-11. Mai 1903. --- Auszüge: "Meine liebe Adelheid! [.] Daß wir beide uns mal kennen lernten und so liebe Wochen in Neuenkirchen zusammen verlebten, bleibt mir immer eine Freude. [.] Ich selbst gehe nun bald ins 70ste Jahr u. damit immer näher dem Ziele entgegen. Heute vor 22 Jahren ging mein heißgeliebter Mann ein ins himmlische Reich. [.] Viele Todesfälle gabs in den letzten Jahren im Familien- und Freudeskreise, da wurden Herz u. Gedanken auch mehr nach oben gelenkt. [.] Sei Du dem treuen Gott befohlen und denke zuweilen in Liebe Deiner alten Tante Auguste." --- 3.) 5-seitiger Brief, datiert Celle, den 25. November 1903. --- Auszüge: "Meine liebe Adelheid! [.] Meiner Schwiegertochter u. mir kostete es auch Mühe genug, meinen Paul zu einem für ihn nötigen Aufenthalt an der See zu bewegen; länger als kaum 4 Wochen hielt er es in Borkum doch nicht aus; aber nach der langen Winterarbeit war er sehr abgespannt u. seine Stimmbänder erschlafft. Es liegt oft{?} zu viel fest auf seinen Schultern, zumal in diesem Winter, da er durch Abt Schulz Tod, dessen Nachfolger erst um Ostern sein Amt antritt fast doppelte Arbeit hat und auch als Universitätsprediger dessen Nachfolger geworden ist. Ich sah ihn zuletzt im Herbst einige Stunden in Hannover, wo er die Kandidaten mit zu prüfen hatte. [.] Auch bei Gerhard in Afrika wurde diesen Sommer ein Töchterlein geboren u. auch dort ging alles gut wie in Hoyel u. Kl. Mahner. [.] Vergiß nicht Deine Dich herzlich liebende Tante Auguste Althaus." --- Anm.: ihr Sohn Gerhard Althaus (1866-1946) war Missionar in Deutsch-Ostafrika, heute Tansania, im Auftrag des evangelisch-lutherischen Leipziger Missionswerks. --- Briefe jeweils ohne Umschlag. --- Format: der Brief von 1894 im Format 17,7 x 11,3 cm; die Briefe von 1903 im Format 22 x 14 cm. Über die Verfasserin: Auguste Althaus, geb. Sievers (* 28. September 1834 in Dorfmark als Tochter des Pastors Johann Wilhelm Sievers und der Sophie Juliane Amalie, geb. Friederich, gest. 1904) heiratete er am 12. Oktober 1856 in Celle die 27 Jahre älteren verwitweten Pastor Carl Wilhelm Adolph August Althaus, geb. am 3. Dezember 1807 in Hannover als Sohn von Karl Philipp Christian Althaus (* 6. April 1775 in Gehmen, gest. 28. März 1869 in Hannover), von 1805 bis 1869 ev.-reformierter Pastor in Hannover, und der Friederike, geb. Hinke (gest. am 5. Januar 1846), gestorben am 10. Mai 1881 in Fallersleben (Wolfsburg). --- Zustand: Papier etwas fleckig; guter Zustand. Signatur des Verfassers.
-
ADEL: Briefe (u.a. Rinteln 1844) an Luise von Borries, geb. von Bülow (1777-1861)
Verlag: Rinteln, 1844
Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert
EUR 35,00
Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Gut. 1. Auflage. Zwei Briefe, gerichtet an Luise von Borries, geb. von Bülow (1777-1861) in Bückeburg, eine Tochter des kurhannoverschen Offiziers, Gutsbesitzers und Landschaftsdirektors Friedrich Ernst von Bülow (1736-1802) und Witwe von Philipp von Borries (1778-1838), von 1832 bis zu seinem Tod Landrat des Kreises Herford. --- Aus einer Sammlung von Briefen an diese Empfängerin. --- In beiden Briefen ist ein Wilhelm aus Detmold und eine Verabredung zum Kaffee erwähhnt. --- 1.) 3 ½-seitiger Brief (22,5 x 13,8 cm), datiert Rinteln, den 26. September 1844. Geschrieben von einer alten Freundin namens Charlotte. Vom Briefinhalt her befindet sie sich auf einer Reise und wohnt also nicht in Rinteln. --- Der beiliegende Umschlag (8 x 11,5 cm) könnte Hinweise auf die Identität der Verfasserin geben: Das durch die Brieföffnung zweigeteilte Siegel zeigt ein Adelswappen; außerdem wurde für den Umschlag eine Rechnung des Gasthofs "Zur Goldenen Krone" in Münden verwendet, u.a. über zwei Übernachtungen (15.-17. September 1844). -- Da die Rechnung sicherlich an die Verfasserin gerichtet ist, müsste man in einem Archiv die entsprechenden Ausgaben des "Münden'schen Intelligenzblatts" heraussuchen und dort unter der Rubrik "Angekommende Fremde" schauen, wer in dieser Zeit dort übernachtet hat. --- Auszüge: "Meine theure geliebte Louise. Endlich kann ich den Tag meiner Abreise von hier u. alson den Tag meiner Ankunft in B. bestimmen. ich mögte es nicht gerne versäumen Deinen guten Schwager auch mal zu sehen [.] u. so habe ich den Sonntag gewählt. [.] auch hoffe ich daß wir einen Wagen bekommen der uns ganz nach Edendorf bringt. [.] Die letzte Vergangenheit hat mir viele Freude gewährt, das Wetter bis nach Münden war uns günstig [.], die Ufer der Weser sind schön [.]. Das Wiedersehen der geliebten Kinder Werner u. Lolly haben mir große Freuden gemacht, vorzüglich da man in aller Hinsicht mit ihnen zufrieden ist [.]. --- D. 27. Mein Brief ist liegen geblieben [.]. Darüber soll nun Wilhelm entscheiden den wir heute v. Detmold erwarten. - auf jeden möglichen Fall kommen wir zum Caffe zu Dir [.]. Was denkst Du wohl von der undankbaren Freundin, die Dir noch kein Wort über den so freundlich geliehenen Mantel sagte, der mir so wohlthätig geworden [.]. Wie immer mit treuer Liebe die Deinige meine theure Louise - Charlotte." --- 2.) 1 ½-seitiger Brief (21,2 x 13,5 cm), undatiert, ohne Umschlag, geschrieben von einer Friederike Stolz (eventuell einer Nonne?). --- Auszüge: "Nur die Versicherung wie gerne ich Ihre freundliche Einladung annehme, meine theure Freundin!, lassen Sie mich die Zeiten unserer geliebten Äbtissin beifügen; da diese leider! nicht länger mir bis Sonntag bleiben will so werden wir sie so Gott will b eglücken, und zum Caffe, Sie Liebe, in Ihrem freundlichen Stübchen begrüßen. Wilhelm ist vorgestern nach Detmold gereist, ich erwarte ihn aber wahrscheinlich heute zurück. [.] Leben Sie unterdessen [.] wohl, meine geliebte Borries! und grüßen die gute {???} herzlich von Ihrer treu ergebenen Friederike Stolz." --- Zustand: Umschlag schadhaft, ansonsten gut. Signatur des Verfassers.
-
Philosoph Johann Georg Mußmann (1795-1833): Brief BERLIN 1826, LIEBESBRIEF
Verlag: Berlin, 1826
Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert
EUR 65,00
Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Gut. 1. Auflage. Eigenhändiger, signierter Liebesbrief des Philosophen Johann Georg Mußmann (1795-1833), Professor an der Universität Halle. --- Datiert 16. Januar 1826. Ohne Ortsnennung, geschrieben aber in Berlin, wo er im selben Jahr promovierte und wo auch die Empfängerin lebte. --- Adressiert "an Frl. A. Schüler, Wohlgeboren hier", d.i. seine Verlobte Angelika Luise Schüler (geb. am 14. Juni 1808 in Berlin als einzige Tochter des Kaufmanns Johann Benjamin Schüler; gest. am 25. August 1880 in Berlin). Die Heirat fand erst im September 1830 statt. Nach dem frühen Tod Mußmanns (1833) heiratete sie zehn Jahre später den Privatdozenten und späteren Professor der Philosophie in Berlin Karl Heinrich Althaus (1806-1886). --- Umfang: 3 Textseiten und eine Adressseite (20,8 x 12,3 cm). --- Format (zusammengefaltet): 5,5 x 9,5 cm. --- Auszüge: "Den freundlichsten und beßten Tag Dir, geliebte Seele, und den Deinen! Da deine unmittelbare Gegenwart, da das Schaun in Dein seelenvolles Auge, ja das Ruhn an Deinem Herzen mein Herz und meine Seele, Fühlen und Denken so ganz und allein beschäftigt, daß alle übrigen Gedanken mir sich oft in dem Einen an Dich gleichsam aufzulösen und vor dem geistigen Auge zu schwinden scheinen: so muß ich denn wohl, wieder in meine Einsamkeit zurückgekehrt und hier zu meinem eigenen Selbst gekommen [.], wenigstens der nächsten Versprechen, die Liebe und Ehre mir auferlegen, gedenken und durch dessen Erfüllung Deinem, und sei's auch nur aus Liebe und mir ans Herz gelegten Vernunft der Unachtsamkeit und gänzlichen Vergeßlichkeit auszuweichen. Deshalb verzeihe mir, heißgeliebte Angelika, daß ich Dir doch nur versuchsweise ein paar geschnittene Federn schicke, denn ich kann nicht wissen, ob ich Federn und Schnitt Dir und Deinem Händchen angemessen gemacht habe, und erbiete mich herzlich gerne, auch im Übrigen Deine Wünsche zu erfüllen, sobald Du sie nur laut werden lassen willst. Dies Federnschicken hat aber auch noch das Eigennützige von meiner Seite, daß ich unmöglich zugeben kann, die Zeit, welche Du auf einige Herzensworte an mich zu verwenden bestimmt hast, durch ein mühsames Schneiden mit stumpfem Messer zu kürzen und meinem Herzen dadurch weniger Erquickung und Freude zu gewähren. [.] Wie ich es hier ausspreche, so will ich es stets u. laut vor aller Welt verkünden, damit sie einsehe und lerne, wozu Gott die Seinen bestimmt, und zu welchen edlen u. herrlichen Thaten edle gottgeführte Menschen fähig sind. [.] Gott vor Augen u. im Herzen, soll mein Wahlspruch mir sein: Wissen, Liebe u. That. Und Du herrliche Seele, folgst mir doch gern? Gott erhalte Dich mir und d. theuren Deinen. Empfehle mich freundlichst denselben. Bis morgen also, Herzensgeliebte, und auf Ewig Dein Dich unverändlich liebender Mußmann." --- Aus einem Briefnachlass der Empfängerin. --- Zustand: Kräftiges Papier etwas fleckig; das Siegel fehlend. Signatur des Verfassers.
-
Schriftstellerin Auguste BARTELS (1829-1909): Briefe ROM 1887/88, Papst-Jubiläum
Verlag: Rom, 1887
Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert
EUR 65,00
Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Gut. 1. Auflage. Zwei eigenhändige, signierte Briefe der Schriftstellerin Auguste Bartels (1829-1909). --- Datiert Rom, Via della Frezza 65, den 18. November 1887 und 5. Februar 1888. --- Beschrieben werden jeweils Feierlichkeiten zum Papstjubiläum; gemeint ist das 10-jährige Pontifikat von Leo XIII. (1810-1903), der am 3. März 1878 zum Papst gekrönt wurde. --- Auguste Bartels lebte in Berlin, war aber wiederkehrend längere Zeit im Ausland. --- Gerichtet an ihre Patentochter Marie Adelgunde Auguste Althaus, geb. von Dechend (1855-1917), Tochter des Reichsbank-Präsidenten Hermann von Dechend (1814-1890), bzw. ihren Ehemann, den Berliner Landrichter Heinrich Georg Althaus (1845-1894). --- Umfang: jeweils vier beschriebene Seiten (20,3 x 13 cm); ohne Umschlag. --- Auszüge: --- Brief vom 18. November 1887 an Marie Althaus: "Meine liebe Marie! [.] Seit ich im Frühlinge Berlin verließ, habe ich so viel erlebt und gesehen, daß es ganz unmöglich ist über Alles zu berichten. Nach kürzeren, oder auch längeren Aufenthalten in Halle, Weimar, Cassel, Düsseldorf, Aachen, Brüssel, kam ich ohne alle Fährlichkeit über den gefürchteten Kanal und verlebte dann vier köstliche Monate in London, dessen ganze Pracht und Großartigkeit sich nur unter den besonderen Umständen des Jubiläums der Königin und eines noch nie da gewesenen, beständigen Sommerwetters entfaltete." --- Dann über einen Reise durch Schottland, den sie mit ihrer Reisegefährtin Luise von Lobenthal unternimmt (wohl eine Cousine), und Aufenthalten im Seebad Brighton, Paris und Nizza. --- "Unter Sturm und Regen zog ich am 26. Oktober in Rom ein. [.] Täglich mehrt sich die Anzahl der Fremden, welche man umso mehr in Fülle erwartet, da das Papstjubiläum bevorsteht. In Folge dessen sind, ungeachtet aller Neubauten, die Wohnungspreise ungemein in die Höhe gegangen. Ich konnte leider mein früheres logis bei der trefflichen deutschen Wirthin nicht wieder beziehen, da jetzt eine reiche Engländerin die ganze Etage Jahr aus, Jahr ein inne hat. Ich habe es nun weniger gut und muß bedeutend mehr zahlen. [.] Der Zauber von Rom hat für mich Nichts von seiner Macht verloren. [.] Ich bin zu meiner Befriedigung nicht unmerklich magerer geworden und unermüdlich in der Bewegung. [.] Deine sehr ergebene Pathin Auguste Bartels." --- Brief vom 5. Februar 1888 an Heinrich Georg Althaus (Gratulation zur Geburt der Tochter Angelika Althaus, geboren am 18. Januar 1888 in Berlin): "Lieber Herr Landrichter, Herzlichen Dank für Ihr freundliches Schreiben und besten Glückwunsch zum Familien-Zuwachs! Ich war von dieser Nachricht nicht wenig überrascht, da mich Niemand darauf vorbereitet hatte und ich Mariechen gern etwas längere Ruhepause und Zeit zur Erholung gegönnt hätte. Solches stimmt ja doch nicht zu dem, was in der Dechend'schen Familie üblich ist. [.] Das Leben in Rom ist so vielseitig und durch das diesjährige Papst-Jubiläum ist die Mannigfaltigkeit so viel bunter geworden, daß die Stunden beschwingt enteilen. Ich lebe in einem Kreise von geistig engeregten, heiter genießenden Menschen, mit denen man sich beständig trifft, um die Eindrücke auszutauschen [.]. Eine große Anziehung sind die päpstlichen Ceremonien, zu denen sich diesmal der heilige Vater in der Jubiläums-Stimmung herbei läßt, und die Ausstellung der für ihn aus allen Weltgegenden eingelaufenen Geschenke im Vatikan." Über die Verfasserin: Auguste Bartels wurde Ende 1829 in Minden als Tochter des Oberregierungsrats Karl Wilhelm Heinrich Bartels und der Therese Mathilde, geb. Troschel (1803-1884) geboren und starb am 19. Mai 1909 in Berlin als ledige Rentnerin. --- Sie ist verzeichnet im "Lexikon deutscher Frauen der Feder", Bd. 1, Berlin 1898, S. 39: "[.] schrieb für verschiedene Zeitungen und Journale biographische Artikel, Essays, Aperçu's etc. stets ohne Nennung ihres Namens." --- Zustand: Briefe ohne Umschlag. Papier gebräunt und etwas fleckig. Signatur des Verfassers.
-
Schwarz und Weiß. Die Wahrheit über Afrika. Deutsch von Iwan Goll, mit O r i g i n a l - S c h u t z u m s c h l a g (dieser in Farbkopie) * brutale A u s b e u t u n g der f a r b i g e n Bevölkerung in A f r i k a durch die f r a n z ö s i s c h e K o l o n i a l m a c h t / mit FAZ-Beitrag vom 18.1.2014 "Der Mann, der seinen Reisekoffer liebte. Alfred Londres, Frankreichs eigenwilliger Starreporter der zwanziger Jahre"
Verlag: Wien / Berlin, Agis Verlag,, 1929
Sprache: Deutsch
Anbieter: Galerie für gegenständliche Kunst, Kirchheim unter Teck, Deutschland
Erstausgabe
EUR 164,30
Währung umrechnenEUR 7,45 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 2 verfügbar
In den WarenkorbVollständige Ausgabe im original Verlagseinband: gelbes Ganzleinen OLn / Ln 8vo 13 x 19 cm mit Rücken- und Deckeltitel, Kopffarbschnitt sowie dem farbig bebilderten farbfotoillustrierten Original-Schutzumschlag OSU (dieser in neuzeitlicher Farbablichtung), 224 Seiten, Schrift: Antiqua. Aus dem Inhalt: Vorwort - Einleitung - Dakar - "Die Landstraße ist mein Fuß" - Die Nackten - Bamako - Tartaß oder der Friseur mit dem Fahrrad - Der Bananenmotor - Zwischen 1888 und 1900 - Die Mestizen - Der Gott des Dschungels - Timbuktu - Jakuba, der Entzivilisierte - Ein Abend auf dem Niger - Der Neger ist kein Riese - Im Lande des Pussi-Pussi - Seine Majestät - Ihr Weißen, meine Brüder - Verschiedenes - Baumwolle Markt - Die Holzhändler - Der Wald spricht - 125 km - Mein Boy - Der König der Nacht - Ein Drama in Dahomey - Zurück nach Gabon - Die Tragödie der Ozean-Kongo-Bahn - Schweigen über Brazaville. - "Dieses Buch ist ein erschütterndes Dokument. Es deckt die Greuel der französischen Kolonialwirtschaft durch eine offene, objektive Schilderung auf. Es hat einen dokumentarischen Wert nicht zuletzt deshalb, weil sein Verfasser selbst noch glaubt, die Unmenschlichkeit des Kolonialsystems durch Reformen beseitigen zu können. Aber die Tatsachen, die er zusammengetragen hat, liefern den Beweis, daß all die Greuel der kolonialen Unterdrückung mit dem Kolonialsystem, mit Imperialismus selbst unzertrennlich verbunden sind wird dadurch, daß es die Heuchelei von der "zivilisatorischen Arbeit des Kapitalismus" in den Kolonien entlarvt, die Befreiung der unterdrückten Kolonialvölker fördern" (aus dem Vorwort). - "Die Veröffentlichung dieser Arbeit soll eine schändliche Tat von mir sein. Von vielen Seiten wird sie mir vorgeworfen. Ich kann mir die Ohren nicht genug zuhalten. Ich wurde nach meiner afrikanischen Reise als Mestize, Jude, Lügner, Seiltänzer, Lump, Verächter Frankreichs, Zuhälter, Verräter, zweifelhafter Geschäftsmann, Verrückter und zuletzt als gemeiner Journalist gebrandmarkt. Alle, die in den Kolonialzeitungen das große Wort führen, haben mir die Hölle heiß gemacht. Es sind gegen meine Wenigkeit ganze Extrablätter gedruckt worden" (aus der Einleitung). - Mit zeittypischen Ausführungen des (nach heutigen Begriffen wohl eher "linken" Verfassers): "Der Soldat will einen seiner Rassegenossen zum Kommandanten abführen. Da sich jener sträubt, gibt er ihm ein paar Ohrfeigen, die die Luft bis auf zehn Schritt erschüttern. Der andere lässt es sich ruhig gefallen und rührt sich nicht einmal. Der Neger empfängt Ohrfeigen wie ein vom Schicksal zugedachtes Unglück. Seine beiden Frauen mahlen dabei ruhig ihren Mais weiter, und sein Hund laust sich, ohne sich aufzuregen. Sobald ein Schwarzer eine Uniform anhat, wird er gemeiner gegen seine Brüder als die Weißen. Er schlägt sie, reißt ihre Hütten nieder, ißt ihren Reis, säuft ihren Bangi und nimmt sich ihre Töchter" / "daß England in Sierra Leone 230.000 Sklaven freigegeben habe. Die gab es also doch? Ja, die gab es immer noch, die genannten 230.000 inbegriffen! Es gibt überhaupt nichts anderes in den Kolonien! Man nennt sie Haussklaven, Uolosos. Sie gehören dem Hausherrn genauso wie die Kühe und das übrige Hausvieh. Der Chef beschützt und ernährt sie und gibt ihn auch zuweilen ein oder zwei Frauen. Diese Paare müssen dann viele kleine Uolosos zeugen. Afrika lebt also noch in der Sklaverei. Auf einen freien Mann kommen 15 Uolosos." - Enthüllungsjournalismus, Französische Kolonien / Kolonialverbrechen / Umweltzerstörung in Afrika, brutale Ausbeutung der farbigen Bevölkerung in Afrika durch französische Kolonialmacht, Rassenmischung, Kolonialsystem, Mestizen, sog. Neger / Negerkönig / Negerhäuptling, Sklaverei, französischer Rassismus, Menschenfresser, Fetische. - Deutsche Erstausgabe in sehr guter Erhaltung; restliche Beschreibung s.Nr. 39172 ! Versand an Institutionen auch gegen Rechnung Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 2000.
-
Vorphila 1846 mit Umschlag -- Liebesbrief LEIPZIG 1846 an Anna GOTTSCHALCH
Verlag: Leipzig, 1846
Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert
EUR 70,00
Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Gut. Ohne Schutzumschlag. 1. Auflage. Vorphila-Liebesbrief von 1846 aus Leipzig. --- Früher Brief mit Briefumschlag (die erste Maschine zur Herstellung von Briefumschlägen wurde 1844 in England erfunden; in Deutschland wurde die erste Briefumschlagfabrik im Jahr 1849 vom Kaufmann Rommeler in Jülich gegründet). --- Gerichtet an Anna Pauline Gottschalch (1826-1897), Tochter der Kreis-Steuerrätin Charlotte Christiane Gottschalch, geb. Ortmann (1791-1857), die sich zu dieser Zeit beim Bezirks-Steuereinnehmer Friedrich Florian Geyler aufhielt und an die der Brief adressiert ist. --- Ihr Vater, der Leipziger Kreissteuerrat Johann Samuel Gottschalch (*1783), Ritter des Civil-Verdienstordens, war bereits am 19. Oktober 1844 in Leipzig gestorben. --- Ein Doppel-Porträt ihrer Eltern, 1809 gemalt von Ernst Christian Weser (1783-1860), wurde am 4. Dezember 2001 bei Christie's in London versteigert. --- Geschrieben von einem August; beide sind ineinander verliebt. --- Es handelt sich eventuell um den Advokaten und Notar Dr. Carl August Andritzschky (* 1816), mit dem sie sich am 5. September 1847 in Leipzig verloben sollte (Anzeige in: Leipziger Zeitung vom 5. September 1847, S. 2242); die Hochzeit fand erst im Juni 1850 in Leipzig statt (verzeichnet in: Dresdner Journal und Anzeiger vom 25. Juni 1850, S. 1432). --- Carl August Andritzschky legte seine Dissertation "Concursus creditorum Bona debitoris" 1843 in Leipzig ab. 1860 ist er nachweisbar als Vorsitzender des Direktoriums der Vereins-Bierbrauerei in Leipzig und 1881 als Notar beim Landgericht Leipzig. --- Dagegen spricht aber, dass im Brief ein Dr. Klinkhardt als wohl Vorgesetzter von August erwähnt ist (lt. Adressbuch der Theologe und Archidiakonus Christian Gottlieb Klinkhardt) und dass das Siegel ein Bibel-Motiv zeigt. Es handelt sich beim Verfasser also wohl um einen Geistlichen aus der Gemeinde von Chr. Gottlieb Klinkhardt, dessen Beziehung zu Anna dann bald in die Brüche ging? --- Datiert Leipzig, den 5. Januar 1846. --- Umfang: 4 Seiten (21,5 x 13,7 cm). --- Mit dem originalen Umschlag (8 x 12,3 cm; Poststempel Leipzig, 6. Jan. 46), mit handschriftlichem Taxvermerk, rückseitigem Siegel und Vermerk "nebst 1 Kästchen sign. F.G.Y. Zwickau (einlieg. im ein Glas.)" --- Auszüge: "Meine herzinnig geliebte Anna! Beigehend übersende ich Ihnen das gewünschte Macassar-Öl. [.] Ich habe unfrankirt schreiben müssen, weil Herr Dr. Klinkhardt die Berechnung verlangen wird und Sie in Verlegenheit kommen würden, wenn Sie nicht Rede stehen könnten. In das Kästchen habe ich die Bonbons von der Sylvesternacht für Sie beigefügt und mein ganzes Herz hineingebunden. Aber, mein Engel, glauben Sie nicht, daß ich nun mein Herz nicht mehr habe; ich fühle es, es schlägt noch immer so allgewaltig und innig mit unbegränzter Liebe für Sie, wie es ewig schlagen wird. [.] Ach, es ist ein eigenes, himmlisches Gefühl: Die Gewissheit, ein Herz, wie das Ihrige zu besitzen. Ich kann es nicht oft genug wiederholen, man fühlt die Nähe des Himmels, die Gnade des allgütigen Vaters in seiner ganzen Fülle. Sie sprechen in Ihrem letzten Briefe von einem Ziele, das Sie sich gesteckt haben; wenn Sie dasselbe erreichen, wollen Sie es mir allein verdenken. Diese geisterhaft mysterieusen Worte beschäftigten mich auch sehr auf meinem Wege. [.] Ich kam immer darauf zurück, daß Sie das schönste, das höchste und heiligste Ziel eines jungen Mädchens erreicht haben; was sollte Ihnen noch übrig geblieben sein? Sie haben durch Ihre Vorzüge, durch Ihr Herz und Ihre Seele, die aufrichtigste Liebe gewonnen, die es nur geben kann, Sie haben sich meiner Liebe erbarmt, Sie haben durch Ihre unendliche Liebe mich hochbeglückt und beseligt, Sie haben mich zum Glücklichsten, zum allein Glücklichen gemacht; was wollen Sie weiter? Gibt es etwas Höheres, Erhabeneres noch? [.] Adieu, meine alleinige Anna, Ihr überglücklicher August." --- Zustand: Sehr guter Zustand; der Umschlag leicht fleckig, das Siegel mit einigen Rissen. Signatur des Verfassers.
-
MILITARIA -- Brief AURICH 1840, Oberstlt. von ISSENDORFF (2. Leibdragoner-Rgt.)
Verlag: Aurich, 1840
Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert
EUR 70,00
Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Gut. Ohne Schutzumschlag. 1. Auflage. Brief von 1840 aus Aurich. --- Der Oberstleutnant Wilhelm von Issendorff (1783-1843), Stabsoffizier beim 2. Leibdragoner-Regiment in Aurich), wendet sich an den Generalleutnant Hieronymus von der Decken (1781-1845), Führer der 2. Kavallerie-Division zu Verden, auch tätig in der King's German Legion. --- Beide waren entfernt miteinander verwandt, da Wilhelm von Issensdorffs Mutter eine geborene von der Decken war. --- Datiert Aurich, den 13. November 1840. --- Betrifft sein Regiment und die Sättel von Pferden; speziell das Amt eines "Bockmachers": in der Hannoverschen Armee wurden Pferdesättel "Böcke" genannt; und jedes Regiment hatte seinen eigenen Bockmacher mit eigener Werkstatt. --- In der Allgemeinen Deutschen Biographie heißt es über den Empfänger: "Im Frieden hat er sich um das Sattel-Modell der hannöverschen Cavallerie später verdient gemacht." --- Auszüge: "Lieber verehrter Herr General! Sollte es durch die Dringlichkeit der Sattel-Angelegenheit nicht mehr möglich seyn, daß der Bockmacher Eckert das L.D. Rgt. {=Leib-Dragoner-Regiment} als genügend instruirt, wieder zurück käme? Es macht mich so ungeduldig, daß wir jezt hier nicht vorwärts kommen. Ich habe einen Hr. Bockmacher hier angenommen, der aber nicht ohne Aufsicht arbeiten kann; wenngleich er auch nachher von vielem Nutzen seyn wird. Ich mögte so gerne daß das Regt. bald eben so dienstfertig wieder würde wie die anderen." --- Dann über einen "neuen Sattelbock": "Der Bock ist fast schön gemacht; meiner Meinung nach sind die äußeren Kanten aber zu scharf, und es hatte auch damit etwas gestochen. Ich habe einen Sattelbock ganz nach dem neuen Modell für ein Pferd machen lassen; der wie ich glaube trotz seiner breiten Blätter Gnade vor Dir finden würde. Er wird eigentlich schon gemacht wie Rittmeister v. Meding noch hier war. [.] Wir erwarten hier mit einiger Sehnsucht das neue Annoncement, welches für dies Regt. von großer Wichtigkeit ist. [.] R. v. Bülow will gerne dort bleiben, wie man sagt. [.] Hoyer ist mein ganzes Glück. [.] Möge der Himmel dies Regt. schützen. Wenn ich auch nicht so bin, wie ich seyn sollte, so will ich doch meinem König zeigen, daß das Regt. seine Schuldigkeit that und zwar mit ganzer Ergebung für Sr. Majestät, ohne Murren soll es Alles be- u. überstehen." --- Signiert "W. v. Issendorff, Oberstl." --- Mit einem längeren Nachsatz, signiert mit "d.O." (=der Obige): "Meine alte gute Schwester Cecilie ist 3 Monathe lang hier{?} gewesen und heute von Bremen nach Lehr gereiset." Am Ende geht es noch um eine Bitte betreffend den Bockmacher. --- Umfang: drei Textseiten und eine Adressseite (25,5 x 21 cm). --- Format (zusammengefaltet): 8,7 x 13,5 cm. --- Zustand: Papier gebräunt; das Siegel fehlend. --- Über den Verfasser: Wilhelm Christian von Issendorf wurde am15. Juli 1783 in Düring (Ksp. Loxstedt) als Sohn des Landrats, Drosts und Erbrichters Hermann Christian Friedrich von Issendorf (1747-1792) und der Anna Amalia, geb. von der Decken (1755-1827) geboren, einer Tochter des Hauptmanns Carl Christian von der Decken (1710-1769), der ohne männliche Leiberben starb. Er starb am 10. Juni 1843 in Aurich. Signatur des Verfassers.
-
Reise einer Schweizerin um die Welt. Mit 700 Illustrationen. Vorwort von Nationalrat Dr. A. Gobat, Erziehungsdirektor des Kantons Bern.
Verlag: Neuenburg, Verlag von F. Zahn / Bern, Buchdruckerei Stämpfli & Cie. [1903] -, 1903
Anbieter: Franz Kühne Antiquariat und Kunsthandel, Affoltern am Albis, Schweiz
Erstausgabe
EUR 80,00
Währung umrechnenEUR 35,00 für den Versand von Schweiz nach DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den Warenkorb4° ( 29.3 x 21 x 5.5 cm). 2 Bll., 715 SS. Schriftsatz in 7-Punkt Fraktur, Druck a. satiniertem Papier. Portr.-Front. (neben Titel), reich illustriert mit photogr. Tafeln u. Abbildungen in Clichédruck (Buchdruck, Autotypie, ca. 55-60er Raster). Gepr. OLn. (ivoire, lamin., genarbt; etwas berieben u. fleckig/verfärbt) mit vergold. (R-) Titel u. farb. Deckelbild. Erste (einzige) Ausgabe. Alters-, Lagerungs- u. Dislokations-, weniger eigentliche Gebrauchs-/Lesespuren. Gesamthaft sauberes, sehr ordentliches Exemplar. - - Das Vorwort ist datiert Bern, im März 1903 - Digitalis. in e-rara - 'Die Textbilder sind nach photographischen Aufnahmen der Frau H. Sieber in Wien, des Herrn H. E. Waters in Baltimore und der Verfasserin erstellt' (p. 707) - Kapitel im Text jeweils mit Inhaltsübersicht, Inhaltsverzeichnis zu den 47 Kapiteln u. Abbildungsverzeichnis im Anhang - Ohne Register und mit nur sehr spärlichen Reisedaten, dafür mit mannigfachen historischen und kulturellen Ausführungen zu den jeweiligen Schauplätzen üppig ausgestatteter Bericht. - Die aufwendige Reise dürfte 1901/02 stattgefunden haben, wie die vielfältigen touristischen Unternehmungen dieser offensichtlich emanzipierten Frau nicht systematisch dokumentiert zu sein scheinen. - "Der 30. Mai 1901 war endlich herangekommen, der längst erwartete, ersehnte und insgeheim gefürchtete Tag meiner Abreise. Galt es doch eine lange weite Fahrt [sic], die mich um die ganze Welt führen sollte, und zwar allein!" - INHALT (gerafft, nach Stationen) : 1. Amerika (u.a. 'Bei den Mormonen'), 2. Hawaii, 3. Japan, 4. China (Im Sommerpalast der Kaiserin, Rundfahrten durch Peking), 5. Java (Vulkane, Alte Tempel), 6. Siam [Thailand; Feste und Gebräuche], 7. Birma [Myanmar; Mandalay, 'Weltfremde Länderstrecken und Völkerstämme', Irawadi], 8. Indien (Brahmanen und Buddhisten, Benares, Agra u. Sathepur, Haidarabad/Hyderabad, Madras, Militäraufstand 1857, etc.), 9. Ceylon [Sri Lanka; Kandy, 'König Tee'], 10. Aegypten (u.v.a. Beduinen, Muscheln, Mumien, Fellachinnen, Kalifengräber, etc.) - Kapitel 47, Heimwärts, ebenfalls ohne Daten: "Drei Tage später landeten wir in Neapel. [.] Ein Tag noch auf Capri, dann ging es [.] der Heimat zu." (p. 703 f.) -- Mathilde Sophie Cäcilie (Cécile) von Rodt (Bern 1855-1929 Mentone F), Schwester des Architekten und kunsthistorischen Publizisten Eduard von Rodt (1849-1926), Tochter des Carl Eduard, Gutsbesitzers in Brasilien, und der Cäcilia geb. Brunner, sowie Enkelin des Anton Emanuel, bernischen Grossrats und Vogts von Nyon und der Elisabeth von Sinner, machte, in alten und neuen Sprachen bewandert, zahlreiche Reisen in allen fünf Weltteilen (HBLS; HLS). - Die offenbar wohlhabende und anscheinend ledig gebliebene Bernburgerin war gem. foto-ch von Beruf Reiseschriftstellerin u. Fotografin der 'Gattung' Amateurfotografin, Sammlerin, zugeordnet der Bildgattung 'Ethnologie', mit Arbeitsorten: Bern BE um 1870-1929, u. div. erst wieder 1904-1906: vgl. photobibliothek ch, Nr. 1875: "Fräulein von Rodt machte im Jahre 1901 'ganz allein' eine Reise um die Welt. Während in den Textbildern manchmal ein persönlicher Bezug zur Autorin hergestellt wird, zeigen die Tafeln typische Reisephotographien von Berufsphotographen". - Fotosammlung der Geschwister Cécile und Eduard von Rodt in: Burgerbibliothek Bern (foto-ch; Rodt nicht in fotostiftung ch). -- NETTOGEWICHT / Net weight / Poids: 3.6 kg - VERSANDKATEGORIE / Weight category / Poids brut 5 kg - Sprache: de.
-
Dozent und Schriftsteller Walter de LAPORTE (1874-1945): 15 PKs BERLIN 1932-1939
Verlag: Berlin-Dahlem, 1932
Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert
EUR 90,00
Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Befriedigend. 1. Auflage. 15 eigenhändige, signierte Postkarten des Militärs, Dozenten und Schriftstellers Walter de Laporte (1874-1945). --- Datiert Berlin-Dahlem, Hechtgraben 4a, den 23. Februar 1932 bis 8. April 1939 (bei drei Postkarten ist die Jahreszahl des Poststempels nicht erkennbar). --- Walter de Laporte ist im Berliner Adressbuch von 1935 unter dieser Adresse als Dozent verzeichnet. --- Jeweils gerichtet an den Pfarrer von Hertzberg in Blankensee bei Trebbin, d.i. Otto Max Walter von Hertzberg, geboren am 17. Oktober 1900 in Königsberg in Preußen als Sohn des Kaufmanns Max von Hertzberg und der Anna Dreyer, seit 1930 Pfarrer in Blankensee bei Trebbin. --- Zitate: --- 23. Februar 1932: "Seit meiner Jugend ist der Sonntag in einem dürftigen Pfarrhaus meine schönste Erholung. Dürfen meine Frau u. ich Sie einmal dort besuchen." --- 19. Oktober 1932: "Wir freuen uns sehr, Sie Mitte Nov. besuchen zu dürfen. [. . .] Herzl. Grüße Ihr W. de Laporte." --- 5. Dezember 1933: "Wir danken Ihnen so sehr für Ihre liebe Einladung. Ich bitte es nicht als Phrase aufzufassen, daß ich das dringenste Bedürfnis habe, mich mit Ihnen als Theologen über gewisse Fragen (Deutschkirche pp.) auszusprechen. Nur ist es jetzt leider ganz unmöglich, wir haben einfach nicht mehr das Reisegeld." --- 16. Juli 1936: "Leider habe ich Ihren Aufsatz in der Dorfkirche, den ich an Minist. Darré persönlich sandte, nicht zurückbekommen. Nur ein Schreiben, daß das Schreiben zur Bearbeitung dem Stabe übergeben sei." --- Erwähnt ist der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft Walther Darré (1895-1953). --- Format: 10,3 x 14,7 cm. --- Über den Verfasser: Walter Karl Hermann Ferdinand de Laporte (eigentlich nur Laporte ohne "de") wurde am 23. September 1874 in Göttingen als Sohn des Kaufmanns Ludwig Laporte (geb. am 10. Dezember 1829 in Göttingen, wohl identisch mit dem Göttinger Handelskammerpräsidenten und Kaufmann Louis Laporte, seit 1873 Präsident der Freimaurer-Loge Augusta zum Goldenen Zirkel) und der Wilmine Berta Ida, geb. Bartling geboren und starb wahrscheinlich 1945. Er betrat erst die militärische Laufbahn, wurde 1907 als Oberleutnant pensioniert und studierte dann Staatswissenschaften (1910 Dr. iur. in Göttingen). Er wurde Syndikus in Göttingen und Wohnungsdirektor der Stadt Berlin. Am 6. August 1914 heiratete er in Berlin Elise Berta Amalie Haberstroh, geboren am 22. September 1892 in Holzminden als Tochter des Professors Hermann Haberstroh, Oberlehrer an der Baugewerkschule Holzminden, und der Antonie, geb. Astmann. Die Ehe wurde 1919 geschieden. Später ging er eine zweite Ehe ein. --- Zustand: Karten etwas fleckig und teilweise gebräunt. Signatur des Verfassers.
-
9 Briefe BERLIN 1861-69, von Angelika ALTHAUS, geb. Schüler (Ehefrau Philosoph)
Verlag: Berlin, 1861
Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert
EUR 90,00
Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Gut. 1. Auflage. Neun Briefe von 1861-69, meist aus Berlin (daneben einer aus dem Urlaub in Friedrichsroda). --- Geschrieben von Angelika Althaus, geb. Schüler (1808-1880), Ehefrau des Professors der Philosophie an der Universität Berlin Karl Heinrich Althaus (1806-1886). --- Gerichtet an eine gute Freundin und Patentante ihrer Tochter Adelheid Althaus, Julie Köpke, geb. Hanstein (1806-1885), eine Tochter des Berliner Theologen und Oberkonsistorialrats Gottfried August Ludwig Hanstein (1761-1821), Schwester des Berliner Schachspielers Wilhelm Hanstein (1811-1850) und Witwe des Geheimen Justizrats, Divisions-Auditeurs der 5. Division und Musikers Gustav Köpke (geb. 3. Juli 1805; gest. 10. Dezember 1859 in Glogau), einem Sohn von Gustav Köpke (1773-1837), Pädagoge, Philologe und Theologe, Direktor des Gymnasiums zum Grauen Kloster in Berlin und 1830-1832 einer der Lehrer Otto von Bismarcks. --- Umfang: ins. 31 beschriebene Seiten; jeweils ohne Umschlag. --- Format: meist 22,2 x 13,8 cm; die letzten beide Briefe 21,8 x 13,8 cm. --- Auszüge: Brief Berlin, 7. September 1861: "Ein seltsames Gefühl überkam mich, als Ihre Schriftzüge vom 27. August in meiner Hand ruhten; hatte ich doch in den vorangegangenen Tagen so viel an Sie und Ihrem Ergehen gedacht, daß es mir fast dünken wollte, meine Seele hätte sie gezwungen, sich mir in lieben Worten zu nahen und mir Kunde zu geben von Ihrem Leben und Treiben. [.] In Treue Ihre Angelika Althaus." --- 2.) Brief Berlin, 12. Juli 1864: "Augenblicklich sind wir mit dem Bau einer Gallerie für unsere Wohnung beschäftigt, die uns viel Verdruß verursacht, da der Baumeister einen polizeiwidrigen Plan erst entworfen und später der Ingenieur uns im Stiche gelassen, d.h. nicht pünktlich die Eisenarbeiten abgeliefert hat." --- 3.) Brief Berlin, 11. August 1864: "Adelheid hat mir froh und glücklich geschrieben, daß es mir ordentlich schwer geworden ist, ihr zu sagen, daß ihr Zeit um ist u. sie sich am Montag zur Abreise anschicken muß." --- 4.) Brief Berlin, 21. September 1864 (also einen Tag vor Julies 58. Geburtstag): "Da Du, liebe Freundinn, Dich gern in dunkle Farben kleidest, so habe ich Dir zum täglichen Gebrauch einen kleinen Putz der Art ausgesucht und wünsche, daß Du, wenn Du ihn anlegst, meiner dabei gedenken mögest. Für das Landleben ist er wohl geeignet. Mein l. Mann trägt mir auf Dir zu sagen, daß er morgen aus dem schönen Pokal auf Dein Wohl u. alles dessen trinken werden, was Deinem Herzen zur dauernden Freude gereichen kann." --- 5.) Brief Berlin, den 7. Juli 1865. Über den Tod einer guten Freundin, der Lehrerin Luise Wolf (geb. um 1808, gest. 21. Juni 1865 in Berlin) an der Königlichen Elisabethschule in Berlin, Kochstr. 65. "[.] es ist Einer der traurigsten Geburtstage mehr gewesen, welche ich in meinem Leben begangen, ein neues Glied hat er an die Kette der Erinnerungen zugefügt, welche dieser Tag immer neu in mir weckt. Stand ich doch wieder am Sterbebette einer geliebten Person, mit der mich der reifere Ernst der Jahre fast ein Menschenalter hindurch verband. Luise Wolf, mir so überlegen an Kenntnisse, Bildung an Charakter hielt mich werth Ihre Freundinn zu sein, sie, die so große Forderungen an sich selbst stellte; dies, ich läugne es nicht, hat mir oft Selbstbewußtsein u. Muth gegeben in den schwereren Tagen, wo Alles wankend erschien. Sie ist dahin; namenlose Leiden, die sie bedrängten, ließen zuletzt ihr Ende herbeisehnen. Am 14. Juny sahen wir uns zuletzt. [.] Berlin ist seit einigen Tagen auf die Beine um Herrn Blondin zu sehen, die Neugierde scheint sich von Tag zu Tag zu mehren. Das Ungeheuerliche reizt mich auch." --- Anm.: Gemeint ist der französische Hochseilartist Charles Blondin (1824-1897), der als erster die Niagara-Schlucht auf dem Hochseil überquerte. --- Die restlichen Briefe datiert Berlin, 23. August 1865, 27. Juli 1866 und 11. August 1869 sowie Friedrichsroda, 15. Augustr 1868. --- Zustand: Briefe gefaltet, Papier leicht gebräunt, mit einigen kleinen Randschäden. Signatur des Verfassers.
-
5 Briefe JABEL (Heiligengrabe) 1868-70, 2 Briefe IRLAND 1868 Lehrerin Marie WOLF
Verlag: Jabel (Heiligengrabe) und Irland, 1868
Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert
EUR 90,00
Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Gut. 1. Auflage. Fünf Briefe von 1868-70 aus Jabel (Heiligengrabe) in Brandenburg und zwei Briefe von 1868 aus Irland. --- Geschrieben von der Lehrerin und Gouvernante Marie Wolf, Tochter des Pastors Ernst Philipp Wolf (1812-1864), der 1861 als Prediger in Magdeburg zusammen mit dem Theologen Julius Diedrich (1819-1890) aus dem Oberkirchencollegium (OKC) suspendiert wurde, da er eine eigene separierte Gemeinde gegründet hatte. --- Julius Diedrich war von 1847 bis 1874 Pfarrer in Jabel; Marie Wolf gehörte dort zu seinem Kreis, sicherlich durch die Freundschaft ihres Vaters begründet. Er ist auch in den Briefen erwähnt. Sie wohnt in Jabel bei ihrer Stiefmutter Auguste Karoline Dorothee Wolf, geb. Schneider, die sie "Mamma" nennt. --- Gerichtet an ihre Freundin Adelheid Althaus (1846-1923) in Berlin, Tochter des Professors der Philosophie an der Universität Berlin Karl Heinrich Althaus (1806-1886). --- Anbei Fragment eines Briefes von 1869 (ohne Ortsangabe, wohl auch in Jabel geschrieben; der Anfang fehlend). --- Umfang: 33 beschriebene Seiten (davon sechs aus Irland). --- Jeweils ohne Umschlag. Ein Brief mit Adressierung auf dem Brief. --- Auszüge: --- Jabel, 28. Januar 1868: "Meine Brille sitzt ehrwürdig quer über meiner Nase und ein großer brauner Mantel fließt in etwas antiken Falten herab, sintemalen es kalt hier ist. " --- Jabel, 9. März 1868: "Well, my love, da hängt man ein Paar Pistolen über sein Bett u. wenn so ein Fenier die Nase zur Thür hineinsteckt, so läßt man ihn ins Gras beißen. Doch Spaß bei Seite - das wäre für mich auch ein Grund gewesen, danke schön zu sagen, aber Waterford liegt außer Schußlinie, am Meer in der ruhigsten Gegend - und außerdem werden sie ja eine arme deutsche Gouvernante nicht dem brittischen Nationalhaß gleich opfern [.]. Die schlechte Schrift kommt, weil ich alle gute Federn eingepackt habe." --- Waterford, care of R. Dobbyu, Esq., 2 Catherine street, Ireland, den 18. Mai 1868: "Ich bin sehr sehr glücklich hier, hätte es nicht besser treffen können. Sie sind Alle reizend u. die Kinder sind so feine, liebliche Mädchen, daß gewiß von den Jabler Unannehmlichkeiten in dieser Beziehung nichts zu verspüren ist. [.] Deine Dich herzl. liebende Marie Wolf." --- Dunmore, 19. September 1868: "Wir sind noch in Dunmore u. bleiben hier bis zum November vielleicht. Wir sind sehr fleißig; Du würdest ein komisches Quodlibet von Deutsch, Englisch u. Französisch hören zuweilen. Die Stunden beginnen früh, und nach Tisch gehen wir bis zum Thee spazieren. Das ist recht hübsch. [.]. Was das Sociale betrifft, so sind wir in einigen childrens parties u. einigen pic nics gewesen, u. neulich in einem vornehmen englischen Haus, Villa marina, dem einzigen Edelsitz in Dunmore, aber ich war nur eingeladen als Erzieherin von Lonie u. Nannie." --- Jabel, 30. Juni 1869: "So lange haben wir uns nicht geschrieben, beinah ein Jahr. [.] Dein ganzer Horizont ist ein andrer, als meiner leider jetzt ist; Du kannst unmöglich begreifen, wie und wo es mir fehlt. Siehst Du, ich war sehr glücklich in Irland, aber ich sah ein, daß ich immer hätte sehr glücklich sein können, wenn ich nicht selbst mir im Licht gestanden hätte. --- Jabel, 6. Februar 1870: "Sieh, ich kann mich gar nicht anders ansehen, als ein Glied des Reiches Christi, der hier in seiner Kirche einhergeht. Ich bleibe zuerst da, wo ich von Gott hingestellt bin, u. da Mamma mich brauchen kann zu Hannas Unterricht, so bleibe ich so lange hier, bis mich ein zwingender Grund wegruft. [.] Wir haben jetzt eine Zeit reicher Geselligkeit hier. Wir sind ein Kreis: Prediger Diedrichs Haus, Frl. v. Schenkendorff, D.'s Freundin ist für den Winter auch her in ein eignes Haus gezogen, u. regt zu Allerlei an; dann Wir, d.h. Mama, Tante, ich, u. Meyers, die liebe Lehrerfamilie. Wir kommen fast tägl. zusammen u. lesen u. treiben Allerlei, auch Dante wurde gelesen, Astronomie studirt u. außerdem Bekenntnisschriften u. Lutherlesen." --- Zustand: Papier gebräunt, teils leicht fleckig. Signatur des Verfassers.
-
Lt. Graf Benno von RITTBERG (1897-1972), 3. Garde-FAR: FP-Briefe FRANKREICH 1916
Verlag: bei Noyon, 1916
Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert
EUR 120,00
Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Gut. 1. Auflage. Vier Adels-Feldpostbriefe von 1916 aus Frankreich (bei Noyon). --- Der Leutnant Benno von Rittberg (1897-1972) im 3. Garde-Feldartillerie-Regiment, 2. Batterie, schreibt an Herrn F. Landstroth in Berlin-Charlottenburg. Laut den Brieftexten war Herr Langstroth ein Musiker aus den USA. --- Benno von Rittberg, ein Enkel des US-amerikanischen Diplomaten und Politikers Lewis D. Campbell (1811-1882), war damals mit seinem Regiment in Berlin stationiert. --- Datiert "im Felde", den 22. Januar bis 6. April 1916. --- Dem 3. Brief liegt eine Feldkostkarte bei, die mit dem Brief mitgesendet wurde. --- Zu dieser Zeit war sein Regiment in den Stellungskämpfen bei Roye-Noyon (Oktober 1915 bis Juli 1916) sowie in den Kämpfen von Frise (21. Januar bis 17. Februar 1916) tätig. --- Alle Briefe mit Umschlag. --- 1.) 2-seitiger Brief (18,6 x 13,8 cm) vom 22. Januar 1916. Auszüge: "Lieber Langstroth! [] Ich habe mich wohl etwas zu hart geäußert, wollte aber nur gern einmal etwas hören über Ihre Ansicht betreff Amerika, zumal Sie doch von da kamen. [] Es ist hier jetzt wirklich sehr ruhig. Wir sind in der Nähe von Noyon. Dort hörte ich in der Kathedrale am Sylvester ein herrliches Konzert. Man vermisst die Musik hier aber sehr. Wir haben hier sogar Hühner, Eichhörnchen, aber auch - Ratten. Sonst leben wir natürlich in unseren Unterständen unter der Erde. Mit vielen herzlichen Grüßen bleibe ich Ihr Benno Rittberg." --- 2.) 2-seitiger Brief (18,6 x 13,8 cm) vom 5. Februar 1916. Auszüge: "Wir haben hier eine so ruhige Stellung, daß sogar unsere Hühner täglich ein Ei legen! Heute ist dieser Friede eigentlich zum ersten Male gestört worden. Noch vor 20 Minuten bekamen wir hierher eine höllische Portion schweren Kalibers, etwa 20 Schuß, Glücklicherweise ohne Schaden anzurichten." --- 3.) 2-seitiger Brief (14,3 x 10,3 cm) vom 27. Februar 1916; mit einliegender, postalisch ungelaufener Feldpostkarte vom 26. Februar 1916, die im Brief mitgesendet wurde. Auszüge: [Karte]: "Lieber Langstroth! Leider wird es nichts mit meinem Urlaub. Wir wollen uns auf später vertrösten. Aber jetzt wo wir so glänzende Erfolge hier im Westen haben, möchte man doch nicht gern zu Hause sitzen! Seit gestern liegt hier Schnee." [Brief]: "Ich hatte Ihnen auch geschrieben, aber immer noch nicht die Möglichkeit gehabt, es abzusenden. Daher lege ich die Karte bei. Daß ich keinen Urlaub erhalten habe, beruht wohl mehr darauf, daß die Bahnen hinter der Front zu sehr in Anspruch genommen sind. Herrlich sind doch die Erfolge bei Verdun! Wie gern' wär ich dabei! [] Ich würde Sie zu gerne musizieren hören, vermisse die Musik sehr! [] Bewundere Sie, wie gut Sie die deutsche Sprache beherrschen!" --- 4.) 2-seitiger Brief (25,7 x 16,5 cm) vom 6. April 1916. Auszüge: "An dem Tode Ihrer lieben Frau Mutter nehme auch ich herzlichen Antheil! Wie plötzlich und ererwartet muß es doch für Sie gewesen sein, kamen Sie doch mit dem beruhigenden Gedanken aus America zurück, Ihre Mutter in besserer Gesundheit zu wissen. In Ihrer Musik werden Sie doch einen Trost finden. [] Wenn ich in Ruhe bin versäume ich kein Concert in Noyon. [] In der letzten Woche haben wir mehrfach Gefangene gemacht. [] Bei Verdun geht es ja langsam, aber wohl sicher! [] Von meiner Schwester Grace hörte ich vor einiger Zeit, daß sie zu einem Konzert eingeladen worden sei von Ihnen in der Amerikanischen Kirche. Nun bin ich schon über 1 Jahr lang Offizier! Wie doch die Zeit vergeht u. welch großen Umschwung dieser Krieg gebracht hat!" --- Über den Verfasser: Benno Georg Lewis Ernst Johannes Gotthelf Graf von Rittberg wurde am 1. Juni 1897 in Dresden als Sohn von Gotthelf August Benno Louis Graf von Rittberg (1860-1931) und der Grace, geb. Campbell (1861-1944) geboren und starb 1972. Seine Mutter war eine Tochter des US-amerikanischen Diplomaten und Politikers der United States Whig Party und der Demokratischen Partei Lewis D. Campbell (1811-1882). --- Zustand: Etwas fleckig. Signatur des Verfassers.
-
Mathilde HEFEL, geb. von ÖSTERREICH (1906-1991): vier Briefe SALZBURG 1957-1965
Verlag: Salzburg, 1957
Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert
EUR 120,00
Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Gut. 1. Auflage. Vier Adelsbriefe von 1957-1965 aus Salzburg. --- Eigenhändig geschrieben und mit Vornamen signiert von Mathilde Hefel, geb. von Österreich (1906-1991), Tochter von Erzherzog Franz Salvator von Österreich-Toskana (1866-1939) und der Erzherzogin Marie Valerie Mathilde Amalie von Österreich (1868-1924). --- Sie war seit 1947 die Ehefrau des österreichischen Politikers Dr. phil. Ernst Hefel (1888-1974). --- Gerichtet an eine Clara, d.i. die Gräfin Clara Ledóchowska (* 26. Juni 1911 in Sarns), Sekretärin bei der österreichischen Botschaft am Heiligen Stuhl (Vatikan). --- Umfang: ins. 12 beschriebene A5-Seiten; ohne Umschlag. --- Datiert Salzburg, Nonnberggasse 12 A, 1957-1965. -- Im Genealogischen Handbuch des Adels, Band 19 (1959), S. 74 ist sie unter dieser Adresse vereichnet; ihr Ehemann Ernst Hefel als Unterstaatssekretär a.D. und Sektionschef i.R. --- Auszüge: --- 1.) Brief Salzburg, den 7. Februar 1957: "Gräfin Aichelburg hatte ich kurz vorher bei einem Tee getroffen [.]. jetzt sind wir ein ganzes 'Sanatorium'; mit meiner Schwester Gertrud [.] u. das kleine 6jährige Mäderl von meinem Vetter Gottfried (Toskana) [.]. Wie schön muss es jetzt in Rom sein!!? Denn auch hier ist es schon ganz frühjährlich, ein unglaublich milder Winter! [.] ihre Adresse ist: Gräfin Margarethe Clam-Martinic, Schloss Klam bei Grein. [.] Von Ernst soll ich Dir viele herzliche Grüsse sagen. [.] Deine getreue Mathilde." --- 2.) Brief Salzburg, den 14. März 1964: "Ja, wir sind hier zu Ostern u. freuen uns riesig Dich wiederzusehen! [.] Wir haben die Enkelkinder von Ernst aus Wien bei uns über die Ostertage." --- 3.) Brief Salzburg, den 28. Februar 1965: "Liebe Clara! Tausend Dank für Deinen lieben Brief u. alle Deine Bemühungen [.] für unsere Audienz! [.] Habe das schon einmal so mitgemacht bei Pius XII. [.] Ich freue mich auch schon riesig mit Dir alles zu besprechen, Liturgieänderungen etc. etc. Es gibt so viel, was einen bewegt! [.] Bitte sage auch dem Botschafter unsern herzlichsten Dank [.]. Deine Mathilde." --- 4.) Brief Salzburg, den 27. September 1965: "Jetzt wirst Du ja wieder viel Arbeit u. Wirbel mit der begonnenen - letzten? - Konzilsperiode haben. Fast hofft man, es bringe nicht zu viele Neuerungen, - es ist doch schon so viel ins Schwanken geraten u. manche Unsicherheiten entstanden. Was meinst Du wohl zu allem? [.] ob Du so gut sein könntest, einen päpstlichen Segen, in Form so eines vorgedruckten Formulars mit Bild, zu beschaffen u. zwar für die (neue) Hr. Frau Äbtissin M. Ancilla Schneider O.S.B. anlässlich Ihres 60. Geburtstages am 14. Nov. 1965. Und bitte, wenn der Segen mit Unterschrift (von einem Kardinal?) versehen da ist, schicke ihn direkt an: 'Frau Gertrudis Herzog O.S.B., Stift Nonnberg, Salzburg', denn duese möchte es ihrer Äbtissin überreichen. [.] Es umarmt Dich von Herzen mit vielen lieben Grüssen, auch von Ernst, Deine stets getreue Mathilde." --- Zustand: Guter Zustand. Signatur des Verfassers.
-
Briefe SATTENHAUSEN (Gleichen) 1847-50, reformierter Pastor Hermann Althaus (1810-1888)
Verlag: Sattenhausen, 1847
Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert
EUR 150,00
Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Gut. 1. Auflage. Vier interessante Briefe von 1847-1850 aus Sattenhausen (heute OT von Gleichen). --- Geschrieben von Hermann Althaus (1810-1888), 1838-1855 reformierter Pastor in Sattenhausen bei Göttingen, ab 1856 Adjunkt und 1869 Amtsnachfolger seines Vaters Karl Philipp Christian Althaus (1775-1869) als Prediger an der reformierten Hofkirche in Hannover. --- Anbei ein Brief (1850) seiner Ehefrau Cornelia, geb. Schmidt (1826-1890), Tochter des Befreiungskämpfers und Verwaltungsjuristen Sophus Schmidt (1792-1841). --- Gerichtet an seinen Bruder, den Privatdozenten und späteren Professor der Philosophie Karl Heinrich Althaus (1806-1886) in Berlin. --- 1.) 4-seitiger Faltbrief, datiert Sattenhausen, den 21. Mai 1847. --- U.a. über eine eventuelle Schwangerschaft seiner Frau Cornelia; erwähnt ist ihr Onkel, der Gynäkologe Johann Friedrich Osiander (1787-1855): "Cornelia ist eben so lange elend gewesen, beständig übel und mattherzig, dessenungeachtet weiß bis jetzt noch Niemand auch nicht ihr Onkel Osiander der Mann vom Fach, ob dieses sonst so bezeichnende Uebelbefinden erfreuliche Folgen haben wird, da in ihrem äußeren Erscheinen keine Veränderung eben sichtbar ist [.]. Ich bin auch schrecklich dumm in diesen Dingen." --- 2.) 4-seitiger Faltbrief, datiert Sattenhausen, den 8. März 1849. --- U.a. über Ereignisse in Berlin: "Hast Du auch den Brand des Redernschen Hauses mit angesehen? Warst Du auch in dem Festsaal der geographischen Gesellschaft, von dem man mir in Rittmarshausen Wunderdinge erzählte? Die Leute hätten scheinbar auf dem Grunde des Meeres gespeist, über sich schwimmende Schiffe und neben sich schwimmende Seeungeheuer gesehen. Es wäre prächtig, wenn Du über das Fabelhafte dieser Eezählung herzlich lachen müßtest." --- Am Ende über Dorfgerüchte: "1. Sie haben in Berlin den König von Preußen weggejagt. 2. Der Kaiser von Rußland hat sich umgebacht. 3. Der König von Frankreich hat sich ersoffen." --- Signiert "Mit vielen Liebe Dein Bruder Hermann." --- 3.) 2-seitiger Faltbrief, datiert Sattenhausen, den 18. Februar 1850. --- Auszüge: "Auch feierten wir 3 Wochen nach meiner Rückkehr in Göttingen die Lind. Das aber rechne ich zu den höchsten Genüssen meines Lebens. Das Mädchen ist nicht bloß Sängerin, sie ist wahrhaft Poesie, und Alles, was die Poesie in ihrem ganzen Umfange bietet, das ist stellenweise in ihr verkörpert. Das Billet kostete 1 ½ rth. Auch das ist eine Merkwürdigkeit in ihrem Gesange, daß er alle versteckte Sünder reuig und wehmüthig macht. An enthusiastischen Ehrenbezeugungen, Fackelzügen, Comitirungen usw. hat es nicht gefehlt." Anm.: Jenny Lind (1820-1887) war eine schwedische Opernsängerin (Sopran). --- 4.) 2-seitiger Brief (mit einem halbseitigen Nachtrag der Ehefrau Cornelia), datiert Sattenhausen, den 12. September 1850. --- 5.) 3-seitiger Brief von Cornelia Althaus, geb. Schmidt, gerichtet an Angelika Althaus, die Frau von Karl Heinrich Althaus. --- Datiert Sattenhausen, den 29. Mai (ohne Jahr, vom Inhalt her 1850 geschrieben). U.a. über den Tod ihrer Schwester, d.i. Christiane Meyer, geb. Schmidt (* 20. Januar 1820, gest. im Wochenbett am 31. März 1850 in Bremen-Lehen, Gattin des Amtsassessors Adolph Ludwig Theodor Meyer (Heirat 1841): "Ach! nur mit der größten Wehmuth kann ich meines armen Schwagers gedenken, dessen ganzes Lebensglück zerstört ist und dem nun auch aller Lebensmuth fehlt. Die Zeit wird ja, wie überall auch seinen Schmerz lindern; aber die armen Kinder, ihnen fehlt die liebende Mutter für immer!" --- Auf der vierten Seite Tintenklecks, daneben Anmerkung: "Der Klecks schämt sich und bittet tausendmal um Entschuldigung!" --- Zustand: Papier teils etwas knittrig; Umschläge teils leicht schadhaft. Guter Zustand! Signatur des Verfassers.
-
Briefe HALLE 1831/32 Rosalie SCHERK, Frau Mathematiker Heinrich Ferdinand SCHERK
Verlag: Halle, 1831
Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert
EUR 160,00
Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Gut. 1. Auflage. Drei Briefe vom 1831/32 aus Halle (Saale). --- Verfasst von Rosalie Scherk, geb. Karo (* um 1805), Gattin des Mathematikers und Astronomen Heinrich Ferdinand Scherk (1798-1885), der bis 1833 a.o. Professor an der Friedrichs-Universität Halle war. Sie war die Mutter des australischen Politikers Theodor Scherk (geb. 1836 in Kiel, gest. 1923 in Adelaide). --- Gerichtet an "Frau Professorin Mußmann, hier", d.i. Angelika Mußmann, geb. Schüler (1808-1880), Ehefrau des Professors der Philosophie in Halle Johann Georg Mußmann in Berlin (1798-1833). Später heiratete sie den Privatdozenten und Professor der Philosophie in Berlin Karl Heinrich Althaus (1806-1886). --- 3.) 1-seitiger Brief (21,8 x 13,2 cm), dartiert Halle, den 25. April 1831. Geschrieben nach dem Tod eines Kindes: Ihre Tochter Helene Ferdinande Luise war am Tag zuvor im Alter von 2 Jahren gestorben. --- Auf der letzten Seite adressiert "an Frau Professorin Mußmann, wohlg. hier." --- Auszüge: "Meine liebe liebe Angelika, Wie von Herzen danke ich Dir, für die Freude u. Überraschung, die Du mir heut bereitet hast. Gerade in meiner jetzigen Stimmung thut mir der Beweiß Deiner Liebe recht in der Seele wohl, u. der Anblick dieser lieben Arbeit wird mir immer dem Bild und die Stunde vergegenwärtigen, die wir mit einander erlebten, u. gebe Gott noch erleben werden - denn sollen wir das Gute [.] nur finden, um es rasch wieder zu verlieren, um dann doppelt schmerzlich den Verlust zu empfinden?" --- Signiert "von Deiner Dich innigst liebenden Rosalie Scherk." --- 2.) kleiner 2-seitiger Brief (11,8 x 12,7 cm), datiert Halle, 18. Juli 1832. Ohne Umschlag. --- Auszüge: "Zum 3. August soll mit vielen Festlichkeiten der Grundstein zum hiesigen Universitätsgebäude gelegt werden. [.] Die Hofräthin Pfaff ist sehr wohl, u. denkt daran eine Reise nach Studtgard zu unternehmen." --- 3.) 4-seitiger Brief (21,8 x 13,2 cm), datiert Halle, 8. September 1832. Ohne Umschlag. --- Auszüge: "Geliebte Freundin, Lebten wir noch in jener guten alten Zeit, wo der bloße Wunsch hinreichte, um eine Bratwurst in die Schüssel fliegen zu lassen, so wäre dieser Brief gewiß schon längst in Deinen Händen. Aber jetzt wo wir auf eine ganz andere Weise erzogen werden, u. unsere Wünsche oft das ganze Leben hindurch forttragen müssen, würden auch diese Zeilen sich noch verzögert haben [.], wenn nicht Pro. Friedlaender eine seit Jahren besprochene Reise nach Königsberg endlich ausführte, u. über Berlin gehend sich zum Führer dieses Briefchens erboten hätte. [.] Dann über einen geplanten Umzug der Empfängerin in Halle. "Wie bestürzt die ganze Stadt über den neuen Ausbruch der Cholera, u. besonders über den plötzlichen Tod der Professorin Eisele war, hast Du wohl schon gehört. Die sonst so kräftige Frau hatte sich doch durch die vielen Gäste, die sie 4 Wochen in ihrem Hause bewirthete (täglich oft 15 Personen zu Tisch) zu sehr angestrengt. Dazu kam noch, daß einige Tage vorher ihr jüngster Sohn tödlich krank wurde und sie sich sehr ängstigte und bekümmerte; nun wurde auch noch ein Student, Abigel, in ihrem Hause plötzlich krank, welcher auch sehr rasch starb, was sie sehr erschreckte. Dein Dienstmädchen meint, daß dieser Student ein Zuhörer von Deinem lieben Mann wäre, u. Euch oft besucht hätte. Leider hatte er aus Höflichkeit zu spät nach Hülfe verlangt, er wurde des Abends krank, da er aber wußte, daß im Hause alles beschäftiget u. unwohl war, so wollte er nicht stören, u. wartete unter Schmerzen die Nacht hindurch. Als ihm das Frühstück gebracht wurde, erfuhr man erst sein Unwohlsein, u. obschon Krankenberg gleich herbeieilte, so war doch alle Hülfe zu spät." --- Zustand: Briefe gefaltet; Papier gebräunt und fleckig. Bitte beachten Sie auch die Bilder! Signatur des Verfassers.
-
Sprachforscher August Friedrich POTT (1802-1887): Briefe & Karte HALLE 1883/84
Verlag: Halle, 1883
Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert
EUR 200,00
Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Gut. 1. Auflage. Drei eigenhändige, signierte Briefe sowie eine beschriebene Visitenkarte des Sprachforschers August Friedrich Pott (1802-1887). --- Datiert Halle 1883/84; geschrieben im Alter von 80 bzw. 81 Jahren. --- Gerichtet an einen alten Freund, den Professor der Philosophie an der Universität Berlin Karl Heinrich Althaus (1806-1886) bzw. an dessen Kinder, den Berliner Landrichter Heinrich Georg Althaus (1845-1894) und Adelheid Althaus (1846-1923). --- 1.) 4-seitiger Brief an Karl Heinrich Althaus, datiert Halle, den 17. September 1883. Ohne Umschlag. --- Auszüge: "Lieber alter Freund! Du hast am 31. Aug. zu meinem 50j. Amtsjubiläum ein Telegramm geschickt, und überdies durch Dein liebenswürdiges Fräulein Tochter unterm 5. Sept. mir ein Schreiben der Beglückwünschung zugehen lassen. [.] Das Alter bringt mancherlei Schwächen und Gebrechen mit sich, es läßt sich nicht ändern. Ich selbst bin nicht ganz frei davon, indem mir der catarrhus senilis öfters das Athmen und damit die Bewegung erschwert. --- Es folgt eine sehr ausführliche und farbige Schilderung eines geplanten Besuchs von Kaiser Wilhelm I. am 16. September 1883 in Halle. Die ganze Stadt hatte sich vorbereitet, doch der Kaiser sagte per Telegramm wegen Unwohlseins ab. "Da sah sich denn jedermann in nicht besonders angenehmer Weise enttäuscht." --- Am Ende über die Feier seines 50-jährigen Amtsjubiläums. --- Signiert "Dein getreuer alter Freund A.F. Pott." --- 2.) 2-seitiger Brief an die Tochter Adelheid Althaus, ebenfalls datiert Halle, den 17. September 1883. Offensichtlich wurde das Schreiben dem Brief an Karl Heinrich Althaus beigegeben, der die letzte halbe Seite mit einem Nachtrag an seine Tochter versehen hat und an diese verschickt hat. --- Mit dem von Karl Heinrich Althaus adressierten Umschlag an seine Tochter, mit Poststempel Berlin, 19. September 1883. --- Auszüge: "Verehrtes Fräulein! Gestatten Sie mir außer den an Ihren Herrn Vater, meinen langjährigen Freund, gerichteten Schreiben noch einige Worte des Dankes für den Antheil, den Ihre Feder an der mir von jenem zugedachten Beglückwünschung hat nehmen müssen." --- Signiert "Ihr ganz ergebenster Prof. A.F. Pott." --- 3.) Visitenkarte (6,2 x 10 cm) Halle, den 27. November 1883, im Briefumschlag, Gerichtet an den Landrichter Heinrich Althaus mit Glückwünschen zu seiner Verlobung mit Marie von Dechend (1855-1914), Tochter des Reichsbank-Präsidenten Hermann von Dechend (1814-1890). --- Auszüge: "Geehrter Herr Landrichter! So eben ist mir die Nachricht Ihrer Verlobung mit Fräulein von Dechend zugegan[gen]. Indem ich nun für die gütige Anzeige des frohen Ereignisses meinen besten Dank abstatte, kann ich nur in meiner Frau wie im eigenen Namen Ihnen selbst, wie unbekannter Weise Ihrer Verlobten, unsere herzlichsten Glückwünsche hiezu darbringen." --- 4.) 2 ½-seitiger Brief an den Landrichter Heinrich Althaus, datiert Halle, den 14. Januar 1884. --- Auszüge: "Geehrter Herr Landrichter! Alsbald nach Ihrem Schreiben wendete ich mich an unseren Universitätssectetair, kürzlich zum Kanzleirath ernannten Herrn Rose, ihn um Ermittelung des Promotions-Tages Ihres Herrn Vaters ersuchend. Sie hatten vermuthungsweise den 24. oder 25. März des J. 1834 angegeben. Inliegender Zettel, den ich so eben von jenem Herrn durch den Pedellen erhielt [.], giebt an, in jenen 3 Jahren könne der Decanats-Acten gemäss nicht füglich Ihr lieber Vater am hiesigen Orte promovirt sein. [.] Von Ihrer Anfrage bei mir ist natürlich tiefes Stillschweigen beobachtet. So dürfen Sie denn auch wohl keinen Gruss an ihn und Ihr Fräul. Schwester von mir bestellen, wohl aber an Ihr Fräulein Braut. Hochachtungsvoll ergebenst Prof. A.F. Pott, Halle, Barfüsser Str. 6a." --- Beiliegend Zeitungsausschnitt (10,3 x 11,5 cm) von 1887 mit einem Nachruf auf Pott, wohl aus einer Berliner Zeitung, da auf seine Zeit in Berlin besonders eingegangen wird. --- Zustand: Papier gebräunt, die (teils schadhaften) Umschläge stärker. Ein Brief mit kleiner Fehlstelle. Signatur des Verfassers.
-
Jurist & Politiker Rudolf von GNEIST (1816-1895) Brief BERLIN 1872 & Briefe Frau
Verlag: Berlin, 1872
Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland
Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert
EUR 220,00
Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Gut bis sehr gut. Ohne Schutzumschlag. 1. Auflage. Eigenhändiger, signierter Brief des Juristen und Politikers Rudolf Gneist, ab 1888: Rudolf von Gneist (1816-1895), ordentlicher Professor an die Berliner Universität. --- Anbei zwei Briefe und eine Visitenkarte seiner Ehefrau Marie, geb. Boeckh (1831-1913), eine Tochter des Altphilologen August Boeckh (1795-1867). --- 1.) 4-seitiger Brief von Rudolf Gneist, datiert Berlin, den 29. August 1872. --- Gerichtet an einen Kollegen, d.h. an einen anderen Professor der Universität Berlin. Gemeint ist der Professor der Philosophie Karl Heinrich Althaus (1806-1886). --- Auszüge: "Ich kann indessen Berlin nicht verlassen, ohne Ihnen meinen aufrichtigen Dank für das Geschenk Ihrer Schrift zu sagen, mit welchem Sie mich so hoch geehrt haben. Gewiß haben Sie einen der Punkte zum Gegenstand Ihrer tiefdurchdachten Erörterung gewählt, der zu den berechtigten Eigenthümlichkeiten unseres deutschen Lebens gehört, - die allseitige Berufung auf das Recht der subjetiven Überzeugung, deren Unvereinbarkeit mit einem einheitlichen nationalen Willen schwer verständlich bleibt, und der gerade heute durch tiefgespannte gesellschaftliche und confessionelle Gegensätze immer unversöhnlicher sich gegeneinander zu spannen scheint." --- Anm.: Gemeint ist Karl Heinrich Althaus' Werk "Von der Überzeugung, insbesondere der religiösen. Eine Rede", Leipzig, Otto Wigand 1872 (2. Auflage 1873; 3. Auflage 1881). --- Gneist führt noch auf weiteren knappen zwei Seiten seine Gedanken über dieses Werk fort und knüpft leitet dann zu einer eigenen Schrift über ("Der Rechtsstaat", Heidelberg und Berlin, Springer 1872). --- "Verlieren Sie nicht die Geduld und den Muth in diesem verworrenen Streit, und seien Sie versichert der aufrichtigen Hochschätzung Ihres ergebenen Rud. Gneist." --- 2.) 4-seitiger Brief der Ehefrau Marie Gneist, geb. Boeckh, datiert Karlsbad, den 25. August 1880. --- Mit dem originalen Umschlag (Poststempel Carlsbad Stadt, 26. August), adressiert an "Frau Professor Althaus, Berlin W., Behrenstr. 69." --- Gerichtet also an Karl Heinrich Althaus' Ehefrau Angelika Luise Althaus, geb. Schüler (* 14. Januar 1808 in Berlin; gest. am 25. August 1880 ebd.); geschrieben an deren Todestag! --- Auszüge: "Theure verehrte Frau, seit 6 Wochen bin ich zu einer Kur in Karlsbad, und war vor meiner Abreise so leidend und elend, daß ich mir nicht mehr die Freude machen konnte, liebe Freunde und Bekannte noch einmal zu sehen. Zu meiner großen Betrübniß höre ich soeben hier durch eine uns und Ihnen gemeinsam befreundete Familie, daß Sie wieder so ernstlich leidend sind, und daß die Besserung, welche eine Zeitlang in Ihrem Zustande eingetreten war, nicht von Dauer gewesen ist. [. . .] Mein Mann, der seit einigen Tagen auch hier ist, empfiehlt sich Ihnen und mit mir Ihrem verehrten Herrn Gemahl und Fräulein Adelheid auf das herzlichste. In treuer Anhänglichkeit Ihre aufrichtig ergebene Marie Gneist." --- 3.) Brief von Marie Gneist, geb. Boeckh, datiert Berlin, den 25. Januar 1881. Gerichtet an die Tochter Adelheid Althaus. --- Umfang: 2 Seiten (15,8 x 10 cm); ohne Umschlag. --- Auszüge: "Liebes Fräulein, haben Sie und Ihr verehrter Herr Vater herzlichen Dank für das liebe Bild Ihrer guten Frau Mutter. Ich finde es sehr gut und ähnlich, - wenn es auch dadurch etwas Fremdes hat, daß es mehr ihre früheren Jahre vergegenwärtigt, so ist es mir, die ich sie in jugendlicheren Jahren auch gekannt habe, doch auch an diese Zeit eine sehr liebe Erinnerung [. . .] Mit besten Empfehlungen an Ihren Herrn Vater Ihre Marie Gneist." --- Beiliegend Vistenkarte (5,2 x 8,8 cm), mit Aufdruck: "Frau Marie Gneist, geb. Boeckh." --- Zustand: Papier gebräunt und etwas fleckig; der erste Brief knittrig. Signatur des Verfassers.