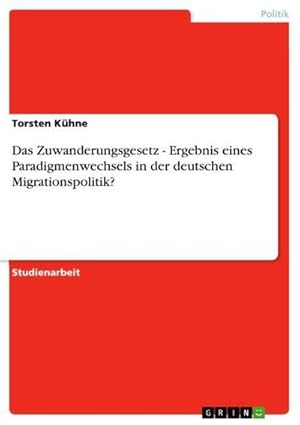torsten kuhne (7 Ergebnisse)
Produktart
- Alle Product Types
- Bücher (7)
- Magazine & Zeitschriften
- Comics
- Noten
- Kunst, Grafik & Poster
- Fotografien
- Karten
- Manuskripte & Papierantiquitäten
Zustand
Einband
- alle Einbände
- Hardcover
- Softcover (7)
Weitere Eigenschaften
- Erstausgabe
- Signiert
- Schutzumschlag
- Angebotsfoto (5)
Gratisversand
- Versand nach USA gratis
Land des Verkäufers
Verkäuferbewertung
-
Das Zuwanderungsgesetz - Ergebnis eines Paradigmenwechsels in der deutschen Migrationspolitik?
Verlag: GRIN Verlag, 2008
ISBN 10: 3638927423ISBN 13: 9783638927420
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Politik - Politische Systeme allgemein und im Vergleich, Note: 2,0, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Politische Wissenschaft), Veranstaltung: Proseminar:Migrations- und Integrationspolitik in Europa, Sprache: Deutsch, Abstract: EinleitungDie vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Wandel in der bundesdeutschen Migrationspolitik nach 1945. Sie geht als Längsschnittvergleich der Frage nach, in wie weit ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat und wie sich dieser in der Gesetzgebung, mit dem Schwerpunkt auf dem 'Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern' (kurz: Zuwanderungsgesetz), wieder findet und ausmachen lässt. Dazu werden die einzelnen Stationen der Entwicklung dargestellt und die Beweggründe dafür kurz aufgezeigt und analysiert. Die Arbeit stütz sich dabei auf einschlägige Sekundärliteratur und Internetpublikationen.Es ergibt sich eine Grobgliederung in drei Bereiche: Einmal das Nachzeichnen der historischen Entwicklungen mit den wichtigsten, migrationspolitisch relevanten Merkmalen wie Wanderungssituationen, politischen Aussagen dazu und politische Behandlung derselben. Zum Zweiten das Zuwanderungsgesetz, hier werden seine Entwicklung und die sie beeinflussenden Faktoren dargestellt. Der dritte Bereich widmet sich der Einschätzung ob und wenn ja, wie ein Politikwechsel stattgefunden hat und wie er zu beurteilen ist.Im Detail ist die Arbeit wie folgt aufgebaut: Das erste Kapitel ist der Migrationspolitik nach dem zweiten Weltkrieg gewidmet. Es werden die einzelnen Wanderungsbewegungen und ihre Gründe umrissen. Des weiteren wird das damalige migrationspolitische Paradigma der Bundesregierungen vorgestellt und die Gesetzgebung die Immigration betraf. Der Zusammenhang zwischen dem Paradigma und der Gesetzgebung wird kurz erläutert. In Kapitel zwei wird der Wandel in der Migrationspolitik ab 1998 dargestellt. Es wird gezeigt wie er sich äußerte und welche legislativen Maßnahmen daraus folgten. Zudem werden die Faktoren genannt die zu diesem Wandel beitrugen. Den Paradigmenwechsel besiegeln sollte das Zuwanderungsgesetz. Seine Entstehungsgeschichte mit den wichtigsten Einflussvariablen, den wesentlichen Akteuren und deren Agieren ist in Kapitel drei dargestellt. Dem schließt sich, in Kapitel vier, eine Diskussion an, wie der Paradigmenwechsel und das Zuwanderungsgesetz zu bewerten sind. Dazu werden die Einschätzungen ausgewählter Autoren miteinander verglichen und die in Kraft getretene Form des Zuwanderungsgesetzes bewertet. Die Schlussbetrachtung fast die Arbeit kurz zusammen und enthält eine knappe Einschätzung der Entwicklungen.
-
Die Umsetzung der Lissabon-Strategie in Frankreich
Verlag: GRIN Verlag, 2008
ISBN 10: 3640232593ISBN 13: 9783640232598
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Thema: Europäische Union, Note: 1,3, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Institut für Politische Wissenschaft), Veranstaltung: Die Rolle Frankreichs, Großbritanniens und der Bundesrepublik Deutschland in der EU, Sprache: Deutsch, Abstract: In der deutschen wissenschaftlichen Literatur und den Dokumenten der Europäischen Union findet sich zwar viel über die Maßnahmen der Lissabon-Strategie und den Fortschritt, beziehungsweise den Rückstand ihrer Implementierung in Frankreich, aber wenig darüber, warum dieser Rückstand existiert und welche Einflussvariablen bei der Umsetzung eine Rolle spielen. Die vorliegende Arbeit soll deswegen diesen Themenkomplex beleuchten und hat das Ziel Informationen über die Umsetzung der 'Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung' in Frankreich und über die (politischen) Hintergründe welche diese beeinflussen, zusammen zu tragen. Sie geht dabei der Frage nach, wie die in der Lissabon-Strategie festgelegten Ziele in Frankreich angenommen werden und welche politischen und gesellschaftlichen Faktoren die Umsetzung beeinflussen.Um an das Thema hinzuführen werden in Kapital zwei die Rahmenbedingungen des Entstehens der Lissabon-Strategie und die in ihr enthaltenen Ziele dargestellt. Darauf folgt eine Erläuterung der französischen Position zur Wirtschaftspolitik der Europäischen Union und der darin enthaltenen Konfliktherde. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Analyse der Position Frankreichs zur Lissabon-Strategie unter 3.2 ein. Basierend auf den hierbei erhaltenen Ergebnissen wird in Abschnitt vier ausgearbeitet wie die Lissabon Strategie in Frankreich umgesetzt wird und welche Faktoren die Implementierung der einzelnen Ziele beeinflussen. Dabei werden Anhand des Nationalen Reformprogramms und der Dokumente der Europäischen Union sowohl die Maßnahmen, mit denen Frankreich sich die Lissabon-Strategie zu eigen machen möchte, als auch die Resultate die damit bisher erzielt wurden, benannt und bewertet. In Abschnitt fünf erfolgt abschließend eine Zusammenfassung der gewonnen Erkenntnisse und ein daraus abgeleiteter Ausblick was hinsichtlich der Umsetzung der Lissabon-Strategie in nationale Maßnahmen in Zukunft von Frankreich zu erwarten ist.
-
Krise der deutschen Gewerkschaften - Symptome, Ursachen und Lösungsansätze
Verlag: GRIN Verlag, 2008
ISBN 10: 3638943437ISBN 13: 9783638943437
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Politik - Politische Systeme - Politisches System Deutschlands, Note: 1,7, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Institut für Politikwissenschaft), Veranstaltung: Staat und Verbände, Sprache: Deutsch, Abstract: Die tief greifenden Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt gehen auch an den Gewerkschaften der Bundesrepublik Deutschland nicht spurlos vorüber. Ganz im Gegenteil, sie werden heftig gebeutelt und zum Sündenbock für die schlechte wirtschaftliche Lage gemacht. Woher kommt das Die Gewerkschaften waren doch lange Zeit eine anerkannte Größe in der deutschen politischen Landschaft. In der letzten Dekade fiel es ihnen jedoch immer schwerer innovative Ergebnisse zu liefern und sie beschränkten sich darauf lauthals aufzuschreien, wenn neue Einschnitte im Sozialsystem verkündet wurden. In den Medien ist 'Gewerkschafts-bashing' zur Mode geworden. (Klingenburg 2003, S.1). Es ist nicht zu übersehen, die Gewerkschaften machen eine schwierige Zeit durch. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der aktuellen Krise der deutschen Gewerkschaften und geht der Frage nach: was sind die Symptome und Ursachen dafür Mit welchen Korrekturen könnten sich die Gewerkschaften daraus befreien und welche Gestaltungsmöglichkeiten bieten sich für die Zukunft an Ziel ist es die gewonnenen Erkenntnisse thematisch zu sortieren und mögliche Lösungen aufzuzeigen.Zur Ausarbeitung wurde einschlägige Sekundärliteratur verwendet wobei darauf geachtet wurde, dass möglichst alle Sichtweisen auf das Thema durch eine Quelle vertreten sind. So fanden sowohl Werke aus dem gewerkschaftsnahen Umfeld als auch aus der wirtschaftsliberaleren Ecke Eingang, auch der politikwissenschaftliche Blickwinkel wurde berücksichtigt. Wenn im folgenden Text der Begriff Gewerkschaften verwendet wird meint dieser, soweit nicht anders erwähnt, die deutschen lndustriegewerkschaften und ihre Dachverbände, mit Schwerpunkt auf dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und dem ihm angehörigen Gewerkschaften.Aufgebaut ist die Arbeit folgendermaßen: Als Hinführung zum Thema werden die Gewerkschaften und der rechtliche Rahmen, in dem sie sich bewegen, kurz skizziert. In Kapitel drei werden die aktuellen und schwerwiegendsten Probleme, vor denen die Gewerkschaften stehen, dargestellt und es wird erläutert in wie weit sich diese Probleme auf die Gewerkschaften auswirken und wie sie entstanden sind. Erster Punkt ist dabei der drastische Verlust von Mitgliedern, mit dem die Arbeitnehmerverbände seit Jahren kämpfen. Die Auswirkungen und Ursachen der veränderten Mitgliederstruktur, des soziokulturellen und sozioökonomischen Wandels und des aktuellen Weltbildes der Gewerkschaften kommen zur Sprache.
-
Das französische und das deutsche Verbandssystem im Vergleich
Verlag: GRIN Verlag, 2008
ISBN 10: 3640188489ISBN 13: 9783640188482
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Politik - Politische Systeme allgemein und im Vergleich, Note: 1,3, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Institut für Politische Wissenschaft), Veranstaltung: Hauptseminar Frankreich unter Sarkozy, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Grundlage eines jeden demokratischen Regierungssystems ist eine funktionierende Interessenartikulation vom Volk zu der von ihm gewählten Regierung. Artikulationsorgan des Souveräns sind die Verbände. Aus diesem Grund sind die Staat - Verbände Beziehungen und ihr Funktionieren von Interesse für die Politische Wissenschaft.Die vorliegende Arbeit setzt sich mit den Verbandssystemen der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich auseinander. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem französischen System. Anhand eines qualitativen Vergleichs der polity und der politics Dimension, sowie einer Auseinandersetzung mit den Typologien der Verbandsforschung, wird herausgearbeitet wie die Systeme ausgestaltet sind, welche Konsequenzen und Möglichkeiten sich daraus ergeben und welche Hintergründe für die jeweilige Situation verantwortlich sind. Der Focus des Vergleichs ruht auf den Verbänden der Wirtschafts- und Arbeitswelt. Die Zielsetzung der Arbeit ist einen Beitrag zum Verständnis des Funktionierens der beiden Verbandssysteme zu liefern. Dies geschieht durch das Zusammentragen und Gegenüberstellen der wesentlichen Merkmale der jeweiligen Staat - Verbände Beziehung. Hierbei wird besonders auf die Akteure, ihre Einflusskanäle, den geschichtlichen Entwicklungen und die daraus resultierende rechtlichen Verankerung eingegangen. Zudem werden die gängigen Zuordnungen der beiden Systeme zu den Typologien Korporatismus und Pluralismus, wobei Deutschland normalerweise ersterem und Frankreich eher dem letztgenannten zugeschlagen wird, anhand der gewonnenen Erkenntnisse überprüft. Zum Einstieg werden im zweiten Kapitel die Methoden des politikwissenschaftlichen Vergleichs und die Systemtypologien im Groben erklärt. Der dritte Abschnitt setzt sich mit dem französischen Verbandssystem, seiner Struktur und den bestehenden Einflusskanälen auseinander und erläutert die geschichtlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen auf denen die Staat- Verbände Beziehung basiert. Im vierten Kapital wird, parallel zum Aufbau des dritten Kapitels, die Situation in Deutschland in ihren wesentlichen Punkten vorgestellt. In der abschließenden Zusammenfassung werden die wichtigsten Erkenntnisse aus beiden Abschnitten einander gegenübergestellt, eine Beurteilung über die gängige typologische Einordnung getroffen und ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Verbandslandschaften in beiden Ländern gegeben.
-
Öffentlich Private Partnerschaften (ÖPP) ¿ Wundermittel für klamme Kommunen?
Verlag: GRIN Verlag, 2008
ISBN 10: 3640184904ISBN 13: 9783640184903
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Wirtschaftspolitik, Note: 2,3, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Institut für Politische Wissenschaft), Veranstaltung: Hauptseminar Local Governance, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Öffentlich Privaten Partnerschaften, mit dem Ziel Informationen aus verschiedener Perspektive zusammen zutragen, um eine Übersicht über das Thema zu erhalten und die Frage zu beantworten, ob Öffentlich Private Partnerschaften die Rettung für finanzschwache Kommunen sind, wenn es darum geht, die öffentlichen Aufgaben trotz leerer Kassen wahr zu nehmen. Dafür werden Texte aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Fachrichtungen sowie graue Literatur ausgewertet und die angeführten Argumente einander gegenübergestellt. Der Aufbau der Arbeit möchte auch dem mit der Materie nicht vertrauten Leser einen guten Einstieg in das Thema ermöglichen. Deshalb wird im ersten Teil des Textes eine Begriffsklärung vorgenommen, um Klarzustellen um was es sich bei einer Öffentlich Privaten Partnerschaft handelt, welche Konstellationen sich hinter dem Begriff verbergen und wer die dabei handelnden Akteure sind. Zudem werden die verschiedenen Modelle, die als 'tool box' für eine Privat Public Partnership zur Verfügung stehen, mit ihren Unterschieden vorgestellt und graphisch veranschaulicht. Die Faktoren, die eine Öffentlich Private Partnerschaft begünstigen, und zu einem Anwachsen derselben in der Bundesrepublik geführt haben sowie die positivern Effekte einer solchen Partnerschaft werden in Kapitel 4 dargelegt. Darauf aufbauend werden im Abschnitt 'Chancen und Risiken' die Chancen, welche eine Öffentlich Private Partnerschaft für die Beteiligten bietet, den Risiken und Gefahren für eine Kommune beim Abschluss einer solchen Kooperation entgegen gestellt. Hierbei werden die Probleme, die im Vorfeld, während der Projektphase, sowie nach Ende der Vertragslaufzeit auftreten können, näher spezifiziert. Anhand der betrachteten Argumente wird im Teil 6 auf die eingangsgestellte Frage eingegangen, welche Chancen Öffentlich Private Partnerschaften den Kommunen zur Auflösung des Investitionsstaus geben.
-
Das Zuwanderungsgesetz - Ergebnis eines Paradigmenwechsels in der deutschen Migrationspolitik?
Verlag: GRIN Verlag, 2008
ISBN 10: 3638927423ISBN 13: 9783638927420
Anbieter: Buchpark, Trebbin, Deutschland
Buch
Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut - Gepflegter, sauberer Zustand. | Seiten: 24.
-
Der Währungsfonds als Instrument alter Mächte? : USA, Deutschland und die EU: Positionen und Rollenbilder in der Reformdebatte
Verlag: Tectum Verlag, 2011
ISBN 10: 3828825753ISBN 13: 9783828825758
Anbieter: Buchpark, Trebbin, Deutschland
Buch
Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut - Gepflegter, sauberer Zustand. Außen: angestoßen, Knick. Aus der Auflösung einer renommierten Bibliothek. Kann Stempel beinhalten. | Seiten: 109 | Sprache: Deutsch.