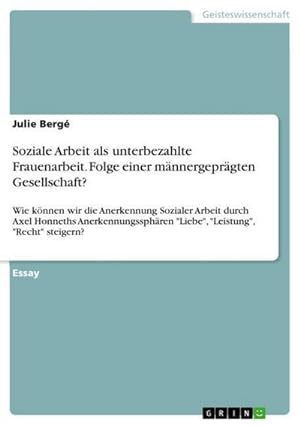julie bergé (4 Ergebnisse)
Produktart
- Alle Product Types
- Bücher (4)
- Magazine & Zeitschriften
- Comics
- Noten
- Kunst, Grafik & Poster
- Fotografien
- Karten
- Manuskripte & Papierantiquitäten
Zustand
Einband
- alle Einbände
- Hardcover
- Softcover (4)
Weitere Eigenschaften
- Erstausgabe
- Signiert
- Schutzumschlag
- Angebotsfoto (3)
Gratisversand
- Versand nach USA gratis
Land des Verkäufers
Verkäuferbewertung
-
Das "Gemeinwesen Knast". Rückfallpräventive Gemeinwesenarbeit im Jugendstrafvollzug
Verlag: GRIN Verlag, 2014
ISBN 10: 3656726671ISBN 13: 9783656726678
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Soziale Arbeit / Sozialarbeit, Note: 1,0, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Stuttgart, Horb, früher Berufsakademie Stuttgart; Horb, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Seminararbeit besitzt den Themenschwerpunkt der Gemeinwesenarbeit (GWA). Ein gemeinwesenorientierter Ansatz, der die Komplexität eines Systems ganzheitlich wahrnimmt, mit Hilfe von Partizipation und kooperativer Arbeit Strukturen in ihrem Kern modifizieren kann, ist von äußerster Notwendigkeit, besonders wenn wir die Ziele des Strafvollzugs in den Blick nehmen: 'Im Vollzug der Jugendstrafe sollen die jungen Gefangenen dazu erzogen werden, in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen', besagt1 JVollzGB und demonstriert damit den mit der Altersklasse der 14 bis 21-jährigen verbundenen Erziehungsauftrag. Ziel des Strafvollzugs ist laut2 JVollzGB I, dass dieser insbesondere dem Schutz der Bevölkerung dient, als er auch 'einen Beitrag für die Eingliederung der Gefangenen in die Gesellschaft, die innere Sicherheit und den Rechtsfrieden [zu] leisten' hat. Welch triviale Paradoxie sich dahinter verbirgt, wird deutlich, wenn wir die Ziele gegenüberstellen: Einerseits soll der Gefangene isoliert und separiert von der Gesellschaft untergebracht sein, andererseits soll er parallel dazu in eben diese Gesellschaft eingegliedert werden. Dieser Konflikt soll im Folgenden unter der zentralen Fragestellung 'Welche Möglichkeiten einer rückfallpräventiven GWA gibt es im Jugendstrafvollzug ' diskutiert werden und die Möglichkeiten einer Öffnung des Vollzugs zum Gemeinwesen als Gesellschaft hin überprüft werden.Daher beginnt diese Arbeit zunächst mit einigen Hintergründen zum deutschen Jugendstrafvollzug. Dieses Kapitel greift wesentliche Erkenntnisse der vergangenen Arbeit erneut auf und stellt, fokussiert auf die (große) Gruppe der Rückfalltäter, mögliche Hypothesen für ein Misslingen des Erziehungs- und Resozialisierungsauftrags des Strafvollzugs dar. Auf Grund des Rahmens dieser Studienarbeit habe ich mich bewusst ausschließlich auf die kritischen Faktoren des Strafvollzugs konzentriert. Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit theoretischen Hintergründen der GWA, wobei vertieft die drei Formen der GWA aufgegriffen und in Bezug zum Jugendstrafvollzug und den gebildeten Hypothesen bzw. einer Rückverfallverhinderung gesetzt werden. Es werden spezifische Gestaltungsmöglichkeiten 'Brainstorming' -ähnlich angesetzt und diskutiert.
-
Soziale Arbeit als unterbezahlte Frauenarbeit. Folge einer männergeprägten Gesellschaft? : Wie können wir die Anerkennung Sozialer Arbeit durch Axel Honneths Anerkennungssphären "Liebe", "Leistung", "Recht" steigern?
Verlag: GRIN Verlag, 2014
ISBN 10: 3656728321ISBN 13: 9783656728320
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Essay aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Soziale Arbeit / Sozialarbeit, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Stuttgart, Horb, früher Berufsakademie Stuttgart; Horb, Sprache: Deutsch, Abstract: 'Und dafür muss man studieren ' Eine Frage, der sich mit hoher Wahrscheinlichkeit der Großteil der SozialarbeiterInnen im Laufe der eigenen Karriere auseinandersetzen muss. Die Infragestellung der professionellen Identität von SozialarbeiterInnen ist nicht selten auf perpetuierte Rollenbilder zurückzuführen, die Soziale Arbeit als weiblich codierte 'Semi-Profession' abwerten.Im Zentrum diesen Essays steht die These, dass Soziale Arbeit in einer männerdominierten Gesellschaft auf Grund ihres Berufsstandes als 'Frauenberuf' in ihrer Profession eine Abwertung erfährt.Ein kurzer Abriss der Entstehungsgeschichte sozialer Arbeit zu Beginn des Essays demonstriert, wie eng die Geschichte der S.A. mit Frauenbewegungen und frühen Emanzipationsbestrebungen verknüpft ist und wie sie sich zunehmends zu einem 'weiblich dominierten' Berufsfeld entwickelt hat. Eine generelle Subordination der Frau bzw. weiblich konnotierter Merkmale unter den Mann bzw. das 'Männliche' wird dabei aus historischer Perspektive sichtbar.Anschließend findet entlang des 'Stratifizierungssignets Geschlecht' eine kurze Standortbestimmung sozialer Arbeit in der 'Statushierarchie der Anerkennung' statt. Dazu bediene ich mich des anerkennungstheoretischen Konzepts Axel Honneths. Entlang der drei Anerkennungssphären Liebe, Leistung und Recht werden im dritten Kapitel die aktuellen Professionalisierungsstrategien - sprich Aufwertungsversuche - Sozialer Arbeit beschrieben.Die unterschiedlichen Argumentationsstränge und Aufwertungsstrategien werden dann im vierten Kapitel kritisch reflektiert und auf Ambivalenzen bzw. auch auf eventuelle Kompatibilität überprüft. Gleichzeitig findet eine Beantwortung der Frage statt, unter welchen Bedingungen soziale Arbeit nun -aus meiner Sicht - eine Höherwertung erreichen könnte und wie disponibel die momentane Lage der Sozialen Arbeit ist.Dieser Essay bleibt primär auf die Darlegung theoretischer Standpunkte beschränkt und beschäftigt sich daher weniger mit der konkreten Verwirklichung in der Praxis.Auf Grund der Genderthematik ist dieser Text geschlechtergerecht formuliert.
-
Das "Gemeinwesen Knast". Rückfallpräventive Gemeinwesenarbeit im Jugendstrafvollzug
Verlag: GRIN Verlag, 2014
ISBN 10: 3656726671ISBN 13: 9783656726678
Anbieter: Buchpark, Trebbin, Deutschland
Buch
Zustand: Wie neu. Zustand: Wie neu | Seiten: 32.
-
Voll Sinn-voll. Klientenzentrierte Gesprächsführung im Rahmen des § 16a SGB II mit hochsensiblen Persönlichkeiten
Verlag: GRIN Verlag, 2014
ISBN 10: 3656685525ISBN 13: 9783656685524
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Buch
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Bachelorarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Soziale Arbeit / Sozialarbeit, Note: 1,1, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Stuttgart, früher: Berufsakademie Stuttgart (Landratsamt Böblingen), Sprache: Deutsch, Abstract: 'Although this trait is found in 20% of the population, the actual occurance is probably closer to 50% of patients in most practices.' Dieses Zitat stammt von Elaine Aron (2010), einer amerikanischen Psychotherapeutin, die 1997 den Begriff der 'highly sensitive person' prägte. 'The trait'- das Merkmal von dem sie also spricht ist- zu Deutsch- die Hochsensibilität. Dem Zitat sind gleich zwei Kernaspekte der Hochsensibilität(HS) zu entnehmen: Zum Einen wird deutlich, wie gering der Anteil der hochsensiblen Menschen(HSM) in der Bevölkerung mit 20% ist, zum Anderen jedoch verrät das Zitat auch die hohe Relevanz für alle beraterischen Kontexte, wenn die Mehrheit der Klienten hochsensibel ist.Sowohl dieses Thema, als auch diese Erkenntnis, waren mir bis vor einigen Monaten noch völlig unbekannt, bis ich mich zufällig in ein Werk von E. Aron über Hochsensible einlas und sowohl Parallelen zu mir selbst, als auch zu einer Klientin feststellte, die ich während meiner Praxisphase im Landratsamt Böblingen im Rahmen der psychosozialen Beratung des16 a SGB II betreute. Fasziniert über das Phänomen der Hochsensibilität und damit einhergehenden speziellen Eigenarten der Klientin, beschloss ich, dies zum Thema meiner Bachelorthesis zu machen. Dabei beschäftigte mich insbesondere die Frage, wie ein Klient, der hochsensibel ist, am besten beraten werden könnte, wie die Beratungsbeziehung gestaltet sein sollte, welche Methoden verwendet werden sollten usw. Auf der Suche nach geeigneten Beratungsmethoden stieß ich auf die klientenzentrierte Gesprächsführung nach Carl Rogers. Sie erschien mir auf den ersten Blick als eine geeignete Methode, um hochsensible Klienten beraten zu können. Genau unter diesem Aspekt soll diese Thesis als eine Auseinandersetzung mit der zentralen Fragestellung 'Wie kann die psychosoziale Beratung konzipiert sein und inwieweit ist die klientenzentrierte Beratung ein passender Ansatz, um hochsensible Personen beraten zu können ' fungieren.Die zwei theoretischen Themenschwerpunkte aus 'Hochsensibilität' und 'klientenzentrierter Gesprächsführung' werden zunächst gesondert behandelt, um dann während der Beschreibung des dritten Schwerpunkts, der Praxis der psychosozialen Beratung, zusammenzufließen.Der Titel dieser Thesis 'Voll Sinn-voll' spielt bereits auf ein grundlegendes Merkmal der Hochsensiblen an. [.].